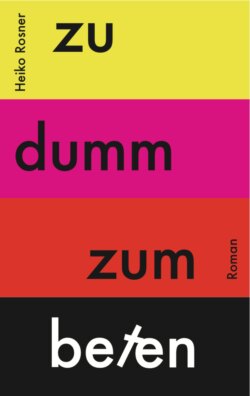Читать книгу Zu dumm zum Beten - Heiko Rosner - Страница 4
Zwei Tage vorher
Оглавление...Krach! Was war das denn? Polizeisirenen! Lautsprechergequäke! Gehupe! Alles unter seinem Schlafzimmerfenster. Siebzehn zog verärgert die Decke über den Kopf. Das half nicht viel. Jetzt kamen mit viel Lalülala noch mehr Einsatzfahrzeuge angerauscht, Feuerwehr anscheinend. Hatten die Frühaufsteher wieder Scheiße gebaut. Dabei hatte er mindestens die Hälfte seines Zehnstundenschlafs geschafft. Die letzte Nacht in der Krähe steckte ihm noch in den Knochen, oder genauer die letzte grüne Fee, die so spät nicht mehr nach Hause gehen wollte. Wenigstens war es ihm gelungen, seinen Highscore gegen den Kapitän der Titanic zu verteidigen, obwohl der im letzten Freispiel fast den Jackpot geknackt hätte. Aber eben nur fast. Bester „Mars Attacks“-Ufokiller war immer noch „17“, dann erst kam „Schae“ mit weitem Abstand auf dem zweiten Platz. Ganz hinten „Gess“, der lernte es nie. Ein schönes Geräusch war das, wenn das Eisen auf das Holz klackte, das kannten die digitalen jungen Leute heute gar nicht mehr. Knud stellte dann immer die Absinth-Flasche auf den Tisch, mit den absehbaren Folgen. Wie Siebzehn nach Hause gekommen war, wusste er nicht mehr. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass sie darüber gestritten hatten, ob man einen Film, der „2001“ heißt, einen Science-Fiction-Film nennen kann oder nicht. Auf so eine blöde Frage konnte nur Gessler kommen. Da war es aber schon fast helldunkel gewesen draußen.
Es klöterte und rumpelte. Unaufhörlich. Siebzehn hätte am liebsten Ruhäää!!! gebrüllt, aber dazu war er viel zu schwach. Ähnlich wie Luistrenker, der neben ihm vorwurfsvoll gähnte und die Nase verzog, als es nach Rauch zu riechen begann. Siebzehn drehte sich um auf die andere Seite. Versuchte wieder einzuschlafen. Schafe zählen oder Wattewolken oder egal was. Aber die Frühaufsteher gaben keine Ruhe. Neu hinzugekommen war ein scheußlich rotierendes Geräusch wie von einer kaputten Waschmaschine. Es kam näher. Wurde röhrender und lauter. Stand wie ein monotoner, kurbelnder Dauerton in der Luft. Ein Hubschrauber. Siebzehn fühlte sich in seiner Wellness massiv eingeschränkt. Die meisten Herzinfarkte ereigneten sich statistisch gesehen vor zwölf Uhr mittags, wenn die Menschen noch nicht ausgeruht waren. Man musste verdammt aufpassen. Um kein gesundheitliches Risiko einzugehen, versuchte er, die Lärmterroristen zu ignorieren. Aber das ging nicht. Sein Bett vibrierte. Luistrenker vibrierte. Alles vibrierte. Die Welt, ein Dröhnen. Ruhäää!!!
Es war noch nicht einmal elf. Eine Zumutung.
Über ihm kreiselten Fliegen in der Luft. Die schoss er normalerweise mit Männerdeodorant ab. Damit rechneten die Mücken nicht und es roch gut in der Wohnung, doppelter Vorteil. Hubschrauber konnte man mit Mückenspray leider nicht abschiessen. Vielleicht sollte er bei Big G eine Panzerfaust bestellen.
Siebzehn warf ächzend die Beine über das Matrazenlager und rieb sich den Schlaf aus den nachttrüben Augen. Was für ein Tag war heute? Montag? Freitag? Musste er wackern? Oder hatte er heute frei? Schwer zu sagen, sein Hirn war noch nicht betriebsbereit. Mit müden Augen durchflog er sein Schlafarbeitswohnzimmer, auf der Suche nach einem Wachmacher. Neben Luistrenkers Napf lag ein Feuerzeug und eine angebrochene Schachtel Zigaretten, das war schon mal ein Anfang. Er fingerte danach und steckte sich eine an. Zog den Rauch tief ein. Guut. Als er anfing Farben zu sehen, grüßte er den nackten Arsch von Nastassia Kinski, der eingerahmt an der Wand hing, ein altes Poster aus der Zeit, als noch Sexfilme gedreht wurden.
Er sortierte sich. Mittwoch. Heute war Mittwoch, jetzt fiel es ihm ein. Sie hatten gestern die Mars-Meisterschaften ausgetragen, das machten sie immer dienstags, folglich musste heute Mittwoch sein. Doch ein Wackertag, Mist.
Siebzehn warf die angerauchte Zigarette in den Napf. Er erhob sich gähnend und tappste schwerfällig ins Badezimmer. Der Mann im Spiegel sah ihn fragend an, als wollte er sagen: Was machst du denn schon hier? Für so dumme Fragen war so früh am Morgen sein Rechtsanwalt zuständig. Siebzehn klatschte sich etwas Wasser ins Gesicht, zupfte seine Rasta-Mähne breit und wankte in die Küche, wo es nicht ganz so laut war (sie ging nach hinten raus). Seinen Frühstückswhiskey fand er neben dem Tellerberg auf der Spüle. Lobenswert, dass in diesem Haushalt alles seine Ordnung hatte.
Um ersten Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen oder auch nur aus Versehen, knippste er den NDR-Dudelfunk an. Der Whiskey sorgte dafür, dass auch in den entlegensten Regionen seiner Gehirnzellen langsam die Lichter angingen. Siebzehn zog einen alten, verrunkelten Plastikstuhl heran und ließ sich nieder. Bloß keinen Stress (es roch trotzdem verbrannt, sogar hier hinten).
Das Radio erzählte von einem Naziaufmarsch in Dortmund, dem bevorstehenden Papstbesuch in Hamburg, einem abgebrochenen Eisberg in der Antarktis und einem Aufruf der Gewerkschaften für den Erhalt der Achtstundenwoche. Da war Siebzehn schlagartig hellwach.
Acht Stunden! An jedem Tag? Waren die wahnsinnig?
Arbeit.
Mit Arbeit hatte Siebzehn ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Schon als Jugendlicher hätte er lieber ein Praktikum bei der Baader-Meinhof-Gruppe absolviert, als sich von den Bütteln des Arbeitsamts beschwatzen zu lassen. Was wollen sie später denn mal werden? Wo sehen Sie Ihre persönlichen Qualifikationen? Terrorist, hatte er gesagt. Das kam damals nicht so gut an. Es war die Zeit, als sie in Berlin den Bürgermeister in eine Kiste verpackten und in den Apotheken geifernde Rentner unansehliche Schwarzweissfotos durchstrichen. Womit dieser Berufsweg praktisch verbaut war. Abgesehen davon hätte er nicht gewusst, welche Personalstelle der RAF für seine Bewerbung zuständig gewesen wäre. Als nächstes zog er das freie Unternehmertum in Erwägung, aber Bankräuber wurden ihm zu oft erschossen und als Einbrecher war man nie sicher vor schlafenden Omas oder bellenden Pekinesen. Gegen seinen Willen geriet er später trotzdem auf die schiefe Bahn und nahm einen von diesen Scheißjobs an. Ein Elend.
Arbeit war vergeudete Zeit. Niemand brauchte sie, niemand wollte sie. Er selbst war mehrere Jahre in diesem Hamsterrad mitgelaufen und die schweren traumatischen Schäden bezahlte ihm keiner. Schon das frühe Aufstehen machte ihn krank. Dazu diese unsensible Hetze. Aber auf Einzelschicksale oder wissenschaftliche Forschungsergebnisse nahm in diesem Sklaventreiberstaat keiner Rücksicht. Wo doch längst erwiesen war, dass der Fleißige sich nur kopflos in seine Arbeit stürzt und Faulenzer vorher viel länger über ihre Aufgaben nachdenken, was letztlich für viel mehr Wachstum sorgt. „Fortschritt kommt nicht durch Frühaufsteher“, lautete eine Erkenntnis des Schriftstellers und Menschenkenners Robert Heinlein, „Fortschritt entsteht, wenn faule Männer nach einfacheren Wegen suchen, etwas zu tun.“ Diesem Konzept fühlte sich Siebzehn zutiefst verpflichtet, gerade in Zeiten konjunktureller Krisen und struktureller Herausforderungen. Ein Elefant trank auch nicht jeden Tümpel auf einmal leer, der hob sich immer einen Schluck für später auf.
Wenn man diese Elefantenregel auf die Arbeitswelt übertrug, bedeutete das: Zeigen, dass man sich für die Arbeit grundsätzlich interessiert, von ihrer Ausführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber lieber absehen möchte, aus gesundheitlichen Gründen. Siebzehn war pracktisch der Erfinder des Burnout. Obwohl es das Wort damals noch gar nicht gab. Aber die Symptome – Schwindel, Laktoseüberempfindlichkeit, Schlafmangel – kannte er lange bevor ausgelaugte Professorinnen dicke Bücher über ihre Erschöpfung schrieben. Er selbst zog sich in seinen semiaktiven Jahren mehrere Splitterbrüche an der rechten Hand und eine eingedellte Nase zu – weil er morgens in der S-Bahn logischerweise erweise nicht ausgeschlafen war und beim Bremsen auf die Schnauze fiel.
Schädel hatte ihm damals den Mist eingebrockt: einen Job in der Poststelle bei Axel Cäsar. Das reinste Grauen. Schon wenn er morgens diesen Phallus von Verlagshaus sah, kam es ihm hoch. Er laß die Zeitung nicht, aber manchmal war er Ausfahrer, und dann schmiss er die Scheißpacken im Morgengrauen vor Teufelsbrück in die Elbe. Ersäuft Springer! Das fand er ein viel besseres Motto, als das von diesen alten Gammelstudenten.
Trotzdem hatte Hubsi Marcuse schon recht: Wer arbeitete, war ein Mitläufer des kapitalistischen Systems und verdiente kein Mitleid. Oder war das nicht von Marcuse? Egal, irgendwer hatte das jedenfalls gesagt, und in Frankreich packten gekündigte Schwermetaller Bomben aufs Fabrikdach gegen ihre Erschöpfungsdepressionen und den Arbeitsterror der Manager. Die Frogs waren in der Beziehung schon immer weiter gewesen als die Deutschen.
Wer arbeitet, stirbt früher: Diese Warnung müsste groß und deutlich, schwarz eingerahmt, vor allen Firmentoren stehen. Damit die jungen Leute erst gar nicht auf dumme Gedanken kamen. Schon die hellenische Gesellschaft hat körperliche Arbeit verachtet. Und die waren schließlich die Erfinder der Demokratie. Im Japanischen gibt es sogar ein Wort für den Tod durch Arbeit: Karoshi. Das wusste Siebzehn von einem Stammkunden aus Fukushimahausen, der mittlerweile an einem Schlaganfall verschieden war. Als ob sich dafür der ganze Sushi lohnte.
Wie stand schon im Bauernkalender geschrieben: Kühe machen viel Mühe.
Doch natürlich half es nichts, dem Wahn des Arbeitsterrors offen den Kampf anzusagen. Man musste taktisch vorgehen, der Rationalität der Bürozeiten das Primat der Trägheit entgegensetzen, den Feind mit unerwarteten Reaktionen irritieren und Verwirrung stiften. Als gelehriger Schüler von Hubsi Marcuses Triebstruktur und Gesellschaft und Jack Rosevelts Kampf gegen den digitalen Terror hatte er es in diesem Guerillakampf zu einiger Profession gebracht. Er kannte beispielsweise einige Knöpfe, die sich gar nicht gut mit der Funktionsweise der elektronischen Datenverarbeitung vertrugen, und wenn er Wochenenddienst hatte, pflanzte er Trojaner, die montags zur Mittagskonferenz unentkoppelbar auf einen thailändischen Porno-Tourismus-Service umschaltete.
Dennoch: Es blieb ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Alles nur für einen Gehaltsstreifen mit Steuerabzug und einen Aldi-Schokaladennikolaus am 6. Dezember. Der Tag fing erst richtig an, wenn es auf fünf ging und die sinnlosen acht Stunden vorbei waren. Warum steckte man Leute, die nichts verbrochen hatten, fünf Mal die Woche in ein Gefängnis? Wer war so krank, Arbeit als ein Privileg und nicht als sittliche Belästigung zu empfinden? Was war so toll daran, an jedem verdammten Murmeltiertag um fünf oder um sechs Uhr aufzustehen? Und woher zum Teufel kamen die Unmengen von Kakerlaken, die durch die Heizungsschlitze in der Chefetage krabbelten und dort für beträchtliches Aufsehnen sorgten, wie dem anschwellenden Sekretärinnengekreische aus den oberen Stockwerken zu entnehmen war?
Das alles waren Fragen, die ihn beschäftigten, als er seine Kündigung unterschrieb. Mit einer einzigen Handbewegung räumte er seinen Schreibtisch auf. Durch den neunten Stock, in dem die Ölköpfe saßen, zogen Schwaden von Senfgas. Das machte die Kakerlaken noch mehr verrückt. Die Server des Verlags waren deutschlandweit blockiert, bis auf das Live-Geficke aus Thailand. Als Siebzehn ging, stöhnte es aus allen Stockwerken. Was für ein widerwärtiger Sauladen.
Das alles war drei Jahre her. Seitdem hatte er ein günstigeres Einkommen gefunden, mit mehr Freizeit und einem viel besseren Lohn-Leistungs-Verhältnis. Offiziell war er natürlich arbeitslos. Das brachte ein paar Kröten mehr ein. Obwohl er auf die längst nicht mehr angewiesen war. Aber als Befürworter des Sozialstaats hielt er sich eisern an die Regeln und sicherte damit den Erhalt wichiger Jobs im Arbeitsamt. Tief in seinem Herzen war er ein guter Mensch. Wenn man ihn nur ausschlafen ließ.
Was an diesem Morgen dank der Einmischung der Frühaufsteher so ganz und gar nicht funktioniert hatte. Aber der Frühstücks-Whiskey stimmte ihn versöhnlich und so glitt er langsam und am Ende beschwerdenfrei in einen neuen Tag, der ihn mit zwitscherten Vögeln, einem strahlend blauen Himmel, einem röhrenden Helikopter und einem stechenden Brandgeruch empfing. Der ihn langsam etwas irritierte. Er schnupperte. Das roch eindeutig nicht nach Hafengeburtstag oder den Müllbeuteln aus der Eulen-Klause nebenan. Anscheinend brannte es wirklich. Der Gedanke kam in seinem Kopf an wie ein Zug mit sechsstündiger Verspätung. Feuer? Wo?
Siebzehn erhob sich und schlappte durch den Flur, ohne über die Staubflusen auf dem abgewetzten Teppichboden zu stolpern, dessen beiger Grundton mit den dunklen Brandlöchern vergangener Wacker-Verköstigungen harmonierte. Bei Gelegenheit sollte er vielleicht einmal klar Schiff machen. Vorausgesetzt, er fand die Zeit dazu. Seit er nicht mehr arbeitete, war er ein vielbeschäftigter Mann. Aufräumen konnte er höchstens am Wochenende, aber da musste er sich ausruhen, denn als Alleinunternehmer schenkte ihm keiner was. Und Frauen, die sich über Krümel oder alte Socken im Bett aufregten, flogen bei ihm sowieso raus. So what?
Er stieß die Tür zum Wohnschlafzimmer auf, so heftig, dass der neurotische Luistrenker in seinen Laken aufschreckte und wütend fauchte. Luistrenker war ihm vor einem Jahr zugelaufen oder besser zugeflogen. Er saß damals auf einer Parkbank am Balkon von Altona und wartete auf einen Kunden, der sich verspätete. Plötzlich ratschte es über ihm in den Ästen und ein haariges, dunkles Etwas fiel ihm vor die Füße. Erst dachte Siebzehn, ein dicker Vogel wäre abgestürzt, aber dann sah er, dass es eine dicke Katze war. Das Tier hatte sich bei dem Sturz verletzt und zog die rechte Vorderpfote nach. Jeder freilaufende Mistköter, und davon gab es im Jenischpark jede Menge, hätte das bemitleidenswerte Geschöpf mit einem Haps erledigt. Das konnte Siebzehn nicht zulassen. Er nahm den Dicken mit nach Hause und pflegte ihn gesund. Dabei stellte sich heraus, dass die Katze gar keine Katze war, sondern ein kastrierter Kater. Wahrscheinlich konnte deswegen nicht mehr richtig klettern. Siebzehn taufte das Opfer brutaler Emanzengewalt auf den Namen Luistrenker und gewährte ihm eine Bleibe. Es war keine Liebe auf den ersten Blick gewesen, das war es bis heute nicht. Aber wenigstens regte sich Luistrenker nicht über stinkende Socken und Zigarettenkippen im Katzenklo auf.
Himmelarsch, da brannte es wirklich, aber wie! Siebzehn stürzte ans Fenster und kam sich vor wie im Kino. Aus dem Dachstuhl gegenüber schlugen meterhohe Flammen in die Luft. Funkenregen sprühten und drohten, auf die Nachbargebäude überzugreifen. Eine Brandschatzung sondersgleichen. Warum hatten sie ihn nicht viel früher geweckt?
Das dreistöckige Mietshaus stand seit dem letzten Winter leer und war im Frühjahr gedämmt und neu angemalt worden. Dann tat sich lange Zeit gar nichts. Sogar das Gerüst von Gerüstbau Hinrichs war monatelang stehen geblieben, wahrscheinlich machte sich das besser, wenn man überteuerte Eigentumswohungen auf den Markt schob. Trotzdem war keiner eingezogen. Gut möglich, dass der Besitzer daraus die Konsequenzen gezogen hatte. Eigenbedarf mal anders.
Die Feuerwehr spritzte aus allen Rohren, Polizisten sicherten die enge Eulenstraße in beide Richtungen ab und drängelten die Schaulustigen zurück. Unverständlich, diese Gaffermeute. Wie konnte man sich nur so schamlos am Elend wildfremder Menschen delektieren? Siebzehn steckte sich eine Zigarette an. Sehr zum Missfallen von Luistrenker, der verärgert fauchte und sich in die Küche trollte. Die typischen Machtspiele von Katzen. Sollte man einfach ignorieren, sonst wurden die Biester eigensinnig und im Alter bösartig. Aus erzieherischen Gründen trat er den Fressnapf weg, der noch halb mit Kitekatstampf gefüllt war, das kotbraun den Teppichrestboden sprenkelte.
Laut krachend stürzte der Dachfirst ein, schwarze Rauchschwaden stiegen auf. Uiuiui, wenn das mal gut ging. Siebzehn zog den Chefsessel zu sicher herüber und postierte ihn vor dem Fenster. So saß er bequem und konnte die Arme auf das Fensterbrett legen. Fast wie ein alter Mann, dachte er in einem Sekundenbruchteil kritischer Selbstreflektion, aber er war ja auch schon 49 XXL und außerdem reflektierte er nicht so gern.
„Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen...“, eierte die Stimme von Hans-Dietrich Genscher ins Prager Gekreische. Scheiße, sein Handy. Wo lag das Ding bloß? „...dass Sie heute nicht ausreissen können. War alles nur ein Scherz von Helmut und mir. Hohohohoho!“
Er brauchte dringend einen neuen Klingelton. Alles zu seiner Zeit. Er sprang auf. Erst mal musste er das Handy überhaupt finden.
„Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen...“
Vielleicht unter dem Klamottenhaufen neben den CD-Regalen? Irgendwie genscherte es auch der Richtung. Hemden und Hosen flogen in alle Richtungen, aber kein Handy in Sicht. Wieso waren diese Sprechschachteln auch so klein?
„...dass Sie heute nicht ausreisen können...“
Stopp, da sah er es. Es war eigentlich da, wo es immer lag. Auf dem Nachttischschuhkasten neben dem Aschenbecher (mit der Aufschrift: „Rauchen tötet Vegetarier“). Siebzehn schnappte sich den Hörknochen und bezog wieder seinen Beobachtungsposten auf dem Chefsessel.
„...war alles nur ein Witz. Von Helmut und...“
„Los! Sag was!“ Diese Art der Anrede hatte er von den Spaniern, da hieß es übersetzt „Digame?!“ und hielt die Erinnerung an die Inquisition wach.
„Gessler hier“, erklang am anderen Ende die alarmistische Stimme des einzigen Hamburger Frührentners mit vier verschiedenen Jobs. „Hömma, gut dass du da bist. Ich bin im Krankenhaus...“
Siebzehn wischte sich die Dreadlocks von den Augen, um besser hören zu können. Er hatte gerade verstanden, Gessler würde aus dem Krankenhaus anrufen. Voll Karoshi. „Oh“, sagte er. Es war ein „Oh“, das überrascht klingen sollte, aber nur der Überbrückung diente, bis das Fräulein vom Amt in seinem Kopf den richtigen Stecker gefunden hatte. Was noch eine Weile dauernd konnte oder zwei.
Gessler war dafür geradezu unerträglich wach: „Du musst herkommen, Menschenkind!“, schrie er. „Pastor ist im Vollsuff in ein Auto gelaufen. Ausgerechnet an seinem Geburtstag! Er nullt doch heute. Mannomann! Aber jetzt braucht er Mehl! Sonst gibt es eine Katastrophe!“
„Mehl?“, fragte Siebzehn begriffstutzig. „Was denn für Mehl?“ Seine Empfangsanlage war noch nicht in Betrieb, es dauerte eine Weile, bis der Server hochgefahren war.
„Hömma, du weißt schon. Das was er braucht, wenn er WACH wird. Im Moment operieren sie noch an ihm rum, aber wenn er zu sich kommt, ist er seit Stunden offline. Dann dreht er vollkommen durch.“
Siebzehn kapierte langsam, was Gessler mit Mehl meinte. Eine etwas unglückliche, wenn nicht dümmliche Paraphrasierung für Markenprodukte aus deutschem Anbau. Aber wie sollte man auch Phantasie von einem Nichtraucher erwarten?
„Es gibt kein Mehl. Der Bäcker hat zu“, distanzierte sich Siebzehn in aller Deutlichkeit. Man wusste ja nie, wer mithörte. „Sag Pastor, er soll es so lang mit Smarties versuchen.“
„Bist du verrückt geworden?“ Gessler tickte völlig aus. „Kapier doch endlich! Du musst sofort hierherkommen. Der ist imstande und haut den ganzen Laden zu Klump.“
Daran zweifelte Siebzehn keine Sekunde. Wenn Pastor offline war, hielten ihn keine sieben Pferde auf. Trotzdem fühlte er sich außerstande für jede Form von Frühsport oder Morgengymnastik. „Tut mir leid, ich kann nicht kommen. Bei mir brennts“, sagte er wahrheitsgemäß. „Lichterloh.“ Draußen zog weißer Rauch auf. Wohl ein schlechtes Zeichen.
Das Gebrülle aus dem Hörer wurde so laut, dass Siebzehn das Handy in seine Unterhose steckte. Er gähnte und beobachtete aus verklebten Augen, wie gegenüber alle Fenster des dritten Stocks zerbarsten. Super-Spezialeffekte. Gessler plärrte unentwegt weiter. Kratzte etwas an den Eiern, war aber kein unangenehmes Gefühl. Siebzehn steckte sich eine Zigarette an. Als er sie halb aufgeraucht hatte, fühlte er nach, ob Gessler immer noch da war. Er verstand nur die letzten Worte: „..garantiere für nichts. Das ist ein Notruf, du Blödmann! Hörst du mir überhaupt zu?!“
„Jaja.“ Siebzehns vernebeltes Hirn wünschte sich zurück auf die Matraze, vergraben unter allen Daunendecken der Welt, zumindest bis zwölf Uhr mittags. Aber diese Drangsalierer in der Außenwelt kannten einfach keine Ladenschlusszeiten. „Wo bist du nochmal?“, fragte er, nur um einigermaßen auf Funk zu bleiben.
„Im Kran-ken-haus!“ Gesslers Stimme schnappte schier über. „Hier liegen lauter Halbtote rum! Und Omas mit Schläuchen untendran!“
„Nicht schön. Trink da nicht draus.“ Das sollte ein Scherz sein, aber er zündete nicht.
„Kann ich mir gerade noch verkneifen“, bellte es barsch zurück. „Ich steh nicht auf Omapisse. Also, was ist? Kommst du?“
„Na klar“, murmelte Siebzehn, während er in der Fernsehzeitung blätterte, die der Student im Erdgeschoss abonniert hatte. Am Sonntag gab es „Marvel‘s The Avengers“ auf RTL II. „Mach dir keine Sorgen. Wird alles easy. Bis gleich.“ Mit Thor, Captain America und Iron Man. „Ein Superhelden-Dampfhammer der Extraklasse“, schrieb TV-Spielfilm.
„Halt!“ kreischte Gessler. „Du hast gar nicht gefragt, was für ein Krankenhaus!“
„Hab ich nicht?“
„Nein.“
„In Altona?“
„Eben nicht. Eppendorf. Sie haben uns nach Eppendorf gepackt.“
Eppendorf. Das war die Gegend tief im Westen von Hamburg, ein Durchgangslager zum Ohlsdorfer Friedhof. Im Volksmund Depression-City genannt. Man musste den Buchstaben „D“ gar nicht vor den Ortsnamen setzen, um nur ansatzweise zu erahnen, wie grausam ein Leben in Isolationsfolter und ewiger Verdunklung sein muss (Wenn Sie je mit dem 20er oder 25er am Eppendorfer Marktplatz halten, steigen Sie bloß nicht aus). So gesehen ging Eppendorf gar nicht. Außerdem hatte er – wenn er sich recht erinnerte – einen Termin bei den Pferdekutschern in Hamburg-Horn.
Siebzehn blätterte zurück. Wann fing noch mal die Übertragung der Apothekerrundfahrt auf Sport-Quark an?
„Hallo?“, quakte Gessler am anderen Ende. „Hömma, bist du noch da?“
Siebzehn stöhnte. Was für eine Nervensäge. „Jaja“, sagte er, während er mit verkniffenen Augen versuchte, das Kleingedruckte auf der Spalte des Sportkanals zu entziffern. „Eppendorf, verstehe“, murmelte er. „Wie geht’s ihm denn?“
„Wem?“
„Na, Pastor.“
„Die Beine sind grün und blau. Was weiß ich? Mir sagt ja keiner was.“
„Aber ist alles noch dran?“
„Ich glaube, das würde den Ärzten schlecht bekommen, wenn sie ihm irgendwas absägen.“ Gessler wurde ungeduldig. „Kommst du jetzt oder nicht?“
Da. Zehn Uhr. Beginn der siebten Etappe. Das hieß, sie fuhren schon. Siebzehn fummelte nach der Fernbedienung. „Das ist mir alles zu transparent, ich überleg mir das“, sagte er kurz angebunden. „Richte Pastor schöne Grüße aus und halte die Stellung. Alles andere besprechen wir in der Krähe.“
Er hörte Gessler noch zeteren, drückte ihn aber weg und warf das Handy auf die Frühstücksschuhschachtel, wo es hingehörte. Der Bildschirm flammte auf und zeigte Drogisten im strömenden Regen, die sich eine steile Bergpassage hochquälten. Wunderbar. Er lehnte sich bequem im Chefsessel zurück. Siebzehn liebte Sport (obwohl man ihm das nicht ansah).
Weil das Feuer gegenüber aufgrund des beherzten Eingreifens der freiwilligen Pyromanen in den letzten Zuckungen lag und wohl kaum noch auf benachbarte Grundstücke überzugreifen vermochte, richtete Siebzehn seine Aufmerksamkeit auf den Zwanzig-Zoll-HDXL-Schlankfernseher, den er bei einem Gegengeschäft mit Big G abgefischt hatte. Eigentlich war die Glotze viel zu groß für den den knapp zwanzig Quadratmeter großen Raum, den er gleichzeitig als Schlafzimmer, Büro und Meditationszentrum benutzte. Obwohl er nie im klassischen Sinn meditierte. Sitzen und Sinnen, dann womöglich Schauen und Schaffen, das waren so seine Übungen. Also nichts was den Kreislauf zu sehr beanspruchte. In seinem Alter sollte man lieber die eine oder andere Zigarette mehr rauchen, als sich unnötig zu überanstrengen. Das meinte auch Doc Carstensen, der Arbeitnehmerarzt im Viertel, ein entschiedener Verfechter des Passivarbeitens und der Sportverweigerung. Der Doc war es auch gewesen, der Siebzehn den Tipp gegeben hatte, sich im Fernsehen zur Entspannung Golfturniere, Skischanzenspringereien, Marathonwettläufe oder andere komplett sinnlose Sportarten anzusehen. Das entschlackte und sorgte für eine geregelte Blutzirkulation. Und nichts war Siebzehn wichtiger als eine ordentliche Passivgesundheit.
Seither war er ein Fan der Tour de Trance, eines sportlichen Unfugs, der zwar gähnend langweilig war, aber aufgrund ihrer Nähe zur Dogenkriminalität über einen kollegialen Reiz verfügte. Mittlerweile hielt er die Übertragungen der Frankreich-Rundfahrt gar für eine der besten Kultursendungen des deutschen Fernsehens. Wo sonst erfuhr man, dass in der Bretagne die Fischwirtschaft dahinsiecht, dass das größte manuell betriebene Glockenspiel in der Provence steht oder in den südfranzösischen Wäldern wieder freilebende Bären ihr Unwesen treiben. Auch die Fachbegriffe der Radlersprache wie Windkanten, Kreuzgängeln, Schiebeschub oder Kernmuffenoptimierung übten eine kuriose Faszination auf ihn aus. Am schönsten war es aber natürlich, wenn einer mit dem Rad nicht die Kurve kriegte und ungebremst in die Botanik kachelte. Noch besser waren Massenkollisionen im Zielsprint.
Dabei war Siebzehn im Grunde seines Herzens Fußballfan. St. Pauli-Dauerkartenbesitzer seit der Besetzung der Hafenstraße, Weltpokalsiegerbesieger, Tabellenführer der ersten Bundesliga am 12. August 1995 und Erster der Herzen in Hamburg hinter der Mannschaft mit dem Stadion neben der Müllverbrennungsanlage. Dazwischen gab es einige wenige Niederlagen. Geschenkt. Deutscher Meister konnte nur der FC St. Pauli werden. Das sahen die Marcel Reifs dieser Welt nur noch nicht voraus. Aber jetzt war Sommerpause, und im Fernsehen liefen nur Testspiele oder Freundschaftsbegegnungen zwischen Hertha BSC und Dunlop Olpe, ganz zu schweigen von der Simulations-WM der Frauen (nie war Zeitlupe überflüssiger). Es war noch lange hin bis zum Bundesligastart. Irgendwie musste man die Zeit überbrücken und da war die Frog-Tour mit ihren schicken AKW-Bildern und hohen Bergen gar kein schlechtes Methadon.
Spannend fand er vor allem die Zuschauerfragen. Warum bei der Tour so wenig Schwarze mitfahren. Wie die Sattelstützen berechnet werden. Ob Pinkelpausen mitgezählt werden. Er rief manchmal selbst im Studio an, und fragte, ob bei Schussfahrten ins Tal die Gangschaltung ausgestellt werden muss, was die französische Polizei macht, wenn bei Ortsdurchfahrten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschritten wird oder seit wann Jan Ullrich nicht mehr mitfährt? Diese Form des interaktiven Fernsehens nannte er Gonzo-Lotto und er betrieb es mit wachsender Begeisterung. Erst vor kurzem hatte er in der Phoenix-Nachgefragt-Runde des ARD-Presseclubs angerufen, und den Alleswisser-Zerberus der Trockenhauben-Illustrierten Stern live zum Thema Casino-Kapitalismus gefragt, wieso er so ein Geheimnis darum machte, dass er auf der Payroll des Industriedachverbands der deutschen Dax-Unternehmen stand. Das gab ein Gebrülle, sagenhaft! Obwohl alles frei erfunden war. Oder gut geraten. Jedenfalls bekam der Stern-Heini einen Riesenärger und Siebzehn rief noch am selben Nachmittag in der „Gegengerade“-Talkshow von Sport 1 an, wo er verriet, dass Bastian Schweinsteiger ein gemeinsames Schwarzgeldkonto mit Joachim Löw hatte.
Werbepause. Er zappte weg und landete in einer Phoenix-Diskussionsrunde mit dem Thema „Starke Frau sucht schwachen Mann – Der Wandel des Beuteschemas?“ Eine Frau mit sehr langem Hals sagte, die Lebensläufe zwischen Erwerbsarbeit und Kinderkriegen müßten dringend entzerrt werden. Seine anderen Lieblingssendungen waren „Exaktes Hellsehen mit Hilli“ auf Astro-TV („Ich kann sehen bei dir berufliche Veränderungen Ende Oktober.“) und die Ratgeber-Show „Domian“ nachts um eins auf WDR 3. Da hockte mitten in der Nacht live ein schnurrender Schmuseonkel und tröste schniefende Teenager, die seit fünf Tagen Single waren oder an anderen psychischen Erkrankungen litten. Siebzehn hatte auch einmal angerufen, und sich als homosexueller Bundesligaspieler mit Erektionsproblemen ausgegeben. Im Verlauf des Gesprächs mit Domian gab er zu, dass er sich heimlich ritzte und gern kleine Jungs in Bayern-München-Trikots strangulierte. Daraufhin flog er kommentarlos aus der Leitung. Die hatten auch gar keinen Humor, nachts im Fernsehen. Da rief er lieber weiter bei Sportsendungen an, die erklärten ihm wenigstens, warum es so wenig Schwarze mit Gangschaltung gab.
Siebzehn schaltete um God-TV, ein Sender, den er wegen seines elaborierten Bildungsauftrags schätzte. Eine Art Fischer-Chor sang vor majestätischer Bergkulisse das Lied vom letzten Sähmann: „Sähmann, sähe, ich sehe dich, wir sind dein Korn, wir sind dein Kind, Sähmann, oh Sähmann, sähe nur geschwind.“
Das gefiel Siebzehn. Diese Christen hatten von allen TV-Entertainern die abgefahrensten Show-Ideen. Ein Seemann im Gebirge, war das nicht ein geradezu Sloterdeijksches Volumengleichnis über den Menschen, der in dieser Welt geworfen nach seinem Hafen sucht, aber ihn auf der Zugspitze und dem Großen Brocken nirgends finden kann? Was für ein Schicksalsdrama. Siebzehn konnte sich in den Seemann gut hineinfühlen, denn ähnlich war es ihm bei Springer ergangen.
Siebzehn hieß eigentlich Karl-Heinz Bredstedt, stammte aus Bad Segeberg und wollte seit seiner ersten Rory-Gallagher-Platte Rockstar werden. Das klappte nicht (aus den verschiedensten Gründen, einer davon war, dass er auf der Gitarre über das erste Riff von Black Sabbaths „Iron Man“ nie hinauskam). Die Liebe verschlug ihn nach der Reichswehr Hamburg, wo er den Kapitän der Titanic kennenlernte. Schädel arbeitete in der Poststelle des Springer-Konzerns, und nachdem einer seiner Kuriere sich totgesoffen hatte, verschaffte er seinem Kumpel aus Bad Segeberg den Job. Seitdem hieß Karl-Heinz Bredstedt Siebzehn, denn Siebzehn war die Nummer, unter der er fuhr. Die Liebe zerschlug sich, der Job auch. Rory Gallagher hatte keine Lust mehr, jeden Tag bis in die Puppen von der Kaiser-Wilhelm-Straße in die Druckerei nach Ahrensburg zu kurven. Er schmiss hin. Nur der Name Siebzehn, der blieb an ihm kleben.
Schädel kündigte wenig später ebenfalls. Kurz darauf brannte vor den Gourmettempeln in der Friedensalle der erste Jeep Cherokee. Zufällig gehörte er dem Chefredakteur der Bild-Zeitung. Nach den Anti-G-8-Ausschreitungen testeten sie auch andere Wagentypen, ohne je ernsthafte Aktivistenkarrieren anzustreben. Obwohl sie hin und wieder Scheiben einwarfen, aber nur die von Ketten. Sie nannten das energetische Ertüchtigung. Ein klares Ziel verfolgten sie mit ihren Aktionen nicht. Sie wollten nur, dass es für die anderen langsam ungemütlich wird. Und weil immer mehr Anwälte, Manager und Makler in Ottensen wohnten, ging ihnen die freie Wahl der Luxusschlitten nie aus. Sie wollten schließlich nicht die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen.
Siebzehn hatte mittlerweile zur Tour zurückgeschaltet, die Werbung war zu Ende. Oh, das war steil, verdammt steil. Ein Berg der höchsten Kategorie, und dann auch noch bei dem Dreckswetter. Musste irrsinnig anstrengend sein. Siebzehn hatte einmal versucht, mit einem gefundenen Fahrrad den Sühlberg hochzukommen, aber schon nach halber Strecke stieg er mit hängender Zunge vom Sattel. Die Leistungsapotheker im Fernsehen kannten solche Probleme natürlich nicht. Die fuhren mit Eigenbenzin. Kein Mensch schaffte über Stunden solche Berge ohne Verstärker im Saft. Obwohl jetzt trotzdem einige ins Trudeln gerieten. Da, der erste fiel um, der zweite, da, ein dritter gab auf, wegen Erschöpfung. Dummerweise sah man kaum noch etwas. Der Schlussanstieg nach L’Alp d’Huez führte durch eine geschlossene Nebelwand, die das Peleton komplett einhüllte. Zustände wie am Nanga Parbat. Für die Attraktivität des Rennens war das gut. Für seine persönliche Statistik weniger.
Er hatte ausgerechnet, dass er in den letzten Tagen 2348 Kilometer Tour de France gesehen hatte, die Kilometer die er verschlafen hatte mitgerechnet. Eine reife Leistung, wie er fand. Da sollte man eigentlich eine bessere Übertragungsqualität verlangen können. In allen Krimis gab es heute Nachtsichtgeräte, die den Mensch als roten Hitzefleck zeigten. Sogar Bomben und Raketen hatten mittlerweile ihre eigenen Bordkameras, die bei noch so schlechtem Wetter aus subjektiver Anflugperspektive zeigten, wie Al-Kaida-Jugendherbergen oder Giftgasarsenale superscharf in die Luft flogen. Und da sollte es nicht möglich sein, saubere Bilder von der Tour de France zu liefern? Wegen der paar Wolken? Jamais, mon President!
Nein, da steckte etwas ganz anderes dahinter. Siebzehn glaubte nicht an Verschwörungstheorien, aber den Frogs traute er alles zu. Franzosen waren Halsabschneider. Vorhin hatte noch der Neuseeländer geführt, knapp vor den Bauernkreditfahrern. Die Bauernkreditfahrer waren die Frogs, die kannten sich da oben aus. Für die war es ein Leichtes, ortsunkundige Kiwis auf einen Feldweg umzuleiten, der erst 800 Meter tiefer weiter ging. Diesen heimtückischen Froschfressern traute er alles zu.
Der Bildschirm zeigte weiter grau in grau. Die Regie schaltete zur Talstation um, wo blasse Konturen der Zieleinfahrt zu erkennen waren. Siebzehn steckte sich eine Lulle an, zog tief durch und legte etwas Morgengymnastik ein. Linkes Bein hoch, rechtes Bein hoch, dazu den Nacken kreiseln lassen. Bevor es knackte, stellte er die Übung ein.
Dabei beschlich ihn das unangenehme Gefühl, dass er beobachtet wurde. Und tatsächlich, Luistrenker, der psychopathische Miesepeter, hatte sich wieder in den Raum geschlichen, wohl auf der Suche nach seinem Fressnapf, der verunglückt zwischen dem Erich-Honecker-Gedächtnisaltar und den vertrockneten Pizzaschachteln vom letzten Samstag lag. Siebzehn warf einen alten Schlappen, der den Kater um Haaresbreite verfehlte. Das Biest fauchte wütend und vollführte mit gestauchtem Buckel einen Zweimetersatz zur Seite.
„Hau ab, du Scheißvieh“, brüllte Siebzehn, der so früh am Morgen leicht reizbar war und von seinem Asylbewohner Rücksicht erwarten durfte. Sonst setzte es ganz schnell einen Arschtritt.
Leicht verstimmt konzentrierte er sich wieder auf die Radler, die den Kamm überwunden hatten und im rasenden Tempo auf der Rückseite des Berges die Nebelwände durchschnitten. Der Neuseeländer war nirgends mehr zu sehen. Dafür lag plötzlich der hagere Spanier, den sie Speedy Gonzales nannten, in Front. Von zehn Sprintwertungen der vorherigen Etappen hatte er acht gewonnen, was für saubere Assists der medizinischen Abteilung sprach. Einer von den Franzosen klebte an seinem Hinterrad und ließ sich nicht abschütteln. Nur noch zwei Kilometer bis zum Ziel, und es ging die ganze Zeit bergab. Aber in gefährlichen Serpentinen und auf nassem Pflaster. Wie schnell konnte da etwas passieren. Siebzehn verfolgte gebannt den Spurt von Speedy Gonzales, der sich Meter für Meter absetzte und trotz des peitschenden Regens die Kurven in den gefährlichsten Winkeln schnitt. Das Motorrad mit dem Kameramann auf dem Sozius kam kaum noch nach. Was für ein Wahnsinn. Der Kerl war uneinholbar, zwischen dem Spanier und dem verfolgenden Frog klafften mittlerweile mindestens drei Radlängen. Was auch immer Speedy Gonzales im Tank hatte, Dr. Fuentes und seine Pillendreher hatten sich wieder einmal selbst übertroffen.
Noch fünfzig, vierzig, dreißig Meter. Dann die Zieleinfahrt. Speedy Gonzales war der Sieger der zwölften Etappe der Tour de Trance. Rotgelbe Fahnen wurden geschwenkt, die Tour hatte einen neuen Träger des gelben Trikots und ein Hubschrauber flog den Neuseeländer ins Krankenhaus von Avoriaz. Am nächsten Tag der nächste Berg, mit etwas Glück sollte das Wetter sogar noch schlechter werden. Très Beaujolais.
Siebzehn warf den heißen Stummel der Lulle aus dem Fenster und rüstete sich innerlich für einen neuen Tag. Der ganz schön Scheiße angefangen hatte. Pastor, dieser Trottel. Rannte vor ein Auto. Diesen verrückten Polen konnte man auch keine Sekunde aus den Augen lassen. Die letzten drei Wochen war er trocken gewesen, aber Doc Carstensen meinte, um seine Leberwerte aszudrucken, bräuchte er jedesmal eine neue Papierrolle. Dabei war Pastor nicht mal versichert. Sollte die sich im Krankenhaus damit rumschlagen. Siebzehn fühlte sich außerstande, in seinem geschwächten Zustand eine Weltreise nach Eppendorf anzutreten. Und dann noch in ein Krankenhaus. Dicke Weiber in weißen Kitteln bereiteten ihm Bluthochdruck, der amöbenhafte Geruch in den Gängen war schlecht für seine Haut und man hörte immer von diesen giftigen Ebola-Keimen in der Cafeteria und den Raucherzonen. Er hatte eine andere Idee.
Zehn Minuten später war die Sache geregelt. Dem Taxifahrer sagte er, dass sein Großvater schon leicht dement war, aber für eine Flasche Eierlikör von seinem Enkel bestimmt ein gutes Trinkgeld springen lassen würde. Dann spratzte er Luistrenker eine Thunfischhagebuttenschleim in den ungewaschenen Fressnapf und begab sich auf Patrouille durch das Viertel.
Auf der Straße roch es nach geplatzen Müllbeuteln und frischem Mutterkuchen.
*
Wir lassen uns unser Freiräume nicht klauen. Mehr Geld für offene Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien in Hamburg.“
Das Transparent hing vor der Motte, einem Kulturzentrum in Hamburg-Ottensen, in dem arbeitslose Theatergruppen gastierten und Dritteweltmusiker Rache für die koloniale Knechtung vergangener Jahrhunderte nahmen. Der Rauch war mittlerweile abgezogen, die Feuerwehr rollte ihre Schläuche ein, bei einem der Immobilienhändler an der Alster schrillte jetzt wahrscheinlich das rote Telefon.
Siebzehn trottete über die Eulenstraße, vorbei am „Leaf“ (ein Veganer-Restaurant, vor dem sie letztens einen Kübel Schweineblut ausgekippt hatten) und dem Wucher-Gourmet-Schuppen „Große Brunnenstraße 19“ (ein Lammfilet an Rosmarienkartoffeln und Selleriedipp, 18 Euro 99, fast geschenkt!), in der es früher ganz normale Hamburger Hausmannskost und Labskaus hoch und runter gab. Er überlegte, was die von der Motte wohl unter „offenen Angeboten“ verstanden. Gab es auch geschlossene Angebote? Machte da jemand die Tür auf und zu, oder wie sollte man sich das vorstellen? Wieso schrieben sie nicht gleich „billige Angebote“, das war doch wohl gemeint. Klang wahrscheinlich zu ideologisch. Damit machte man sich in diesem bürgerlichen Wohnviertel verdächtig. Der Aufstand gegen zu hohe Mieten, leerstehenden Wohnraum oder NPD-Demos am Altonaer Blutsonntag sollte selbstverständlich geführt werden, aber bitte innerhalb des Rahmens. Wir sind doch hier nicht bei den Räubern. Nee, aber bei grünen Oberstufenlehrern. Siebzehn kannte das Pack, das im Plenum der Motte hockte. Wegen solchen Lurchen würde es sich ernsthaft lohnen, CDU zu wählen. Nur damit man ihr blödes Geschwätz nicht mehr hören musste.
Vor Teufels Küche kam ihm Fatih entgegen. Mit der Schauspielerin Nina Petri an seiner Seite. Die wohnte auch ums Eck. Siebzehn grüßte kurz. In Ottensen wohnten eine Menge Promis, Hannelore Hoger mit ihrem Bonanza-Rad, Peter Franke, der meistens im Roth Hof hielt, Peter Lohmeyer, den es aber eher selten aus dem „Pudel“ unten an der Elbe spülte, und natürlich die Fatih-Akin-Gang um Moritz, Adam und Chico. Allerdings gehörte es in Ottensen zum guten Ton, um diese Filmpeople kein sonderliches Aufsehen zu machen. Man kannte sich vom sehen, das reichte. Obwohl Siebzehn und Schädel Fatih sogar etwas besser kannten, denn sie hatten in einer Gaststättenszene von „Soul Kitchen“ am Tisch gleich neben der Kamera gesessen. Das verbindet. Fatih winkte erkennend zurück, Siebzehn nickte und schlurfte weiter.
Wahrscheinlich fragte sich Nina Petri, wer dieser gutaussehende Mann war, der mitten im Sommer so eine dicke Lederjacke trug.
Am Spritzenplatz wankte ein Betrunkener aus Möller’s Gaststätte und verkündete lauthals, dass die Erde in exakt drei Stunden untergeht. Seltsam war, dass er weder Hose noch Unterhose trug, dafür ein blütenweißes Hemd und einen karierten Schlips, als hätte er erst gestern wichtige Verhandlungen mit der Deutschen Bank geführt (wenn Cash bezahlt wurde, achte man bei Möller nicht auf Äußerlichkeiten). Eine rothaarige Frau stürzte ihm hinterher, immerhin angekleidet, aber noch betrunkener, und dem Hosenlosen in wenig Zuneigung verbunden. Es entspann sich ein lauter Disput, der sich um ein unbezahltes Kind, Mietschulden und eine Susie drehte, die der Rothaarigen lieber nicht mehr unter die Augen kommen sollte. Einn normaler Ehestreit, nur mit dem Unterschied, dass er in aller Öffentlichkeit auf dem Spritzenplatz ausgetragen wurde und beide zu besoffen waren, um sich verprügeln zu können.
Siebzehn schob an dem krakeelenden Pärchen vorbei und passierte die gesichtslose Zaratomtailorstarbuck-Ödniss der Ottenser Hauptstraße. Die Schreierei hinter ihm ging weiter, vielleicht war Susie dazu gekommen. Manchmal war Siebzehn richtig froh, dass er in den gefährlichen Jahren frauenlos geblieben war. Am Ende hätte er sonst auch so eine unegale Kreischfurie am Hals. Nicht auszudenken. Ihm reichte schon Luistrenker.
An der Beisser-Metzgerei erregte ein Stand seine Aufmerksamkeit. „Wem gehört die Stadt?“, fragte es von einem riesigen roten Transparent. Daneben Plakate mit Inschriften wie „Weg mit Luxusbauten“ und „Wir wollen keine Yuppies in unserem Viertel.“ Dass es so etwas noch gab. Als ob die Yuppies mit ihren Designershops und Kettenboutiquen nicht längst ganz Ottensen in ihren Besitz genommen hätten. Siebzehn trat trotzdem näher, neugierig, auch ein bisschen sentimental berührt. Die jungen Leute am Stand trugen T-Shirts mit „Miethaie raus, Migranten rein“-Aufdruck. Sie hätten Siebzehns Söhne oder Töchter sein können, mit ihren bunten Haaren und Anschraubern auf den Lippen, die furchtbar beim Küssen stören mussten. Ob sie die vorher abnahmen? Nicht, dass ihn diese Frage furchtbar beschäftigte, aber man machte sich halt so seine Gedanken.
Auf dem Tisch lagen die üblichen „Bundeswehr raus aus dem Iran“-Sticker und Anti-Hartz-IV-Flyer. Er griff nach einem der Flugblätter. „Hamburg wird luxussaniert,“ laß er. „In der Bergstraße, die einmal Hamburgs erste Fußgängerzone war, sind die Mieten dank des Ikea-Baus um bis zu 70 Prozent gestiegen. Die kleinen Läden machen dicht, die alten Einwohner werden verdrängt. Wir weigern uns, diese Stadt in Marketing-Kategorien pressen zu lassen. Wir glauben: Eure ,Wachsende Stadt‘ ist in Wahrheit eine segredierende Stadt, wie im 19. Jahrhundert: Die Promenaden den Gutsituierten, dem Pöbel die Mietskasernen außerhalb. Wir fordern: Bezahlbarer Wohnraum für alle! Wir stellen die Frage, die in den Städten heute auch eine Frage von Territorialkämpfen ist. Es geht darum, Orte zu erobern und zu verteidigen, die das Leben in dieser Stadt auch für die lebenswert machen, die nicht zur Zielgruppe der ,Wachsenden Stadt‘ gehören. Denn die ,Wachsende Stadt‘ ist eine untergehende Stadt. Wir wollen leben! In Ottensen, St. Georg, im Gängeviertel und anderswo! Sonst ist bald jeder Tag ein 1. Mai!“
Der subtile Umgang mit der Gewaltfrage gefiel Siebzehn. Das hatten sie früher ungeschickter gehandhabt.
„Der nächste Mietspiegel kommt bestimmt“, laß er weiter. „Aber wir wissen, wo eure Fettautos stehen. Haut lieber ab.“
Eine klare Ansage. Erfrischend, dass es es so etwas heute noch gab. Ein schlankes Mangamädchen mit viel Kajalschwarz um die Augen und einem makellosen Gesicht wie mit Fotoshop gemeiselt trat auf ihn zu. „Hallo“, sagte sie einladend lächelnd. „Wohnst du hier in der Gegend?“
War das eine Anmache? „Wieso, du nicht?“, fragte er zurück. In Gedanken ertappte er sich bei einer Männerphantasie, die er in keinster Weise brüderlte.
„Nee“, sagte Kajalauge. „Bin nur eingeteilt. Aber wenn du im Viertel wohnst, darfst du unterschreiben.“
Sie schob ihm einen Klemmblock zu, auf dem eine schon zu zwei Dritteln ausgefüllten Unterschriftenliste im Wind flatterte. Überschrift: „Miethaie raus aus Ottensen!“ Daneben ein schlecht gemalter Hai, der mehr aussah wie eine Forelle mit Piranhazähnen und mit dem Kopf in einer Guillotine steckte.
Für dadaistische Kunst hatte Siebzehn etwas übrig. „Aber nur zu gern“, sagte Siebzehn und schnappte sich den Block. Er trug fein säuberlich ein „Karl-Heinz Bredstedt, Eulenstraße 55, 22765 Altona“ ein. Nur bei der Sparte „Beruf“ zögerte er kurz. War das datenrechtlich erlaubt? Aber er wollte die Zeile vollkriegen, deswegen schrieb er „Kunstwissenschaftler“ hin. Atomingenieur hätte zu angeberisch geklungen.
Die kleine Manga-Göre ließ ihn die ganze Zeit nicht aus den Augen. „‘Ne coole Jacke hast du da an“, sagte sie, als Siebzehn ihr den Klemmblock zurückreichte. „Dreh dich mal um.“
Den Gefallen tat ihr Siebzehn nur zu gern. Im richtigen Moment zog er den Hintern ein, kaum merklich.
„Cool,“, sagte Kajalauge beim Anblick des Büffel-Totenschädels unter dem Western-Schriftzug DAKOTA. „Wie die Fahne von St. Pauli.“
„Nur mit anderen Knochen.“ Siebzehn drehte sich wieder um und sonnte sich in der ungeteilten Aufmerksamkeit der Manga-Queen. „Ist ein Einzelstück“, sagte er, ohne angeben zu wollen. Was sogar stimmte, denn auf dem Flohmarkt der Altonale hatte es im letzten Jahr nur diese einzige Dakota-Jacke gegeben und er hatte sie für zehn Euro geschossen. „Jeder Knochen ist handgenäht. Gibt auf der ganzen Welt keine zwei Dakota-Jacken, die gleich aussehen.“
Das hatte er zwar gerade erfunden, tat der Bewunderung des Manga-Mädchens aber keinen Abbruch. „Echt cool. So eine hätte ich auch gern. Aber - ist die nicht zu warm für‘n Sommer?“
Siebzehn wiegte bedächtig den Kopf, denn gerade in der heißen Jahreszeit hatte er ganz und gar nichts gegen dünne Blusen. „Die merkst du kaum. Trägt sich wie...“ Er überlegte. „...wie gar nichts.“ Was auch nicht ganz stimmte, denn gerade jetzt war es ihm verteufelt heiß (hatte wohl nicht ganz geklappt mit der Männerphantasie).
Kajalauge merkte davon zum Glück nichts. Zumindest tat sie so. „Super“, sagte sie in Abweichung ihrer sonstigen Terminologie. Sie griff unter den Tisch, zog etwas Weißes, Rundes hervor und ratschte eine Klebefolie weg. „Dann schenke ich dir das. Damit man dich auch von vorne erkennt.“ Mit diesen Worten klatschte sie ihm den Aufkleber auf die Brust. „Miethaue raus aus Ottensen“, stand darauf. Ohne Forellenhai.
Siebzehn war gerade im Begriff, die vermeintliche persönliche Adelung als Ausdruck einer außergewöhnlichen Wertschätzung zu inhalieren, als sich ein zitterrütteliger Renter mit Rollator neben ihn schob. Kajalauge sprang sofort auf ihn zu: „Hallo. Wohnst du hier in der Gegend?“
So astrophysikalisch schnell konnte eine weibliche Aufmerksamkeitsspanne sich auf ein neues Ziel ausrichten. Nicht dass Siebzehn diese Erfahrung zum ersten Mal gemacht hätte. Es wunderte ihn nur immer wieder, dass Frauen offenbar über ein Gen pragmatischer Effizienz verfügten, wo Männer einen blinden Fleck hatten. Für das Manga-Mädchen war er Geschichte und eine Unterschrift auf einem Zettel. Die Männerphantasie ging nach Hause (leicht gekränkt). Den Aufkleber ließ er trotzdem dran, rein aus Trotz. Scheißmangas.
Er trottete weiter und betrat das Mercado, das Ottenser Einkaufszentrum mit schicken Geschäften von Gucci und Flutschi und Elektronikgeräten von der letzten Weltraumaustellung. Als der riesige Geschäftsklotz 1992 eröffnet wurde, regte sich der Protest der Gutbürger, denn auf dem Baugelände befanden sich die Überreste eines jüdischen Friedhofs, der einst von den Nazis zerstört und zubetoniert wurde. Nach langen Verhandlungen brachten die Betreiber eine Gedenktafel im Untergeschoss an, was die moralischen Bedenken der konsumwilligen Ottenser schlagartig zerstäubte. Heute nahm keine Sau mehr Notiz von den historischen Totenplatten, an denen man vorbei musste, wenn man im Budni Badewannen-Ex oder Pfirsichshampoo erwerben wollte. Gelungene Integration, leicht gemacht.
Im Mercado gab es nichts, was Siebzehns Kaufinteresse hätte wecken können. Überall dieselben Teenie-Läden und „Sale, sale“-Schickiboutiquen. Aber sie hatten eine sehr gute Pizza im Mercado. Grazzianos italienischer Imbiss befand sich inmitten der Obst-Gemüse-und-Blumen-Wandelhalle, die dem Einkaufszentrum seinen Namen gegeben hatte, eingeklemmt zwischen einem unverschämt teuren Weinhöker und einem Sushi-Stand für den gehobenen Rollmops-Ästheten. Die Pizza von Big G war weit und breit die Beste, ohne viel Schnickschnack, dünn, saftig, gut gewürzt, was wollte man mehr. Siebzehn war gern zu Gast am Pizzaofen, vor allem wenn Grazzianos bildhübsche Tochter Leitita bediente. Ein Traum von einer Frau. Langbeinig, schwarzhaarig, immer tief dekolletiert (darauf legte der Vater Wert). Nicht dass Siebzehn bei Leitita andocken wollte. Nein, er kam nur zum Gucken. In seinem Alter machte man sich wegen Frauen nicht mehr zum Vollhirsch. Außerdem hatte sie eine hohe, krähende Stimme und redete viel zu schnell - Italiener halt. Trotzdem war sie genau das, was Siebzehn in seinen Macho-Zeiten eine Pflaume zum Mitnehmen genannt hätte. Letitia selbst sendete übrigens durchweg empfangsbereite Signale, was die Sache für Siebzehn nicht leichter machte. Aber, Himmel, sie war die Tochter des Chefs, und er legte es nicht darauf an, eines Morgens mit einem abgeschnittenen Pferdekopf im Bett aufzuwachen. Dann lieber nur Gucken.
Zügigen Schrittes passierte er der Douglas-Parfümerieabteilung, deren Gestank bei ungünstiger Belüftung bis zur Gedenktafel für die jüdischen Gasopfer wehte. Vorbei an H&M nahm er die Abkürzung links am gläsernen Fahrstuhl, wo er unversehens mit einem bösartigen Hindernis konfrontiert wurde: Ein Geschwader von Kinderwagenmüttern.
Eine gemeingefährliche Brut. Wenn sie im Rudel auftraten, waren sie aggressiv und unberechenbar wie extremistische HSV-Fans Samstagnachmittags um viertel nach fünf. Siebzehn zählte mindestens zehn, wenn nicht zwölf Kampfmütter. Alle mit beleidigt verschraubten Gesichtern, als wäre es ihr gutes Recht, an den engsten Stellen eines Kaufhauses die Durchgänge zu blockieren, um Aufmerksamkeit für ihr kreischendes Gebälgertum zu erzwingen. Verweigerte man ihnen diese, fühlten sie sich von der nichtgebärenden Mehrheit böswillig diskriminiert und biologisch auf ihr Frausein reduziert. Dann drehten sie errst recht durch und belagerten mit ihrem Geschiebsel auch die letzten Fluchtwege. An ihren Knotenpunkten diskutierten sie gern ebensolche in der Brust, aber auch die splatterigsten Einzelheiten des Geburtsvorgangs, die zeitsparenden Vorteile eines Kaiserschnitts („Einmal ratsch, alles raus und zu.“) oder die Wunder des Langzeitstillens („Meiner ist fünf und nimmt nur die linke“). Wer als unbeteiligter Mann in so einen Mutter-Mob reingeriet, war ganz schön verratzt. Es half auch nichts, so zu tun, als würde man die Scheißbabys niedlich finden. Das machte die Mütter erst recht misstrauisch, denn die meisten waren alleinerziehend und extrem empfindlich für die ersten Anzeichen sexuellen Missbrauchs. Dann setzten sie schnell diesen schwer beleidigten Alimente-Blick auf. Da half nur nur die Flucht. Nur wohin? Einige Lokale in Ottensen waren mittlerweile treppengeschützt, aber selbst das bot keinen ausreichenden Schutz vor dem Einfall der Kiwamüs. Sie wuchteten ihr vierrädriges Geschreisel einfach kollektiv die Stufen hoch und machten sich demonstrativ vor den Singletischen breit. Die schnell frei wurden, weil niemand das Gekreische und Hapa-Happa-Gejuckele ertrug. Ein Elend. Überall sonst starben die Deutschen aus. Nur nicht in Ottensen.
Siebzehn wollte keinen Ärger riskieren. Er reduzierte sein Tempo trotzdem nicht, denn er erspähte eine Lücke. Die Frauen hatten eine Wagenburg gebildet, einen undurchdringlichen Kordon ineinander verkanteter Babykübel. Annähernd perfekt. Nur an einer Stelle klaffte ein Loch, bedingt durch die Nachlässigkeit einer Mutterwachtel von der Statur einer Gewichtheberin, die in ein Gespräch mit einer fernsehzeitungsbunten Paris Hilton vertieft war. Siebzehn legte einen Zahn zu und schoss wie ein Rennfahrer auf die Lücke zu.
Noch drei Meter. Noch zwei Meter. Paris Hilton sah auf und sagte etwas. Die Gewichtheberin schob ihren Wagen vor. Der Aufprall war unvermeidlich.
Siebzehn drehte in letzter Sekunde ab, um nicht den Kinderwagen zu rammen, dafür knallte er frontal in die schwarzhaarige Dicke, die nur kurzfristig wankte, aber dennoch schnell genug reagierte, um im Augenblick der Kollision von ihrem Obelix-Bauch Gebrauch zu machen, der den fast halb so schweren Siebzehn wie ein Fliegengewicht in die Gegenlaufrichtung katapultierte.
Chaos, Tumult, umfallende Kinderwagen, dazu setzte ein Geschrei wie tausend Frühgeburten ein und irgendwo flog ein Baby durch die Luft.
Mist, das hatte ihm gerade noch gefehlt.
Siebzehn war im Grunde ein friedfertiger Mensch. Als liberaler Rechthaber ging er Streitereien grundsätzlich aus dem Weg. Ob Neonazis, Krötenschützer oder Kämpfer für ein befreites Tibet, einen Knall hatten sie alle, sonst würden sie ihre Freizeit sinnvoller verbringen. Ganz anders die Kinderwagenmütter. Frauen waren zu viel „Lindenstraße“. Zu Gabi-Zencker-mäßig. Die nahmen alles persönlich. Hinzu kam, dass gewordene Mütter sich ihrer sexuellen Attraktivität beraubt fühlten, was sie in einen Zustand permanenter Gereiztheit versetzte. Das griechische Wort „hysteria“ bedeutete nicht umonst „Gebärmutter“. Freud hatte das rechtzeitig erkannt, aber nichts dagegen unternommen und den Männern dummes Zeugs eingeredet. Als ob man beim Anblick von diesen Gabi Zenckers Lust auf einen Ödipus-Komplex kriegen würde.
„Du Arschloch, kannst du nicht aufpassen?“, kreischte die Obelixfrau, wohl die Anführerin des Haufens. „Wir sind MÜTTER und KIIIIINDER!“
„Schwein“, zischelte eine andere.
„Also so was.“
„Hat der keine Augen im Kopf?“
„Was für ein Drecksgammeler, wie der schon aussieht.“
Es prasselten noch andere Höflichkeiten auf Siebzehn herab, die er geduldig über sich ergehen ließ, während ihm der Chor der traumatisierten Krähzwerge wie abgebrochene Kreide in den Ohren schrillte. Luistrenker wäre wahnsinnig geworden. Die Stimmung kippte derweil ins Inquisitorische.
„Männersau.“
„Penner.“
„Asoziales Arschloch!“
„Der stinkt ja!“
„Guck dir mal die Jacke an, igitt!“
Das reichte. Auf seine Dakota-Jacke ließ Siebzehn nichts kommen. Sie mochte verfranselt und abgewetzt sein, an einigen Stellen war sogar das Leder durchgerieben und die Füllung hing raus, aber das änderte nichts daran, dass es sich um eine Original-Dakota-Jacke mit Büffelschädel und blutenden Augen handelte. Die wurden nur einmal hergestellt, damals in den Neunzigern, noch nicht einmal in Dakota, sondern in einer kleinen Schneiderei aus New Orleans, lange bevor Katrina kam. Dakota-Jacken waren Kult. Es gab kaum noch welche, selbst im Internet wurden sie zu Höchstpreisen gehandelt. Man musste nur höllisch aufpassen, dass man nicht an Fälschungen geriet. Die gab es haufenweise. Sie waren gewöhnlich leicht zu erkennen: Wenn der erste Blutstropfen unter dem rechten Auge nicht die Form von Kuba hatte, konnte man davon ausgehen, dass der Etikettenbetrüger sein Mittagessen mit Stäbchen aß.
Siebzehns Dakota-Jacke war echt. Mit Kuba am rechten Fleck! Und niemand, NIEMAND machte sich über sie lustig! Schon gar nicht diese Wachtelweiber mit ihren kreischenden Scheißkindern!
Mit einem tiefen Bud-Spencer-Knurren, das durchaus als Warnung zu verstehen war, erhob er sich zu seiner vollen Größe von 1,93 Meter. Ohne übereilte Hast, fast wie in Zeitlupe. Die Furien wichen ehrfüchtig einen Schritt zurück. Als er stand, tat er so, als müsste er sich Staub oder giftige Babypampe von den Schultern seiner Dakota-Jacke schlagen. Aus den Augenwinkeln registrierte er, dass das fliegende Kind auf der Auslage eines Gemüsestands zwischen Erbsen und Chicoree gelandet war und von der umsorgenden Mutter so hektisch in die Höhe gerissen wurde, das es mit dem Kopf gegen eine Schrifttafel knallte, die in graziler Schönschrift von den Sonderangeboten des Tages kündete. Die Tafel krachte zu Boden, das Kind fing an zu schreien, der Ökobauer kam angewetzt.
Siebzehn zückte seine Polizeimarke: „Wer hat hier Penner gesagt?“, fragte er mit einer Stimme, die wie Keilschrift in 3D die Luft durchstanzte. „Das ist Beamtenbeleidigung.“ Er sprach in seinen Ärmel. „Hier ist Siebenacht, wir haben einen Larry. Ich wiederhole, einen gottverdammten Larry. Die Weiber haben das versaut. Alle festnehmen.“
Die Kinderwagenmütter erstarrten. In der Luft lag der Geruch nach Meerrettich und geplatzter Fruchtblase.
Siebzehn ließ von seinem Ärmel ab, sein Befehlston blieb verärgert. „Das kann teuer werden, meine Damen. Sie haben einem Drogendealer zur Flucht verholfen. Ich war dicht dran an dem Saukerl. Wegen Ihnen ist er mir durch die Lappen gegangen. Herzlich Dank nochmal!“
Bei der Erwähnung des Wortes „Drogendealer“ ging ein entsetztes Raunen durch die Kinderwagenkolonie. Der Ökobauer, der fragen wollte, wer ihm den Schaden an seinem Gemüsestand ersetzen sollte, zog sich zurück. Mit Bullen wollte er so wenig zu tun haben wie mit Bio.
Paris Hilton Nasenspitze wurde weiß: „Das... das haben wir nicht gewollt“, flötete sie entsetzt. „Wirklich nicht. Tut uns schrecklich leid, Herr Kommissar.“
„Hauptkommissar“, korrigierte Siebzehn, sein kantiges Kinn in Position schiebend. „Und das mit dem Penner will ich mal überhört haben“, grollte er, während er sich blassgrünen Aleteschleim von der Schulter flitschte. „Sonst ist bald ganz schnell das Betreuungsgeld futsch.“
Die Gabi Zenckers verstummten schockiert, als würde der Verlust ihrer Goetz-Kundenkarten auf dem Spiel stehen. Nur die Obelix-Frau blieb misstrauisch: „Das haben Sie doch nicht zu bestimmen“, sagte sie mit in den Hüften gestemmten Oberschenkelarmen. „Soll ich Ihnen was sagen? Sie sind überhaupt kein Polizist. Und Sie reden auch nur mit Ihrem Ärmel, aber da ist gar keiner drin. Ich glaube, ich rufe jetzt die Polizei.“
„Nur zu“, ermunterte Siebzehn die Dicke. „Wenn die Kollegen kommen, wird es allerdings offiziell. Das heißt für alle eine Nacht im Hotel zur gesiebten Aussicht. Viel Vergnügen.“ Er ratterte die Sätze roboterhaft herunter, als wäre es ihm völlig egal, in welchem Knast die Mehrfachmuttis in der nächsten Nacht versauerten.
Das saß. Paris Hilton drängelte sich vor und schob die Obelixfrau zur Seite. „Bitte, Herr Hauptkommissar“, flüsterte sie beschwörend und teuer odorierend. „Sie meint das nicht so. Können wir das nicht gütlich regeln?“ Sie überraschte ihn mit einem Zaubertrick. Wie aus dem Nichts hielt sie einen 200-Euro-Schein in der Hand. „Das alles ist ein schreckliches Missverständniss. Wir können die Sache doch sicher anders aus der Welt schaffen – oder, Herr Hauptkommissar?“
Siebzehn war eigentlich unbestechlich. Obwohl, diese Augen, dieser Mund, die waren fast mehr wert als 200 Euro. Ganz kurz überlegte er, wie es wohl wäre sie zu küssen. Eine schwachsinnige Idee. Aber sie erinnerte ihn etwas an... an... ach, den Namen hatte vergessen. Außerdem musste er einkalkulieren, dass der Gemüsestandtyp die Bullen rief, und bei denen würde er mit einer Polizeimarke aus der „Dirty Harry“-Special-DVD-Kollektion garantiert kaum Eindruck schinden.
Siebzehn griff zu. Die Menschen sollten sich schließlich auf ihre Polizei verlassen können. „Alles klar, Siebenacht, hat sich erledigt“, sagte er in seinen Ärmel. Mit der anderen Hand ließ er den gelben Merkeldollar in seiner Jacke verschwinden. A. hieß sie, jetzt fiel es ihm wieder ein. A. Und wenn schon. Das waren Erinnerungen, die es nicht mehr gab.
„Okay, meine Damen.“ Er rückte von der Blonden ab, denn er kam sich vor wie in einem Parfum-Tornado. „Dann will ich es ausnahmsweise einer Verwarnung bewenden lassen“, sagte er mit gebieterischer Stimme. „Ich muss sie trotzdem auffordern, den Platz zu räumen. Es gehen Ermittlungen vor sich. Wenn ich Sie also freundlich bitten dürfte...“
Er durfte. Zum Abschied legte er eine Hand an die nicht vorhandene Schirmmütze und hinterließ eine Paris Hilton, die ihren Freundinnen noch tagelang von diesem merkwürdigen Polizisten mit der Rastafrisur und der speckigen Lederjacke erzählte. Der Mütterknoten löste sich auf und rackelte schwatzend und gestikulierend Richtung Douglas-Stänkerei, wo es weniger Drogensüchtige gab. Nur Madame Obelix warf Siebzehn einen verdrießlichen Blick zu, den der Hauptkommissar mit einer Kusshand quittierte. Höflichkeit im Dienst zahlt sich aus, alte Beamtenregel.
Um einen unverhofften Geldregen von 200 Euro reicher, setzte Hauptkommissar Siebzehn seinen Weg zu Jimmy’s fort. Jimmy’s – eigentlich ein blöder Name für einen italienischen Schnellimbiss, zumal keiner in der Familie von Big G ein einziges Wort Englisch sprach. Aber Grazziano war der Meinung, ein internationaler Name wäre besser fürs Geschäft, weil die Deutschen den Italienern den Duce und Ballotelli übel nahmen, und der Umsatz gab ihm Recht. Jimmy’s war eine Goldgrube. Auch an diesem Tag brummte der Laden, fast alle Hocker waren besetzt, aber Siebzehn erspähte einen freien Platz in der Südkurve, neben zwei älteren Damen, die eben im Begriff waren, zu zahlen. Den enterte er und griff sich die Speisekarte, die er zwar auswendig kannte, aber zur Feier des Tages wollte er heute etwas Ausgefallenes bestellen, schließlich konnte er sich ein gastronomisches Upgrade mit den 200 Kujambels locker leisten.
Grazziano begrüßte den Stammgast mit überschwenglicher Geste, so wie Italiener das in Coppola-Filmen tun oder Makler, wenn sie ganz exklusive Dachgeschosswohnungen mit Blick auf die Punks vom Spritzenplatz anboten. „Dottore!“ Eine fleischige Pranke umschlang Siebzehns Hand und ließ für quälende Sekunden nicht los. „Lange nicht gesehen. Was kann ich für dich tun?“
„Ein Frühstücksbier wär schon mal nicht schlecht.“ Unauffällig forschte sein Blick nach Letitia. Hatte sie etwa einen freien Tag? „Essen überleg‘ ich mir noch. Kannst du was empfehlen?“
„Alles ist gut bei mir. Weißt du doch. Bestes Pizza von Hamburg.“
„Nee, auf Pizza steh ich heute nicht so. Aber sag mal, wo ist eigentlich Letitia?“
„Macht sich schön für dich.“ Der kleine, dicke Italiener lächelte unergründlich. „Will sie aber nicht, dass ich sage. Hat dich kommen sehen, und zack weg.“
Siebzehn war sich nicht ganz sicher, ob Grazziano damit ausdrücken wollte, dass es besser wäre, die Finger von seiner Tochter zu lassen oder ob er nur einen Scherz unter Männern machte (Männer, die fast gleichaltrig waren und mehr als zwanzig Jahre älter als Letitia, Sportsfreunde eben). Daher ließ er es mit einem ironischen Nicken bewenden: „Hat eben einen guten Geschmack, deine Tochter“, sagte er, ohne einer Lüge zu nahe zu kommen. „Ganz der Vater.“
„Liegt in Familie, bleibt in Familie. So soll sein.“ Der kleine, dicke Italiener lachte gutmütig. „Hab übrigens Tipp für dich. Falls du Interesse hast.“ Die letzten Worte sagte er mit vertrauensvoll gesenkter Stimme.
„Immer“, sagte Siebzehn, der eine Renditeoptimierung aus berufenem Mund niemals ausschlug. „Um was geht’s?“
„Nachher. Wenn leerer ist“, raunte Grazziano. „Ist gutes Geschäft. Viel Gewinn.“
„Klingt gut,“ sagte Siebzehn. „Merk uns vor.“
Als hätte Grazziano nichts anderes erwartet, wischte er sich geschäftig die wurstigen Finger an der Schürze ab und gab Siebzehn eine High-Five. „Bene“, sagte er und grinste wie der offene Schlitz eines Portemonnaies. „Sehn uns, mi Amigo.“
Mit diesen Worten flutschte trotz seiner Leibesfülle wie eine Billardkugel weg, um seiner Frau und Nichtennichten beim Bedienen der zahlreichen Gäste zu helfen. Dabei brauchte ihn zwar niemand, aber als Grüßonkel richtete er keinen Schaden an und erfreute die Stammgäste mit seinen Coppola-Honneurs.
Siebzehn war kein Menschenfeind, jedenfalls meistens, aber Grazziano hatte er vom ersten Moment ins Herz geschlossen. Wahrscheinlich weil sie ähnlich herrschaftsfrei tickten und an ein Modell des reinen Marktes glaubten. Den sie zugebenermaßen unterschiedlich auslegten. Siebzehn handelte im weitesten Sinn mit Gebrauchwaren, Grazziano mit – Beihilfe und Empfehlungen. Insofern ergänzten sich beide ideal.
Hinzu kam die dumme Sache mit der Axt. Hätte übel ausgehen können, aber Big G vermittelte dem Richter glaubhaft, dass Siebzehn ein „grundsätzlich friedfertiges Wesen“ sei und niemals grundlos auf wildfremde Menschen losgehen würde. Obwohl der Mercedes-Lutscher angeblich Todesängste ausstand und ein Gutachter etwas von Schockzuständen und chronischer Schlaflosigkeit faselte. Big G kannte einen anderen Gutachter. Freispruch. Geht nichts über gute Connections.
Wie lange war das her? Drei Jahre. Die Bild-Zeitung machte daraus eine große Geschichte: „Die Axt von Altona.“ In fetten Zehnzentimeter-Buchstaben auf der ersten Seite, daneben ein unverpixeltes Bild von Siebzehn, das ihn mit geschulterter Axt beim Verlassen des Gerichtsgebäudes zeigte. „Schlappe Hamburger Justiz: So etwas läuft in Hamburg frei herum“, brüllte es aus der Textzeile unter dem Foto. Und dazu die bange Frage: „Wann schlägt er wieder zu?“
Nun, das dauerte nicht lange, das passierte gleich am nächsten Morgen vor dem Kaffeeautomat der Lokalredaktion. Siebzehns Gegendarstellung dauerte eine zehn Sekunden. Der karrieregeile Jungschreibler hatte entweder nicht gewusst, dass die Axt von Altona einen Hausausweis besitzt oder die anderen hatten ihn absichtlich nicht gewarnt, jedenfalls ging sein Nasenknorpel auf Wanderschaft und einige seiner Schneidezähne sorgten für eine bessere Belüftung des Gehirns.
Das war seine letzte Amtshandlung im Hause Springer. Seitdem verlief Siebzehns Leben in geordneten Bahnen. Größtenteils.
Die Axt lag übrigens bis heute unter dem Fahrersitz von Siebzehns schrottreifer Karre. Weil die Motorhaube klemmte und nur unter Gewaltanwendung zuging.
„Na Cowboy, lange nicht mehr gesehen.“
Siebzehn schreckte auf. In Gedanken versunken, hatte er gar nicht mitbekommen, wie Letita aufgetaucht war. Siebzehn war sofort hellwach. Alle anderen Männer am Hufeisen-Rund auch, denn ihr bauchfreies Top und ihr geradezu alpines Dekollete hätten selbst den abgebrühesten Mormonen zur Monogamie bekehrt
Ihre Augen strahlten ihn an wie zwei glühende Lichtfinger, denen man besser nicht zu nahe kam, es sei denn man wollte schwerste Verbrennungen riskieren.
„Lass mich raten: Spaghetti Bolo mit Käse?“
Schnell umschaltend, stellte er sich Letitia mit Kinderwagen vor. Das half ein wenig. „Äh.. nein. Heute nehme ich...“ Fast ohne ins Schwitzen zu kommen, ließ er den Blick über die Schiefertafel hinter Letitia schweifen, auf der die Menüs des Tages angeboten wurden. Im obersten Preissegment wurde er fündig. „...Heute nehme ich die Grazzianoplatte Terra-Mare. Mit extra viel Lachs, wenn’s geht.“
Letitia sah erstaunt auf: „Uh! Hast du im Lotto gewonnen?“
„So ähnlich. Und ein Bier.“
„Terra-Mare und ein Bier. Schon in Arbeit.“ Sie tippte die die Bestellung ein und beugte sich dabei so weit vor, dass Siebzehn nicht umhin kam, eine andere Sitzhaltung einzunehmen. „Sonst noch was?“, stahlte sie ihn an, ihre Haltung beibehaltend, aber zu ihm aufsehend.
„Nein“, krächzte Siebzehn, weiter auf seinem Hocker fuhrwerkend. „Das wäre, äh...alles für den Moment.“
„Prima. Willst du so lang was lesen?“
Bevor er antworten konnte, hatte sie ihm schon die Mopo hingeflatscht. Wenn das kein Service war.
Letitia hüpfte davon. Siebzehns Blutdruck regulierte sich. Verächtlich beobachtete er die Business-Männer, die sich hinter ihren Laptops verschanzten, aber heimlich auf Letitias Arsch schielten. Wo sollten sie auch sonst hingucken? Konnte er ihnen nicht mal verdenken. Was für ein verruchtes Luder. Sie machte sich über ihn lustig, das war ihm schon klar. Aber nicht mit ihm. Um
sich abzulenken, vertiefte er sich in die Zeitung. Was nicht so einfach war, denn für die Mopo brauchte man normalerweise nicht mehr als drei S-Bahnstationen. Wenigstens war die Schlagzeile ansprechend: „Hamburger Schüler immer besoffener.“ Eine Studie hatte ergeben, das 70 Prozent aller Hamburger Hauptschüler betrunken von der Schule nach Hause kamen. Das wunderte Siebzehn gar nicht. Er fragte sich, was die anderen 30 Prozent mit ihrer Zeit anfingen.
Auf den Seiten 2 und 3 beklagten Polizisten der Davidswache, dass ihre Klos verstopft waren, es folgten Artikel über Männer, die Schminkkurse belegten und und rumänische Bettler, die am Jungfernstieg den Diamantenverkauf sabotierten. Dazwischen Meldungen über einen angeblichen Bauskandal der CDU und einen Lebensmüden, der auf dem Geländer der Köhlbrandbrücke einen Kopfstand gemacht hatte. Ganz hinten das Fernsehprogramm, die Naturbrüste-Doppelseite („Achtung! Neue Girls auf drei Etagen!“), Flutkatastrophen in Asien und der Krebspromi vom Dienst („Star aus ,Verbotene Liebe‘: Ich weine jede Nacht“).
Gut, dass es diese Zeitung gab. Sonst würden noch viel mehr Leute glauben, Hamburg wäre eine Stadt von Welt.
Er legte das Blatt beiseite und sah sich um. Trotz Urlaubszeit und kochenden Mittelmeertemperaturen herrschte im Mercado reger Publikumsverkehr. Ältere Frauen schleiften ihre trödelnden Männer hinter sich her wie unangeleinte Pudel. Gesichtsverkleisterte H&M-Gören belagerten als Germany’s Next Top Modells in Wartestellung den Sushi-Stand gegenüber und drückten in ihren Händen herum, ohne ein Wort miteinander zu reden. Einkaufswütige Gesichter panzerten durch das Gedränge, als wäre Nachkriegszeit und Merkel gleichzeitig. Dazwischen ein paar Blaue, die seit kurzem das Stadtbild versauten, weil in Hamburg irgendein Christustag war. Siebzehn hatte davon nichts mitbekommen, aber angeblich waren die Nachrichten voll davon. Es hieß sogar, der Papst würde kommen. Neuerdings trieb sich in der Stadt wirklich übles Gesindel rum.
„Auf dein Wohl, Cowboy.“ Letitia stellte eine sauber gezapfte Bierknolle vor ihm ab. „Geht aus besonderem Anlass aufs Haus.“
„Danke.“ Siebzehn hob überrascht eine Augenbraue. „Und was ist der besondere Anlass, wenn ich fragen darf?“
„Ich gehe zurück nach Italia“, sagte sie vergnügt. „Oma hat Mann für mich gefunden.“
Siebzehns gute Laune verflog schneller, als er seine Kinnmuskulatur unter Kontrolle hatte. „Wie bitte?“ Er starrte Letitia ungläubig an: „Du willst heiraten?“
„Ja.“
„Aber wen denn?“
„Weiß ich nicht. Hat Oma ausgesucht.“ Sie kicherte wie ein übermütiges kleines Mädchen, das vor dem ersten Tanzball ihr Kleid ausprobiert. „Ist bei uns so Sitte, weißt du?“
Siebzehn fehlten die Worte. „Aber – das geht doch nicht...“, stammelte er völlig entgeistert, obwohl er sich natürlich nicht anmerken lassen wollte, wie entsetzt, nein nicht entsetzt, wie persönlich beleidigt er war.
„Wieso soll das nicht gehen?“ Sie versetzte ihm einen Stubs auf die erbleichte Nasenspitze. „Oma weiß, was für mich am besten ist. Freust du dich mit mir?“ Sie wartete seine Antwort nicht ab. „Du kannst mein Trauzeuge sein, wie wäre das?“ Letitia klatschte in die Hände, als wäre ihr diese tolle Idee erst eben gekommen. „Papa würde sich so freuen! Mein Mann bestimmt auch.“
Siebzehn wischte sich eien Strähne aus der Stirn. „Werd sehen, was sich machen lässt“, sagte er ganz cool. Der Tag war gelaufen, so oder so. „Kannst mir ja ‘ne Einladung schicken. Bin die nächsten Wochen nur leicht ausgebucht.“
„Schön!“, begeisterte sich Letitia, als hätte sie gar nicht zugehört. „Aber dann darfst du nicht diese verweste Cowboy-Jacke tragen. Ich will dich im weißen Anzug sehen. Mit einer Rose im Knopfloch.“
Siebzehn sah auf sein Glas hinunter, als hätte er das Bier ganz vergessen. „Mhm,“ brummte er und in seinem Magen wühlte etwas, das sich wie etwas sehr Kratzendes, Entzündetes anfühlte. „Wünsch dir nur das Beste“, sagte er beherrscht, aber freundlich, und er wollte gerade noch etwas hinzufügen, aber so weit kam er nicht, denn von hinten schlingerte Big G mit einer Riesenplatte Terra Mare (mit extra viel Lachs) heran, die er mit dem Stolz eines fünfsternigen Marlon Brando kredenzte. Letitia entschwand und schnalzte mit der Zunge. Warum auch immer.
„Alles okay?“, fragte Grazziano.
„Alles okay“, sagte Siebzehn.
Nichts war okay.
Als er die Zangen des Hummers aufbrach, dachte er an die Spiele mit den Handschellen. Der gestürzt Reis hatte genau ihre Körbchengröße. Die Kruste des Hühnchenschenkels mit der pechschwarzen Olive in der Mitte... kaum auszudenken. Und jetzt rannte sie einfach weg, wegen so einem Ölberlusconi, den ihre verkalkte Oma aussuchte? Wie bescheuert war das denn? Zwangsheirat. Voll das Mittelalter. Dass Big G so etwas zuließ. Italiener halt. Die Araber Europas. Taten kosmopolitisch und sonstwas, schawenzelten aber hinter jedem nächstbesten Kreuz her. Die einen waren vom Islam versaut, die anderen vom Vatikan. Nee, Siebzehn hatte fertig. Die Olive flippte er mit der Gabel weg. Am liebsten wäre er nach Italia gefahren und hätte dieser alten Inzest-Schrapnelle den Hals um...
„Die allerbesten Grüße im kostbaren Namen von Jesus. Der Herr der Liebe ist mit Ihnen.“
Siebzehn lächelte engmaschig. Millimeterdünn öffnete sich ein roter Riss.
„Darf ich Ihnen diese frohe Botschaft überbringen? Es ist ein Wort des Friedens und der Wahrheit.“
Vor Siebzehn stand ein etwa vierzehnjähriger Blaujüngling mit kinderpopoglatter Gesichtshaut, weit aufgerissenen Mein-Herz-ist-rein-Augen und Kühlergrill vor den Zähnen. Mit so einem würde man nicht mal Kinderpornografie hinkriegen. Der Kleine drückte Siebzehn eine Hochglanzbroschüre in die Hand, die die naive Zeichnung eines „Herr der Ringe“-Saruman im Schlafanzug zeigte, der auf einem Berghügel stand und bekifft zum Himmel aufblickte. Darüber in Indiana-Jones-bunten Buchstaben die Überschrift: „Gott ist das Liebeslicht des Universums.“
„Und was soll ich damit?“, knurrte Siebzehn, der nicht gern beim Essen gestört wurde. Schon gar nicht von so einer Katholikenfluse. „Ich nehme keine Werbung“, beschied er der Zahnspange kurz angebunden.
„Das ist keine Werbung“, lächelte der Blaujüngling das vermeintliche Missverständnis beiseite. „Es ist das Evangelium unseres Herrn: Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist die Quelle des Glücks, die in jedem Menschen verborgen ist. Danach sollten wir streben. Einander lieben. Einander helfen. Einander vertrauen. Dann wird uns das Himmelreich sein.“
Siebzehn spürte deutlich, dass es ihm nach etwas ganz anderem strebte. Nur war der dressierte Klosterbello leider noch ein halbes Kind. Der rote Riss wurde trotzdem größer. „Von mir aus kannst du lieben, wenn du willst, aber nicht mich,“ schlug er einen unmissverständlicheren Tonfall an. „Und jetzt schieb ab und geh woanders beten.“ Damit war wohl alles gesagt. Dachte er.
Den Saruman-Prospekt warf er hinter sich.
Nur hatte er die Hartnäckigkeit des Kühlergrill-Missionars unterschätzt. „Sie sollten tief bereuen“, sagte der Bläuling und diesmal schob sich ein Tonfall wirklich enttäuschter Dinglichkeit in seine Kindergartenstimme. „Es gibt keine Freiheit ohne Gott. Nicht in diesem Leben und in keinem anderen.“ Er hob den weggeworfenen Flyer auf und säuberte ihn sorgfältig mit den Händen. „Wer wie ein Blinder tappt im Dunkeln, wird auf seinem Weg kein Glück finden. Und er wird Gewalt und Unrecht leiden müssen ein Leben lang.“
Konnte das wahr sein? Jetzt drohte ihm der Knülch auch noch. Was für eine gottverdammte Gehirnwäsche hatten sie diesem Bengel bloß verpasst?
Siebzehn versuchte es ein letztes Mal im Guten: „Hör zu, du Äffchen“, sagte er musterte den Jesusjunior mit dem Ausdruck kühler Verachtung. „Du störst mich beim Essen. Du laberst mich voll. Deine Sekte ist ein Haufen gequirlter Scheiße.“ Um seinen Worten den nötigen Überzeugungsgehalt zu verleihen, tippte er bei jedem dieser Sätze fest und immer fester auf das spindeldürre Jochbein des Zwergkatholiken, der seltsamerweise sein zinsloses Lächeln nicht einstellte (als wäre er illuminiert vom himmlischen Liebeslicht). „Wenn du klug bist, ziehst du daraus die nötigen Schlüsse, sonst erlebst du das nächste Halloween nicht mehr. Cappice?“
Der Junge betrachtete Siebzehn mit einem eindrucksvollen Stirnrunzeln, wirkte aber weder verängstigt, noch schockiert. Im Gegenteil, es sah eher so aus, als hätte er in Siebzehn Finstermiene etwas entdeckt, das ihm vorher nicht aufgefallen war, aus welchen Gründen auch immer.
„Sie sind ein guter Mensch, Sie wissen es bloß noch nicht“, sagte als hätte eine obskure Energie von ihm Besitz ergriffen. „Der Herr ist mit Ihnen. Ja, jetzt sehe ich es, der Herr ist mit Ihnen.“
Spätestens da platzte der rote Riss endgültig, da hätte auch keine fromme Musik mehr geholfen. „GEH MIR MIT DEINEM KACKJESUS WEG UND SCHER DICH ZUM TEUFEL, DU FICKFEHLER!“, röhrte Siebzehn so laut, dass in der nahe Douglas-Parfümerie fast die Pröbchen umfielen. „DEIN HERR KANN MIR DEN BUCKER RUNTERRUTSCHEN, UND DU GLEICH MIT. UND JETZT SUBTRAHIER DICH, SONST WANDELT GLEICH JEMAND GANZ ANDERES IN EWIGER DUNKELHEIT! JEHOVA!“
Das musste mal gesagt werden, an so einem – Letitia-Tag. Warum Siebzehn „Jehova“ brüllte, wusste er übrigens selbst nicht so genau, das kannte er aus einem alten Monty-Phyton-Film.
„JEHOVA! JEHOVA!“
Verrückt, was? Das dachte wohl auch Big G, der seinen Wettpartner noch nie so wütend erlebt hatte, selbst wenn irgendwo in Südamerika in letzter Minute ein nicht abgesprochenes Tor gefallen war. Der Italiener beruhigte
Doch so schnell wie Siebzehn an die Decke gegangen war, so schnell beruhigte er sich auch wieder. Während sich der Bläuling respektvoll verzog, musterten die ie Umstehenden den zotteligen Rasta mit skeptischer Distanz, denn was hatte der kleine Junge dem alten Mann denn getan, aber einer Rentner mit Hut meinte, es sei wirklich eine Unverschämtheit, dass die rumänischen Bettler jetzt schon ihre Kinder vorschickten, obwohl der Kleine ja wirklich sehr süß ausgesehen habe. Worauf eine mittelalte Brünette im beigen Bürokostüm über ihrer Pizza Hawaii einwarf, dass sei kein Rumäne gewesen, sondern ein anständiger deutscher Christ vom Kirchentag, an dem sich alle ein Beispiel nehmen sollte. Ob der Kirchentag denn ein Feiertag sei, wollte darauf einer aus der Laptop-Fraktion wissen. Was die Brünette mit einem vernichtenden Blick zu Siebzehn ignorierte, als wolle sie sagen: Da können Sie sehen, was Sie angerichtet haben, Sie Schnösel.
Siebzehn kümmerte sich nicht um das Gequatsche und vertilgte die Reste seines Terra-Mare-Tellers. Damit die Fische etwas zum schwimmen bekamen, bestellte er zum Nachspülen einen doppelten Grappa, den Big G weit über dem Eichstrich einschenkte. „Besser trinken“, lautet der Tipp des Italieners, der sich geradezu rührend um Siebzehn kümmerte, fast wie ein Schwiegervater.
Eine halbe Stunde und zwei Stonsdorfer später hatten sich die Reihen der Gäste gelichtet. Die Spülmaschine rotierte, der Pizzakoch säuberte die Bleche, es kehrte Siesta ein im kleinen italienischen Familienbetrieb. Letitia raffte eilig ihre Handtasche, angeblich ein Termin beim Friseur. Zum Abschied schickte sie ihm einen Handkuss, den er an sich vorbeifliegen ließ.
Gar nicht drüber nachdenken, nahm sich Siebzehn vor. Vorbei, vergessen, erledigt. Sollte die blöde Ganz doch glücklich werden mit ihrem Froschprinz, den Oma für sie ausgelost hatte. Bestimmt sah er todschick aus, hatte Syphillis im Endstadium und erbte einmal den ganzen Hühnerhof. Wenn das keine Perspektiven waren. Und was hatte sie eigentlich gegen seine Jacke? Wie würde die aussehen? Verwest? Hatte sie wirklich verwest gesagt? Wie borniert war das denn? Aber selbst im Bitchfummel rumrennen, na danke. Nein, er regte sich nicht auf. Er hatte die Dinge im Griff. Wie immer.
Nach dem dritten Stonsdorfer.
Grazziano setzte sich neben ihn und schlug Siebzehn aufmunternd auf die Schulter: „Du nicht ärgern wegen Christenkind. Sind alle wusch im Kopf. Habe viel Besseres. Gibt Geld aus dem Himmel. Viele Geld sogar.“
Einen ganz kurzen Moment überlegte Siebzehn, ob er Big G fragen sollte, was ihm dabei einfiel, seine Tochter in die Hände eines italienischen Geflügelgrappschers mit Schuppenflechten am Rohr zu geben, aber diese Blöße wollte er sich dann doch nicht geben. Außerdem mischte er Privates nie mit Geschäftlichem: „Viele Geld hört sich gut an“, sagte er. „Wie viele ganz genau?“
Der stämmige Italiener lächelte vieldeutig. „Genug. Willst du erst einen Schnaps?“
Die Frage hätte er nicht zu stellen brauchen.
Der Einfachheit halber goß Big G gleich zwei an und stieß mit Siebzehn auf das Geld aus dem Himmel an, wie man in Italien überraschende Kontobewegungen nannte. „Aber du weißt wie immer nicht von mir.“
„Iwo“, sagte Siebzehn und rückte noch etwas dichter an Grazziano. „Manche Dinge fallen einfach aus dem Himmel, weil der liebe Gott es so will.“
Grazziano bekreuzigte sich: „Si“, stimmte er begeistert zu. „Fallen aus Himmel. Wie Zufall. Kann Bombe sein, kann Fortuna sein.“
Grazziano war wie fast alle Italiener ein Fußballdoktor, der leidenschaftlich gern wettete. Und Bomben und Fortuna konnte er gut unterscheiden.
„Also?“, fragte Siebzehn.
„Udine“, sagte Big G. mit gesenkter Stimme, obwohl sich niemand in Hörweite befand. „Undine gegen Lazio Rom. Tipp auf 1 mit zwei Toren Abstand. Ist hundertprozentig.“
Siebzehn runzelte die Stirn. „Wieso spielt Udine gegen Lazio? Die Meisterschaft ist doch längst vorbei?“
„Ist irgendein neuer Cup. Hat sich Uefa-Mafia ausgedacht zum Geldmachen. Coppa Mediterraneo. Völlig diffuso.“
„Und da gewinnt der Absteiger gegen den Tabellendritten?“, meldete Siebzehn zaghafte Zweifel an.
„Si. Italienisch Wunder. Kommt vor.“
„Klingt nach einem ziemlich unwahrscheinlichen Wunder.“
Grazziano rollte lustvoll mit den Augen. „Deswegen ist ja molto prima. Zwischen Spielzeiten alles kann passieren. Die eine Mannschaft müde, die andere stronzo. Dann kommt plötzlich Ergebnis viel komisch.“
Siebzehn begriff. Er liebte den italienischen Fußball. Er war so flexibel und selbst für Experten extrem schwer ausrechenbar.
„Hm. Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen“, nickte Siebzehn. „Wie stehen die Quoten?“
„14:1“
„Hui.“
„Sag ich doch. Ist Sechser im Lotto. Zwei Tore Abstand gibt Doppelgewinn. Wir teilen.“
Siebzehn überschlug in Gedanken, was bei dem Tipp für ihn herausspringen könnte. Seine Augen begannen zu leuchten. Als es sechsstellig wurde, hörte er auf zu zählen. „Und der Tipp ist sicher?“
„Eher schlägt Meteorit in Petersdom ein, wenn nicht sicher“, sagte Big G, als hätte er die statistische Wahrscheinlichkeit persönlich ausgerechnet. „Aber machen wie immer. Bananentipps dazwischen. Das nicht auffällt.“ Bananentipps waren solche, die auch ein betrunkener Schimpanse im Mondlicht hätte ankreuzen können, oder eine Hausfrau beim Bügeln. Hinter denen ein Einser-Zufallsteffer wie der von Udine Calzio nicht größer auffiel. „Noch Fragen?“
„Nein. Das heißt...“ Siebzehn zögerte. „Wieviel setzen wir?“
„5000 jeder. Hast du so viel? Sonst ich dir leihe.“
Siebzehn pfiff durch die Zähne. „Okay.“ In Gedanken malte er weitere Nullen hinter die 5. „Gibt mein Budget gerade noch her. So gesehen, war ich schon immer ein Fan von Undine Calzio.“
„Wem sagst du“, frohlockte Big G, aber als sein Blick über Siebzehns Schulter glitt, fror sein Gesichtsausdruck ein, als wäre Bert, das Brot im Anmarsch: „Ach herrje, da kommt Wim Tölpel.“
„Wer?“
Ein untersetzter Mann mit gezwirbelter Sturmfrisur, nördlichem Haaransatz und bebrilltem Rechenschiebergesicht kurvte um die Ecke des Sushi-Stands und schnaufte wie eine Dampfmaschine. In seinen Händen trug der bubenhafte Endfünfziger einen staniolverpackten Präsentkorb, der allerlei Leckereien, Alkoholika und in Geschenkpapier verpackten Krimskrams enthielt. Er kam mit einem Stock. Wahrscheinlich die Hüfte. Bedauernswert. Siebzehn erkannte Wim Tölpel sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Er hofft nur inständig, dass sich der Großdenker nicht neben ihn setzen würde.
Tat er aber doch. Einer wie Wim Tölpel brauchte Publikum, erst recht seit er als hyperventilierender Kreischkatholik keine Einladungen von den Talk Shows mehr bekam. Er knallte den Präsentkorb auf den Tresen und annektierte den einzig freien Hocker zwischen Big G und Siebzehn, als wäre er für ihn reserviert. Seine verbeulte Stoffhose war mindestens drei Nummern zu groß, unter den Ärmeln seines zerknitterten Hemdes zeichneten sich afrikagroße Schwitzflecke ab.
„Meine Frau hat Geburtstag“, lärmte er ungefragt los und richtete seine eidotterfarbene Krawatte, als würde er hinter Grazzianos Pizzaofen versteckte Kameras vermuten. „Also vielmehr meine Ex-Frau. 50 wird sie. Hat mich eine Stange Geld gekostet. Aber ich bin ja nicht nachtragend. Ist gut für the Soul. That’s Magic. Sonst heult sie wieder den ganzen Tag.“
Siebzehn zuckte unbeteiligt mit den Schultern und rückte ein Stück beiseite. Das half aber nichts. Rudi Augstein, wir haben ein Problem.
„Ist alles, was die können, heulen. Vor den Richtern kommen sie damit immer durch. Weil unsere Justiz viel zu durchweibert ist. Als Mann bist du immer der Unterdrücker. Das sind mittlerweile Zustände wie in diesem Neger-Südafrika.“ Der Mann, den sie Wim Tölpel nannten (im Viertel war er auch bekannt als „Kosaken-Breivik“ oder „Gossen-Saddam“) versank in ein kurzes, tiefes Brüten, als wäre er an eine kaputte Herzrhythmusmaschine angeschlossen. „Frauen sind wie Falludscha“, möhrte es nach einer Weile aus ihm. „Man kommt rein, aber nie wieder raus. Am Ende hilft nur die syrische Lösung. Alles plattmachen. ‘Ne andere Sprache verstehen die nicht.“ Er sah Siebzehn an, als hätte er einen Verbündeten vor sich, der sich lediglich nicht zu erkennen gab.
„Scheiß-Häuserkampf“, murmelte Siebzehn, in einer Absicht, die er nicht als böswillig bezeichnet hätte. „Sollen sie doch ihren Müll selbst runtertragen.“
„Ganz genau!“ Der Super-Journalist war ganz aus dem Häuschen. „Das ist die richtige Einstellung, mein Freund. Wir haben uns viel zu lange unterdrücken lassen. Sex ist nicht alles. Sex ist nur Saft. Es gibt etwas, das viel besser ist als Sex, das ist ein guter Anwalt. Den bezahlt man auch, aber der belügt einen nicht.“
Siebzehn rutschte unauffällig ein Stück zur Seite. Abwesenheit simulierend. Big G trollte sich ebenfalls, er hatte dringend in der Küche zu tun. Feiges Stück, dachte Siebzehn.
Worauf Wim Tölpel seine Konzentration ganz auf den stoppelbärtigen Insulaner mit Rastahintergrund ausrichtete. Ein neues Opfer ließ er so schnell los. „Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?“, fragte er ohne jeden Anflug von Eitelkeit.
„Nein“, sagte Siebzehn, als hätte er die Hackfresse noch nie gesehen.
„Tun Sie nicht so. Alle kennen mich. Ich bin...“
Siebzehn wusste natürlich, wer der Angeber war. War mal ein richtig Großer gewesen. Vor langer, langer Zeit. Edelfeder, oder wie sie das nannten. Der Thomas Mann des digitalen Zeitalters. Hatte ein Buch über Väter ohne Kinder geschrieben, oder so ähnlich. Mit dieser Bild-Tussi Alice Schwarzer rumgezankt. Die ganz dicke Lippe riskiert. Biss sie ihn am Ende rausschmissen, weil er als religiöser Eiferer durch die Sender gezogen war. Nur noch peinlich. Lebte heute von Klangschalentherapien und Meinungsabfällen, die er an freie Radiosender verfütterte. Aber wenn ihn jemand auf der Strasse erkannte – was immer seltener vorkam – blies er sich noch immer auf wie ein balzender Auerhahn und machte für eine Currywurst den Thomas Mann.
„Ich hab keine schlechte Meinung von den Leuten, müssen Sie wissen. War schon immer ein Teamplayer.“ Die Stimme des hektisch blinzelnden Ex-Reporters färbte sich fast lutherisch. „Wenn einer mit einer guten Idee zu mir kommt, bin ich Berufssoldat. Aber das ist aus der Mode gekommen. Guter Journalismus ist aus der Mode gekommen. Die Wirklichkeit ist aus der Mode gekommen. Heute sind das alles nur nur noch Google-Abschreiber, die keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Alles Bewohner der Insel des Bekannten. Da gibt es weder Drama, noch Dramaturgie, noch einen guten Einstieg.“
„Ich lese eigentlich nichts“, sagte Siebzehn in der vergeblichen Hoffnung, den Vielschwafler auf Distanz zu halten. No way.
„Wissen Sie was Wirklichkeit ist? Nicht das was in den Zeitungen steht. Das ist lächerliches Surrogat der Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit wird von Meinungsforschern, Feldmausschützern und Lobbyparasiten gemacht. Die wissen nichts. Die hinterfragen nichts. Die suchen nur die passenden Brocken zusammen. Aber sie verkaufen ihren Mist als Meinungsjournalismus. Ich lach mich tot! Das darf man bloß öffentlich nicht laut äußern, sonst...“ Wim Tölpel machte die Geste eines abgeschnittenen Halses. „Wer die Moral hat, hat die Macht. Das ist wie bei Diktatoren. Nur unsere lieben Verlegerdiktatoren, die baden nicht in Blut, sondern in Dividenden. Was letztlich auf das Gleiche hinausläuft. Trinken wir einen, Kumpel?“
Siebzehn gab einen Grunzlaut von sich, der wohl nur in bestimmten Polarkreisen als freudlich oder gar einladend hätte ausgelegt werden können. Er hasste es, wenn andere Leute sich ungefragt an ihn ranwanzten. Wim Tölpel wertete die sublime Reaktion des Fremden automatisch als Zustimmung und orderte mit großer Geste zwei Bier mit Geschoss. Big G nahm die Bestellung entgegen und tat so, als hätte er den Til Schweiger der deutschen Presse noch nie gesehen. Andere Gäste zahlten fluchtartig.
„Wir leben in einer Zeit der umgekehrten Desinfomation“, leitartikelte es in höchster Phonstärke aus dem Mund des korpulenten Dauerdenkers. „Immer mehr Leute kennen immer weniger Sachen, weil es immer mehr Sachen gibt, die man kennen könnte. Das führt dazu, dass wir alle in einem großen Suppentopf der Entwertungen und Vereinfachungen leben. Adolf Hitler schreibt auf dem Mond seine Tagebücher. Na klar, wo denn sonst? Micky Maus eröffnet im Gaza-Streifen einen Osama-bin-Laden-Vergnügungspark. Wer als erstes hundert Dagoberts abschießt, bekommt einen Freiflug mit Teppichmesser-Show und Tick, Trick und Track als Terroristen. Wetten, das wäre der Renner? Kein Kafka und kein Kohl könnte sich das ausdenken. Da möchte man doch am liebsten auf allen Vieren gehen, um mit Voltaire zu sprechen.“ Die Backen des Weltskeptikers blähten sich auf wie zwei verstopfte Belüftungsschlitze. „All Rubbish! Nothing but Fuck’n’Roll!“
Die Faust von Wim Tölpel flog krachend auf die Tischplatte, so dass Big G verstört vor dem Zapfhahn zusammenschreckte. Siebzehn zeigte dem Italo mit einer geruhsamen Geste an, dass er die Sache im Griff hatte. Nur ein Depressions-Charlie mit Knick in der Rübe, nichts weiter. Solche Schlotterdicks liefen im Viertel massenhaft rum, die taten keinem was.
Der Tölpel wertete Siebzehns Handbewegung als Zustimmung. „Es gibt nur noch eine Fixgröße in diesem Durcheinander, und das ist der Glauben“, stieß er mit stiergroßen Augen aus. „Menschliche Ideologien versagen, menschliche Technik stößt an ihre Grenzen, aber es gibt nur ein Buch der Ewigkeit und des ungetrübten Wissens, und das ist die Bibel. Ohne sie wird unsere Zivilisation zerfallen wie ein morsches Holzhaus im Sturm.“
Siebzehn verdrehte die Augen. Hatte er an diesem Morgen versehentlich mit Weihwasser gegurgelt oder warum liefen ihm neuerdings diese Religionsspinner nach?
„Wie stehen sie zum Wort des Hirten, mein Freund?“ Der Biblische musterte sein struppiges Gegenüber mit kritischem Blick. „Glauben Sie an die Liebe Gottes?“
„Liebe klappt bei mir nicht so“, murmelte Siebzehn unter seinem Rasta-Vorhang. „Ist mir zu anstrengend.“
„Anstrengend? Was kann an Liebe anstrengend sein?“
„Alles davor und danach“, brummte Siebzehn. „Geht mir auf die Nerven. Vor allem das Danach.“
„Falludscha, sag ich doch. Aber diese Liebe meine ich nicht. Die ist hinfällig. Ich meine die Liebe zu Gott, unserem Erlöser.“ Wim Tölpel hob entrückt die Stimme. „Er ist überall! Er ist hier! Jetzt!“
„Bei Jimmy’s?“ Den Witz konnte sich Siebzehn einfach nicht verkneifen. Er sah sich um, als würde er nach einem altem Mann mit weißem Bart Ausschau halten. „Wo denn?“
Der katholische Spitzenfeuilletonst ignorierte den sarkastischen Unterton. „Sie können ihn nicht sehen, aber er sieht Sie. Er ist der wirkliche Big Brother. Nicht das Wenigste entgeht seinem Blick. Und er schenkt uns das einzige Abenteuer, das in dieser dysopten Welt noch möglich ist. Das Abenteuer des Glaubens an Jesus Christus.“
Siebzehn hatte am Rand mitbekommen, dass der katholische Ali Baba ein feuerspuckendes Buch über seine Tingeldangel-Religion geschrieben hatte. Was man halt so macht, wenn man über zu viel Tagesfreizeit verfügt und als Ex-Feuilleton-Kanonier im Gespräch bleiben will (wozu Wörter wie „dysopt“ sicherlich hilfreich waren).
„Die Zeiten werden religiös, mein Freund“, monologisierte der Edelfederich weiter. „Wenn die Menschen keinen Sinn mehr sehen, suchen sie den, aus dem sie gekrochen sind.“ Der Katholik zeigte ein wölfisches Lächeln, für das kein Protestant ein Sorgerecht übernommen hätte. „Religion ist ein wichtiges Identitätsmerkmal, das sich im säkulären Maskenball unserer Zeit nicht wegschminken lässt. Aber jetzt schlägt das Pendel um. Denn wir sehen nicht die Lösung und scheitern an dem Versuch, unser eigenes Paradies zu errichten. Das macht die Menschen krank. Sie leiden an Burnrout, Einsamkeit und Depressionen. Die schöne neue Welt ist ausgeblieben, und wir bleiben zurück mit unserer Schuld und Hybris. Die meisten merken aber dann doch, dass wir nicht das sind, was wir sein sollten. Sie spüren, dass ihnen etwas fehlt in ihrer DNS. Der Teil, der sie wieder leben, spüren und fühlen lässt. Deshalb fangen sie an zu suchen, selbst wenn sie dafür Prügel beziehen und an den Pranger gestellt werden. Die Christen sind die Sex Pistols von heute, mein Freund. Alle verachten sie, aber ihre Zeit wir kommen. Das nenne ich gottverdammten Fuck’n’Roll!“
Das Gesicht des katholischen Brillenfischs verkrampfte sich zu einem Ausdruck der Zufriedenheit: „Gott ist ein Kraftwerk, ohne das es den Menschen niemals geben würde. Sein Strom versiegt nie. Er wälzt den Stein. Haben Sie schon einmal einen Stein gewälzt?“
Siebzehn hörte seit der Stelle mit dem Maskenball nicht mehr zu. Für Außerirdisches war er nicht zuständig. Er kam schon in Harburg kaum zurecht. Die Frage nach den rollenden Steinen brachte ihn daher leicht aus dem Konzept.
„Offen gesagt nein“, ließ er sich nach einer Denkpause zu einer Antwort herab. „Um genau zu sein, mein Job ist es eher, Steine umzudrehen.“ Siebzehn nahm die routinierte Pose eines Kammerjägers von der Reeperbahn ein, obwohl seine Oberarme nur halb so dick waren wie der Hals eines Pferdes. „Aber im Moment bin ich privat.“ Er zückte kurz seine Superspar-Kundenkarte und betonierte seine Stimme ein. „Mein Dienst fängt erst nachts an. Immobilien, Stechomobilien, Ponderabilien, alles was ansteht. Goldman & Wesson. Da haben wir nicht viel Gott.“
„Oh, wie interessant.“ Der christliche Abenteurer war ganz von den Socken. Nein, mehr noch, er glühte vor Begeisterung, als wäre er auf den heißesten Erzengel jenseits der Lorelei gestoßen. „Das ist ja toll. Sie sind also im – Gewerbe?“ Er sprach das Wort aus, als müsste er seinen Mund danach zehn Rosenkranzwochen lang mit Sünden-Ex desinfizieren.
„So nennen wir das nicht.“ Siebzehn blickte zum ersten Mal frontal in das ziegelrot angelaufene Gesicht des Dysopten. „Wir sagen Tittenpogo dazu. Ist griffiger und international gebrandet.“
Wim Tölpel sperrte den Mund auf, als würde er in Gedanken das Wort „Tittenpogo“ mitschreiben. Big G brachte zwei Biere mit Geschoss. Siebzehn kippte den Kurzen, als ob er nahende Kopfschmerzen wegtrinken wollte. Nicht schlecht, das Donnerwasser. Auf den Heiland. Fuck’n’Roll.
„Aber ich rede nicht gern über Geschäfte“, sagte Siebzehn mit gebührend ernster Miene. „Ist bei uns gottgegeben. Wir leben von der Diskretion.“
Der Kulturjournalist hielt den Atem an, offenbar gebannt von der authentischen Streetability dieser sicher extrem gefährlichen Kiezgröße. „Und wenn Sie so einen Stein umdrehen, was – finden Sie da?“
Eine lange Pause. „Schlechte Dinge meistens. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber sie dürfen vorher beten.“
„Das ist gut.“
„Wenn sie noch am Stück sind.“
„Oh. Und dann?“
„Werfen wir sie weg. Hamburg hat einen tiefen Hafen. Wird alles ins Meer gesaugt. Schon praktisch, so ein Müllschlucker vor der eigenen Haustür.“
Wim Tölpel nickte mitfühlend. Gott mochte schlechte Dinge auch nicht. „Und wieviele... ich meine, wie viele haben Sie schon – beten lassen?“, fragte er gebannt (und in Gedanken weiter mitnotierend, so eine Geschichte war wie ein Pulitzerpreis aus dem Kaugummiautomat).
„872.“
Der Schreibler zuckte zusammen. „Was, so viel?“, fragte er sichtlich beeindruckt.
„Nicht einer mehr, nicht einer weniger. Ich führe sehr genau Buch. Muss man in meinem Job. Bürokratie ist ein Monster. Da kommen selbst wir nicht dran vorbei.“ Siebzehn schüttelte den Kopf wie ein Einzelhandelskaufmann, der die steigenden Milchpreise aus Brüssel beklagte. „Ich hasse diesen Papierkram. Macht bald keinen Spaß mehr.“
„Meine Rede“, bestätigte der Christenmann, dessen stürmische Entrüstung nicht den über 800 Morden galt. „Alles wird reglementiert, alles wird verboten. Wir leben in einer Diktatur der Entmündigung, mein Freund. Hemingway wäre in dieser Welt verrückt geworden. Jesus auch. Was sollen wir uns nicht noch alles gefallen lassen?“ Er schlug erneut mit der Faust auf den Tisch, dass die Biergläser wackelten und sein Krückstock fast umfiel. „All Rubbish! Alles Sesselfurzer, die von nichts eine Ahnung haben!“ Die letzten Worte brüllte er so laut, als würde er auf der Bühne des Thalia Theaters stehen und nur die hintersten zwei Reihen wären ausverkauft. „872 ARE MUCH TOO FEW! KILL THEM ALL!“
Siebzehn war sich bewusst, dass der Schreihhals vom Sturmgeschütz einen schweren Dachschaden hatte, den sich andere mühsam ansaufen mussten. Als er dem Ministrantenwicht jetzt aber in die Augen sah, zuckte er trotzdem zusammen. So einen irren Blick hatte er vorher nur bei Kristina Schröder oder Charles Manson gesehen.
„Lassen Sie mich bei 873 dabei sein“, züngelte der Vielschreiber Gottes und seine dunklen Augen quollen hervor, als wäre in seinem Kopf Jack Nicholson eingezogen. „Ich verspreche, ich sehe nur zu. Ich misch mich nicht ein. Wir machen etwas wie ,Kaltblütig‘ von Norman Mailer draus. Das wird ein Top-Seller. Die Leute gieren nach authentischer Gewalt. Weil sie die Normalität eines Lebens in Frieden und Wohlstand nicht mehr aushalten. Die wollen wissen, wie das ist, wenn einer wirklich stirbt.“ Er packte Siebzehn energisch am Ärmel, eine Unart, die der Berührungs-Allergiker wenig schätzte. „Natürlich ohne Namen. Alles bleibt im Anonymen. Das macht es nur realistischer. Na, wie wäre das?“
Siebzehn hatte noch nie ein Buchangebot bekommen. So gesehen, fühlte er sich geschmeichelt. Andererseits hatte er längst eine ganz andere Idee: „Und was springt für mich dabei raus?“, fragte er argwöhnisch.
„Wir machen halbe, halbe. Keiner haut den anderen über’s Ohr“, raunte der Tölpel.“ Das ist der Deal.“
„Siebzig, dreißig, dann haben wir einen Deal.“
„Sechzig, vierzig.“
Siebzehn platzierte unauffällig sein Bein auf der Fussleiste des Hockers, über den die Körpermasse des Vielgöttlers flutete. „Könnte eine Verhandlungsbasis sein“, sagte er nach einer Denkpause. „Ich muss mir das überlegen.“
Tölpel zog die Hand weg. „Was gibt es da zu überlegen?“, fragte er verdrießlich.
„Oh, eine Menge. Erst laberst du vom Big Brother im Himmel und als nächstes bist du ganz wild auf die letzte Schaufel. Da frage ich mich natürlich, wie passt das zusammen? Schon mal vom siebten Gebot gehört?“
Das wusste der Orthoxe besser: „Fünftes“, sagte er strafend.
„Dann eben fünftes. Da steht drin: Du sollst nicht töten.“
„Ach, was da drin steht“, wehrte der Vatikan-Insider ab. „Das ist kein Widerspruch. Gott hat nur die Menschen erschaffen, nicht aber die Verhältnisse. Ein Pferd ist nicht schuld, wenn sein Reiter besoffen ist. Das muss man auseinanderhalten. Wenn ein Mensch sündigt, so sündigt er in freier Ent...“
Siebzehn sündigte. Er trat mit aller Kraft zu. Hebelwirkung. Das griesgrämige Gesicht des Christentölpels verruschte zu einem Ausdruck bodenlosen Entsetzens und aus seinem Mund drang ein gedämpftes Winseln. Da flog er aber schon und alles um ihn wurde rückwärts, auch sein Krückstock, der wie eine fehlgezündete Rakete durch die Luft wirbelte. Der Austausch der Eigentumsrechte war blitzschnell vollzogen. Dann ein Scheppern und großes Geschreie. Als die Polizei ihn wenig später unter den Gladiolen des Blumenstands vorzog, steckte ihm die Scherbe einer Topfpflanze in der Stirn und eine Bio-Trainage nässte seinen Hosenboden.
„Fünftes Gebot“, wütete Matthias Matussek wie ein Rohrspatz. „Nicht siebtes. 872! All Rubbish! Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?“