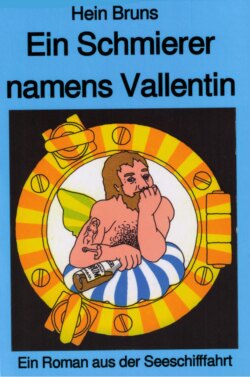Читать книгу Ein Schmierer namens Vallentin - Hein Bruns - Страница 4
Der Roman
Оглавление„BABITONGA steht in großen, weißen, lateinischen Buchstaben einmal am Heck und am Bug zweimal. Der Schriftgrund ist sargschwarz. Sornmersprossig frisst sich der Rost durch die weißen Lettern: S. S. „BABITONGA“. Bullaugen sind wie blinde Löcher. Müde, wie übernächtigt.
S. S. „BABITONGA“.
Masten und Ladebäume schmutzig gelb. Eiterfarbe. Masten und Ladebäume wirrig wie Spinnenbeine. Aufbauten weißgrau, wie Leinentücher, wie mit Soda gewaschen. Darüber grauschwarze Wolkenballen. Glasige Regenströme.
BABITONGA steht in schwarzen Buchstaben auf den
Rettungsringen. Wie Lack glänzen die Namen im Regen. Einmal steht der Name am Heck, zweimal am Bug, an Steuerbord- und an Backbordseite und auf den Rettungsringen. An der Bordwand herunter ziehen braune Rostflüsse. Ihre Quellen: Löcher in der Bordwand. Ihre Mündungen: heute der Hafen Bilbao. Morgen? Wer weiß es zu sagen. Die Leinen und Festmacher hängen durch wie die Brüste alter Weiber, und von den Rattenblechen tropft traurig der Regen.
Über die ausgetretene Gangway trage ich meinen Seesack an Bord, mit ihm einen Haufen Erwartungen. Meine Füße lösen sich vom Kai und fassen die ausgetretenen Sprossen. Durch meine rechte Hand gleitet das Haltetau. Der Seesack drückt die Schulter, der Regen rinnt in meinen Nacken. Die Gedanken sind Gummibändern gleich, bei jedem Schritt dünner werdend, bis sie wohl reißen werden. Gummibänder, verknotet in meinem Kopf, verankert auf einem Friedhof. Mit jedem Schritt dünner werdend ... bald werden sie reißen. Ein Mann spricht mich an: „Maschine oder Deck?“ Ich sage: „Maschine“. „Komm mit.“ Der Seesack fällt in eine Ecke. Die Regentropfen zählen sich an Deck. Ein Gang frisst mich, eine mahagonigetäfelte Kammer halb. Ich werfe mein Seefahrtbuch in den Lichtkegel einer Schreibtischlampe. Ich streiche mir die regennassen Haare aus dem Gesicht, ich spreche mit „Ärmelstreifen“. Eine Rumflasche grüßt mich stumm. Ein Chestertfield-Girl auf einem Kalender zeigt sein Lächeln und einen Teil seiner Reize. Ein abgesessenes Sofa verhöhnt mich. „Ärmelstreifen sichten mein Seefahrtbuch. „Ärmelstreifen“ grunzen: „Fuckin German ... aber kannst an Bord kommen.“ -
Die Kammer und der Gang spucken mich wieder aus. Oh, ich weiß Bescheid, ich weiß, wo ich bin. Schleppe den Seesack hinter mit her und trotte ins Vorschiff. Die Gummibänder werden immer dünner, aber reißen nicht. Die Gummibänder, verknotet in meinem Kopf, verankert auf einem Friedhof. Der Regen trommelt aufs Deck. Die Winden wimmern. Der Wind spinnt vom Regen Flachfäden, kurze nur, begonnen und beendet im Scheinhof der Maststrahler. Die Winden schreien und ihre Trommeln rumoren. Drähte wirbeln. Die Ladeluken sehen aus wie offene Wunden. Das Hafenwasser klatscht und patscht und leckt zwischen Kaimauer und Bordwand. Der Abend fällt auf den spanischen Hafen Bilbao. Der Rio Nervion wandert dunkel dem Atlantik zu. Irrende Hafenlichter flackern, flimmern, und hochragend steht ein Zollbeamter im Schutz eines Kohlengreifers. An den Berghängen die Stadt, blinzelnd mit ihren Lichtem. Ich werfe meinen Seesack den dunklen Niedergang ins Vorschiff hinunter und taste mich hinterher. Stehe in einem Gang, der die Matrosen- und Heizerwohnräume wie Zellen abzweigen lässt. Stehe im Gang, in dem es stinkt wie in einer Abdeckerei. Trete in eine spärlich erleuchtete Messe. Der Tisch mit Speiseresten beladen. Angefressene Brotscheiben ,Käserinden, Wurstpellen. Pfeifenasche, Zigarettenkippen, abgebrannte Streichhölzer und Stanniolpapier auf Tellern zwischen Gulasch und Makkaroniresten. Eine Fünf-Liter-Korbflasche, ein halb geleertes, blindes des, ausgezacktes Glas mit rotem Wein.
Ein Mann, dessen Kopf auf der Tischplatte ruht. Sein Speichel zieht Fäden. Das Hemd bekotzt, die Hose berotzt. Fliegen schwirren.
Kakerlaken finden einen gedeckten Fußboden.
Ich stoße den Mann an: „Heh, Makker, wach auf.“ Ein Lallen nur, ein unwilliges Grunzen: „Pestilenz, fahr zur Hölle.“ - „Los, komm hoch und zeig mir mein Logis.“ Verglaste Augen sehen mich an. Der Mund steht offen, die Haare wie die Schwingen einer toten Krähe.
Nun ist es wohl an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Damit wäre dann auch der größte Teil meiner Bildung, was Höflichkeit anbetrifft und Anstand, sozusagen, erschöpft. Sonst spreche ich grob, frei, auch unanständig die Wahrheit. Ich glaube, Höflichkeit ist meistens nicht die Wahrheit. Eine Vorstellung lohnt sich eigentlich kaum, denn mit mir ist, wie man wohl in guten Kreisen sagt, nicht viel los. Mit mir kann man weiß ,Gott nicht gesellschaftlich verkehren. Jedenfalls der brave, biedere Bürger und die treue, tugendsame Bürgerin nicht. Aber das macht ja nichts, und ich scheiß drauf. Mein Name ist Valentin. Das ist mein Vorname. Den Zunamen habe ich in meinem Leben so oft wechseln müssen, dass es überflüssig wäre, hier auch nur einen zu erwähnen. Ich bin meiner Mutter heute noch dankbar, dass sie mir den klangvollen Namen Valentin gegeben hat. Valentin ist in jeder Sprache klangvoll auszudrücken, am besten in spanisch. „Valentino“, klingt das nicht weich und warm, zutraulich, einschmeichelnd und anschmiegsam? Meinen Vater habe ich übrigens gar nicht gekannt, geschweige auf einem Bild gesehen. So viel wollte ich anfangs gar nicht erzählen, aber das ergab sich nun mal so.
Nein, erzählen wollte ich von der schwarzen Pepita, jenem Schankmädchen aus der Taverne in Bilbao. Die Taverne, an staubiger Kohlenpier liegt sie, und zwischen den dunklen Kohlenbergen fällt sie gar nicht so besonders auf. Es ist, als hätte man auch sie
einfach dort hingekippt. Ach so, Pepita. Um nun die Geschichte von ihr mit mir überhaupt
verstehen zu können, komme ich nicht darum herum, doch etwas aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe keinen festen Wohnsitz. Als Besitz allerdings einen ausgedienten Zigeunerwagen. Ohne Räder. Aufgebockt und verankert auf einem Trümmergelände in Hamburg. Ja, viel ist nicht drin. Der Sessel dort? Ja, ja, Leder, sogar gutes, warmes, dunkles Leder, wenn auch ein paar Löcher hinein gebrannt sind, die eine verdammte Ähnlichkeit mit eitrigen Wunden haben. Den Sessel habe ich auf einer Versteigerung erstanden. Er gehörte zu der Villa, die runter brannte, angezündet von oben. Den Tisch habe ich mir selbst gezimmert. Der Sockel war alter Hauklotz. Das ausgebeilte Loch verdeckte ich mit einer Platte, beklebt mit einer geklauten Seekarte, worauf noch die Kurse eingezeichnet sind. Ein Bett habe ich nicht. In Schwungnähe meiner Hängematte protzt ganz lässig mein Tag- und Nachtschrank. „Jaffa-Oranges“ prahlt es in schwarzen Buchstaben von der Flügeltür, und bescheiden wirkt der „Darjeeling-Tea“ der Seitenwände.
Den Primuskocher hat mit der Zigeuner hinterlassen. Knut Andersen, mein ehemals bester Makker, hat mir die „Leda mit dem Schwan“ geschenkt. Er hat acht Wochen daran gemalt. Die Brüste der Leda sind ja ganz üppig getroffen, aber der Schwan ist reichlich gänserisch. Würde Knut noch leben, hinge das Bild nicht hier ... denn so ehre ich ihn. Das ist auch alles, und das genügt auch. Der Wohnsitz genügt doch. Ich bin im Jahr, und manchmal sind es auch zwei, nur einmal dort. Sonst sind nämlich meine wechselnden Wohnungen die Foxeln und Massenlogis und Rattenlöcher und manchmal die Zweimannskammern der großen und kleinen Schiffe.
Englische Trampdampfer. Schwedische Motorschiffe. Holländische Kümos. Spanische Coaster. Panamesische „Rostwagen“. Manchmal auch ein sittsames deutsches Kompanieschiff. Schiffe können auch sittsam und prüde sein, besonders die deutschen. So verschieden wie Menschen, so verschieden sind auch Schiffe. Es kommt auf den Charakter an, und Schiffe haben auch Charakter. Aber an sich ist es mir scheißegal, welcher verfluchte Himmel der sieben Weltmeere sich über mir spannt. Vollständig nevermind, ob das Wasser, das an den mehr oder weniger rostigen Platten der Schiffe vorbeirauscht, das Wasser des Indischen oder des Atlantischen oder des Pazifischen Ozeans ist. Es ist auch egal, ob das Deck eines schwimmenden Sarges oder eines venerischen Sottewers unter meinen Füßen aus Holz, aus Eisen oder aus Rost besteht. Mir ist es vollkommen gleichgültig, ob die Maschinenanlage abwrackreif oder runtergefahren ist, ob sie klappert oder klopft oder wie eine Alpina-Uhr leise tickert. Scheißegal ist mir das. Scheißegal ist mir auch, ob die Trikolore oder der Union Jack, das Sternenbanner oder der Dannebrog am Heck eines Kastens weht. Je mehr Dollars man verdienen kann, desto schöner ist die Flagge. Scheißegal ist mir ebenfalls, ob der Kapitän ein Deutscher oder Däne, ein Grieche, Portugiese, ein Neger oder Mamelucke ist, ob Jude, Christ oder Moslem. Die Hauptsache ist, dass er mit den Flöhen rechtzeitig rüber kommt, genügend Schnaps herausgibt und nicht schwul ist.
Dass ich nun keine Familie habe oder vielmehr keine mehr habe, das kam so: In einer nicht allzu großen Werkstatt, ganz in der Nähe von Coventry, stellte ein Mann in der letzten Arbeitsstunde irgendeines Tages ein Ding fertig, und das Ding wurde eine kleine Bombe. Von dieser kleinen Bombe genügten an jenem hellen Sonntag ein paar winzige Splitterchen, um meine Familie, Frau und Kind, zu töten. Was soll ich da nun noch mit einer Wohnung? Zur gleichen Zeit war ich wohl in den Südstaaten und pflückte Baumwolle oder stahl einer alten Negerin aus ihrem abgelegten Kopftuch einen Kanten Brot. Vielleicht war das um diese Zeit, genau ist das gar nicht zu sagen. Möglich ist allerdings, dass ich gerade in der Bremsbox eines amerikanischen Eilgüterzuges hockte, frierend, hungrig, und die ausgefranste Kippe meiner letzten Camel quälte. Es kann aber auch sein, dass ich klappernd und nass im Schutze einer schiefen Scheune stand, derweil der Farmer mit der Flinte fluchend ums Haus schlich und ich für mein Leben keinen fuckin Cent mehr gab. Aber ich blieb doch übrig.
Da ich ja nun von Pepita erzählen wollte, muss ich sagen, dass sie damals auch übrigblieb. Das war aber viele Jahre früher. Als die Bombe eines roten oder Francobombers, was weiß ich, die Behausung ihrer Eltern in alle Winde wehte, blieb Pepita übrig. Sie war damals zwei Jahre alt.
Dass man mir im Vorschiff eines schwedischen Dampfers mit einem Kartoffelschälmesser das linke Auge vermasselte, bringt mir im Monat wohl sechzig Kronen ein, bewirkte aber auch, dass ich vom Matrosenlogis ins Heizerdeck umtakelte. Und so zuckelte ich auf einem elenden Steamer als Heizer die portugiesische und spanische Küste ab.
Ein Zuckerschlecken war das verdammt nicht. Hin und her, auf und ab. Teufel und Valentino, was war das für ein Hundeleben. Ja, auf den grünen hohen Hängen der handnahen Küste glänzte gleißende Sonne. In die fressgierige, fanatische Feuergruft, das Höllenloch des Heizraumes fiel kein Sonnenstrahl.
Aber für mich war die helle Sonne jene kleine Pepita, dort in der dunklen, tristen Taverne am Kohlenpier zu Bilbao. Ein Stinkloch, dieser Weinladen, und mit Verlaub gesagt ... der Wein war sauer. Und darum glaube ich auch nicht, dass es der Wein war, der die Matrosen und Heizer, die Stewards und Köche, schwarz, weiß, gelb oder braun, in diese Bodega zog. Ein Stinkladen. Verräuchert. Der ausgelatschte Zementboden mit Abfallen und faulen Fischresten wieder geglättet. Spucke. Kotze. Speckige Tische. Aus dem dunklen, gegerbten Ziegenbalg rann träge Vino tinto in die billigen Gläser. Wie Blut sah der aus. Herrenlose, magere Köter verschlangen gierig Fischreste. Weinlachen zeichneten Seekarten.
Ja, Pepita, das Schankmädchen, zog sie alle an, die Seeleute aller Nationen ... und auch mich. Ein kleines funkelndes Kreuz aus hellem Silber lag um ihren dunkelbraunen Hals. Ja, der Hals … So verschieden ist das nun. Der eine verliebt sich in das Gesicht, der andere in die Stimme, der nächste in die Beine, Brüste, Hüften und was weiß ich. Ja, und ich verliebte mich eben in den Hals. Pepita stellte mir ein Glas des billigsten Weines auf den Tisch. Ich sah in ihre nachtschwarzen Augen, auf ihren Hals, in ihren Busenausschnitt und in das Weinglas. Und mir schien die Sonne. Sonst ist es dunkel hier, so dunkel wie die Augen Pepitas.
Rostige Dampfer schlafen am Pier. An dem Kohlenkai ächzen dreckige Särge in ihren Leinen. Klatscht tintiges Brakwasser gegen morsches Holz. Wieseln geduckt fette Ratten längs den Kranschienen. Rumoren und rumoren und stöhnen die Laufkatzen. Polternd fallen die Lasten. Der Kohlenstaub glitzert im Lampenlicht wie Flitter.
Aber Pepita ist da. Teufel, Señore, ihre Augen sehen mich an, oft, und meine Augen wandern mit ihr, von Tisch zu Tisch, zur Tonbank, wandern über ihre Hände, die den Ziegenbalg drücken und das Glas halten, und fassen wieder die Augen, die dunklen, großen, tiefen Augen. Und ihre Augen suchen auch mich immer wieder. Ein silbernes Kreuz an einem silbernen Kettchen liegt um ihren dunkelbraunen Hals.
Und als der letzte Kohlenarbeiter ging, die letzten Seeleute krakeelend ihre Zeche bezahlten und eingehakt und torkelnd vom Dunkel der Nacht geschluckt wurden, die herrenlosen Hunde an die Kohlenpier gejagt, wusste ich und wusste Pepita, dass wir, Wrackteile des Lebens, aufeinander zu trieben. Sie, die damals übrigblieb und ich, der übrig bin.
Vom kleinen eckschiefen Fenster des alten Hauses im Hafenviertel von Bilbao aus sehe ich auf den nächtlichen Río Nervion. Unter dem Kruzifix flackert das irre Licht einer Kerze, und der Schatten Pepitas liegt zitternd auf schäbiger Tapetenwand.
Die Dampfer, die großen und die kleinen, ziehen mit grünen und weißen und roten Lichtern land- oder seewärts. Im morschen Gebälk des Hauses knabbern Mäuse.
Ich drehe mich nicht um, als sich behutsam warme, weiche Hände auf meine nackten Schultern legen.
Eine leise Stimme zögernd fragt: „Sind die Wrackteile nun an Land getrieben, Valentino? Kann man sich von Wrackteilen ein Haus bauen, amigo?“ „Oh ja, das kann man. Und das Haus kann sogar ganz solide und fest werden. Es kommt auf das Fundament an. Einen englischen Rüstungsarbeiter oder einen roten oder Francobomber, was weiß ich, darf man wohl nicht mit einkalkulieren.“
Draußen gehen die spanische Nacht und der Sommer durch windschiefe Gassen. Hallt der harte Schritt eines Milizsoldaten. Schreit ein Kind im Schlaf. Bellt ein Hund sich heiser. Grölt ein besoffener Seemann. Keift ein Weib. Schlägt ein Fenster zu. Der laue Wind, warm und verwaschen, über den Rio Nervion kommend, spielt leicht in den brüchigen Gardinen und lässt die Flamme der Kerze tanzen, und die Schatten der künstlichen Blumen wandern ... wandern ... stehen, wachsen ... wachsen … sinken, Schatten wie Schicksalsriesen, Schatten wie Schicksalszwerge.
Und es ziehen die Dampfer, die großen und die kleinen, mit roten und grünen und weißen Lichtern land- oder seewärts. Lichtvoll. Lautlos. Lautlos? Dampfer sprechen immer. Dampfer rufen. Dampfer schreien. Dampfer locken, locken wie Sirenen. Dampfer wollen uns, bei Tag und bei Nacht. Aber nur wir kennen ihre Sprache, nur wir hören die Rufe und die Schreie, nur wir wissen um das Locken.
Im ersten Stock, Saal Nummer vier, Bett sieben des Armenhospitals zu Bilbao am Rio Nervion, verflucht noch mal, lag auf weißen Kissen ein noch weißeres Gesicht. Mich rief kein Dampfer mehr, mich rief dieses Gesicht, von Wunden zerfressen, von Binden eingehüllt. Mich rief kein Dampfer mehr und lockte auch nicht. Drei Wochen schuftete ich am dunklen Kohlenpier von Bilbao. Jede Nacht. Am Tage suchte ich die Augen Pepitas. Sie waren nicht mehr. Tot, nur noch Höhlen. Salzsäure ist ein Teufelsstoff, ein Höllensaft, so ihn ein besoffener Seemann in nachtschwarze Augen schüttet, um das Feuer darin und in seinen Schenkeln zu löschen. Drei Wochen lang schrie Pepita nach Licht und nach mir.
Drei Wochen lang schuftete ich, jede Nacht, und jede Peseta trug ich in das Hospiz. „Ich glaube, amigo“, so sagte Pepita zu mir, „unser Haus steht noch ganz gut, das Haus aus Wrackteilen.“ Caramba, das ging mir aber doch an die Nieren.
Ja, sie sah nicht mein Gesicht und nicht meine schlaftrunkenen Augen. Sie sah das alles nicht mehr. Drei Wochen, einundzwanzig qualvolle Tage und Nächte, dann war alles vorbei. Das kleine, funkelnde Kreuz am silbernen Kettchen band ich ich ihr zum letzten Mal um ihren Hals und legte meine Hand auf ihre zweimal gestorbenen Augen. Und aus dem silbernen Kreuz an ihrem Hals wuchs ein steinernes auf einem Hügel. Die Friedhofsmauer war rot und verwittert. Nun war doch das Haus, aus Strandgut errichtet, zusammengebrochen, und übrig blieb ich. Ich und jener Zehntausendtonner,
S. S. „BABITONGA“, der die Panama-Flagge am Heck führt. Bist du der Neue? Dann los, verflucht, dann ran an die Arbeit.“ So reißt man mich aus dem Schlaf. Der Morgen grinst fahl durch die Bullaugen. Die Schläfer über und unter mir sehen aus wie Tiere, in graue Wolldecken gewickelt. Die grauen Tiere bewegen sich. Wie Erdwürmer. Die grauen Wolldecken rekeln sich beiseite. Und schmutzige Maden schälen sich aus den grauen Hüllen. Flüche, englisch, deutsch, spanisch. Gähnen. Furze. Heißer Weinatem. Stickige Luft. Dünner Kaffeegeruch. Eine Konservendose mit Marmelade. Ich sitze mit an der Back und verteile den Jam auf einem Ranken Brot. „Wann bist du denn eingestiegen?“ „Gestern Abend.“ „Bist doch Deutscher, was?“ „Yes.“ „So ... hab ich mir gedacht ... Der da auch.“ Zeigt über den Tisch auf einen schmächtigen Kerl, der nicht einmal aufsieht, den ich aber schon von gestern Abend kenne.
Misstrauisch peilt man mich an, immer nur von der Seite. Sie mustern meinen noch gefüllten Seesack und meine Arme. „Bist gerade nicht von der Hure ausgerüstet, hast Klamotten genug“, meinte einer. „Und auch nicht von der Polizei an Bord gebrach“, ein anderer. Sie beobachten mich, wie ich esse. Sie scheinen zufrieden zu sein, denn ich schmatze wie sie und liege auch breitarmig auf dem Tisch. Sie scheinen beruhigt zu sein, denn ich bin tätowiert wie sie. Sie scheinen mich aufgenommen zu haben, denn ich schweige wie sie. Sie zeigen auf mein Glasauge. „Wie ist dir das denn ausgetröpfelt?
Ich sage: „Kartoffelschälmesser.“ Der gichtige Wecker zeigt auf sieben Uhr. „Heh, gentlemen, let's go.“ So trotten wir nach mittschiffs in den Maschinenraum. „Ärmelstreifen“ warten schon auf uns. „Ärmelstreifen“ verteilen uns an die Arbeitsplätze. Ich kriege als Neuer natürlich den schlechtesten Job. Hab' ich anders auch nicht erwartet. Mir brummt der Schädel, und ich habe einen fauligen Geschmack im Mund. Die Arbeit ist schwer, wir schwitzen in dieser Treibhausluft wie Bauern bei der Heuernte. Mensch, ein Eimer ist das da ja auch, dieser Kasten, nur der Rost hält ihn noch zusammen. An Deck macht er sich in Fladen breit. Wie Efeu klettert er die Aufbauten hoch. In den Logis wächst er abwärts. An der Verschanzung hockst er wie ein altes Marktweib. Im Maschinenraum wuchert er in die Bilgen hinein. Rost fett und Essen mager. Ich habe nicht immer so vergammelte Untersätze unter meinen Füßen gehabt, nein, nein. Ich bin schon auf Firnis spazieren gegangen, wie auf nackten, blanken Eisendecks. Lag auf weiß gescheuerten Holzplanken, so rein wie eine Jungfrau. Wohnte in Logis, wo die Decken verschalt, die Wände mit warmem Edelholz getäfelt waren, oder in weißer Farbe glänzten, so glatt, so weiß, so blank. Hier ist das nun ein wenig anders. Der Rest der Farbe an den Wänden hält sich mit Mühe. Die Decke ist mit Korke gespritzt, sieht aus wie ein Jünglingsgesicht in der Pubertät. Fußböden mit Löchern. Nägel statt Kleiderhaken. Spinde aus Blech. Bänke wie im Dritter-Klasse-Wartesaal. Ein Tisch, stark, stabil, dickbeinig. Eisengestelle die Kojen, zwei nebeneinander, zwei übereinander. Eine Einzelkoje für den Moses, den Jüngsten, den Aufwärter.
Die Strohsäcke sind dünn und stocktrocken. Sie stauben und stinken. Sind mürbe wie Sauerbraten. Mit acht Pipels hausen wir hier. Sieben Schmierer und ein Moses. Wir sind „gehobene Heizer“ und die Heizer wohnen auf der anderen Seite des Ganges und wohnen auch nebenan. Wir gehören verschiedenen Nationen an. Einer ist staatenlos, und der Moses ist Mischling. Wir haben alle keinen festen Wohnsitz. Unsere Heimat sind die sieben Weltmeere, die Maschinen und die Motoren, der Suff und der Dreck und der Rost. Unsere Arbeitsplätze sind Maschinenräume auf Dampfern und Motorschiffen, tief unter Deck, noch unter den Flurplatten. Unser Leben ist harte Arbeit. Unsere Frauen wohnen in den Bordellen oder arbeiten auf der Straße oder werken in Kaschemmen und Kneipen oder sind Nackttänzerinnen, wohnen in Bordellen in Marseille, in Rio, in Shanghai, in Hamburg und Antwerpen, in Lissabon, Baranquilla. Was weiß ich, ob in Privatbordellen oder staatlich geförderten. Rund um die Erde. Bordelle gibt es übrigens mehr als Mädchenpensionate. Wir sagen schlicht Puff, wollen wir es dabei belassen. Wir tragen unser Schicksal im Gesicht, wir tragen es tätowiert auf Händen, Armen, auf der Brust, und der oder der manchmal noch auf anderen Körperteilen. Es gibt tätowierte Mäuse, die im Arsch verschwinden wollen, es gibt blaue Schmeißfliegen auf den Hoden. Es gibt Anker und Seemannsgräber, mit Rettungsringen und Christenkreuzen und Schiffswracks und untergehender Sonne. Es liegen Tiger zum Sprung auf Arm und Bein, rotkrallig. Es lächeln rassige Frauenköpfe, es ringeln sich Schlangen um die Beine, es segeln Viermastbarken quer über behaarte Brüste. Ja, ein Frauenschoß zeigt sich geöffnet mit angedeuteten Schenkeln. Farbig, rot, blau, grün. Emil sammelt übrigens Schamhaare, das hat er mir bei der Arbeit erzählt. Das erste, was er mir erzählte, und seine Sammlung dürfte ich auch einmal sehen. Nein, nein, da ist auch nichts Heroisches, nichts Heldenhaftes und nichts Gewaltiges an uns. So was liest man nur in guten Seeromanen, in denen von stillem Sterben, von wilden Stürmen, von mörderischen Grundseen und lieblichen Haitimädchen, von romantischen Sonnenuntergängen und von heimwärts tuckernden Fischerbooten auf schwarzsamtenen Fluten gesprochen wird.
Wir sind wohl blond oder schwarz, wir sind wohl stark oder schwach, aber wir sind nicht vom Wind und von der See gegerbt.
Der Alkohol ist nett zu uns ... und wir zu ihm. Die Weiber sind nett zu uns ... und wir zu ihnen. Ich sage Weiber, denke nicht an Mädchenpensionate, sondern an Puffs. Die Winden an Deck sind stumm. Die Ladeluken geschlossen. Die Ladebäume in den Halterungen vertäut. Die Gangway eingezogen. Die gelben, grauen und weißen Häuser Bilbaos kleben an den Hängen. Die Dächer leuchten, rot, schwarz, grau, rot, schwarz, grau rot und rot. Rauchfahnen malen den Himmel schmutzig. Kohlen an der Pier glitzern und glänzen in der Sonne. Das Gebilde aus Eisen und Farbe, Rost und Dreck, Menschen und Erwartungen, Hoffnungen und Schmerzen gleitet aus dem Hafen. Die Gummibänder werden jetzt wohl dünner werden. Irgendwo werden sie zerreißen. Der Rio Nervion läuft uns entgegen, und aus einem eckschiefen Fenster eines altersschwachen Hauses im Hafenviertel zu Bilbao winkt eine brüchig verwaschene Gardine.
Lang und träge ist die Dünung des Nordatlantiks. Die Küste Spaniens schiebt sich an Backbordseite vorbei. Das Schiff ist eine schwimmende Insel, wie losgelöst vom Festland. Die Menschen sind mit losgelöst vom Festland. Ihre Freuden und Leiden, ihre Gedanken und Empfindungen, ihre Begierden und Sehnsüchte, ihre Höhen und Tiefen menschlichen Seins, das alles ist losgelöst vom Festland. Das Schiff ist eine schwimmende Insel. Eine Insel mit Kastengeist. Wir vorne und „die“ achtern. Wir vorne sind das Volk und „die“ achtern die Herren. Aber auch die Herren sind Menschen.
Heute Abend gibt es Hammelfleisch und Kohl. Der Kapitän ist ein Grieche. Darum Hammelfleisch. Dieser hier, ein gedrungener, schwarzhaariger Kerl mit Rattenaugen. Stets weiß und korrekt gekleidet, stets das Volk übersehend, stets nur bissig fragend und bissig antwortend. Anspringen könnte ich ihn jetzt schon. Bei Wachablösung mittags läuft er auf dem Kapitänsdeck hin und her. Das Weiß seines Anzuges lacht uns aus, das Gold der Tressen und Mütze peinigt uns. Die Rattenaugen und der kleine schwarze Bart fordern auf zum Hineinschlagen. Meinen ersten Gruß hat er nur einmal überhört, ich grüße nicht wieder. Kapitäne sind Menschen. Kapitäne, deren habe ich viele kennengelernt. Kapitäne sind wie Jungfrauen, unnahbar, unberechenbar. Kapitäne sind wie Huren, zugänglich, käuflich, für jeden da. Kapitäne sind wie Katzen, falsch, verschlagen, hinterlistig. Kapitäne sind wie Hunde, zuverlässig, treu, echt, stark. Kapitäne sind wie Bäume, gerade, knorrig, alt, erprobt. Kapitäne sind wie Geier, habgierig, geizig, verfressen. Sie sind wie alte Weiber, verschwatzt, hysterisch, hinterhältig, Sie sind wie junge Mädchen, frisch, fröhlich, lebendig, lustig, lebensbejahend. Kapitäne sind wie du und ich … Menschen. Heute Abend gibt es Hammelfleisch mit Kohl. Wir sitzen nicht allhands an der Back. Nur mit Fünfen. Und der Moses. Zwei Mann sind auf Wache. So ein harter Arbeitstag im Hafen und ein paar Tage auf See bringen uns einander näher. Nationalität, Rasse, Farbe der Haut brauchen wir nicht zu überbrücken. Wir sind uns näher, wir sehen uns schon unverhohlener an. Wir kommen uns näher, weil wir uns schon einige Male gewaschen und den Land- und Weibergeruch abgespült haben. Wir finden Brücken des Verständnisses leichter, weil wir eigentlich unkompliziert sind, weil wir uns bei der Arbeit mit dem Vorschlaghammer abgelöst und uns den schweren Schraubenschlüssel zugereicht haben und an der Kette des Fünf-Tonnen-Flaschenzuges gemeinsam zogen. Männer, primitiv wie wir, kommen sich leichter näher. Männer, wie sie die See nach ihren Gesetzen formt, in einen Raum zwingt, an eine Back bannt, nebeneinander und übereinander schlafen lässt, finden eher zusammen. Das Hammelfleisch ist fett und der Kohl sandig. Das Fett ist halt und körnig, der Kohl knistert zwischen den Zähnen. Meine letzten Klamotten reiße ich aus dem Seesack und verstaue sie im Spind. Ich bin der Neue, ich habe das schlechteste Spind. Es steht in der dunkelsten Ecke, und die Tür hängt, und die Füße sind verrostet.
Ich gehe noch ein paar Minuten an Deck. Die Sonne ist nur noch eine halbe Scheibe, gleich hat der Westen sie verschluckt. Die Küste gleitet eben sichtbar mit. Das Bugwasser rauscht. Der Fahrtwind lässt die Wanten zittern.
Die Positionslampen im Vor- und Achtermast brennen gelb. Der Moses, der Mischling, klappert mit dem Geschirr. Kaltes Hammelfleisch mit kaltem Wasser von den Blechtellern wieder runter kriegen... das muss man können. Ich gehe wieder in das Logis zurück und in die Koje. Wickle mich in meine graue Wolldecke und schlafe. Mich stört nicht das Stimmengewirr, nicht der Tabakrauch, nicht das Rauschen der Bugwelle und auch nicht das Geklapper und Geschepper des Geschirrs. Ich habe die Hundewache, 12 bis 4Uhr in der Nacht, 12 bis 4 Uhr am Tage. Die Neuen kommen immer erst auf die Hundewache. Um halb zwölf muss ich wieder aufstehen. Ernesto geht mit mir zusammen die Wache. Ernesto ist staatenlos. „Rise, rise, Neuer, arriba, du bist um zwölf am Törn. Allerhand Arbeit unten, komm hoch!“ Ich bin immer noch der Neue, werde wohl auch der Neue bleiben, bis ein Neuer kommt, oder bis eine Sauferei oder Schlägerei gewesen ist. Dann sagen sie zu mir Valentin, aber auch nur dann, wenn ich mich in der Sauferei oder Schlägerei bewährt habe. Das ist auf allen Schiffen so. Wir sind nicht empfindlich, oh nein!
Der Tee ist schwindsüchtig, den ich trinke. Zucker habe ich nicht, die andern aber. Gestohlen in der Kombüse. Oh, auch ich kriege noch einmal Zucker. Nein, so nahe sind wir uns noch nicht, dass man schon beginnt, mit mir zu teilen oder zu makkern. Ich das und frage auch nicht nach Zucker. Würde ich anders handeln als sie? Nein, ich hielte es auch so. Die Heizer klappern schon mit ihren Holzpantoffeln übers Deck. Ernesto und ich folgen, wir sind Schmierer. Der Mond ist blank wie ein Kinderarsch und auch gelb. Die See liegt glasig. Die Positionslampen an den Masten brennen heller. Die Brücke hüllt sich in Dunkel. Das Ungeheuer Schiff hat ein grünes und ein rotes Auge. Grün an Steuerbord und rot an der Backbordseite. Das Ungeheuer Schilf hat auch einen Bauch und Beine. Beine, die nach oben zeigen. Das Ungeheuer Schiff ist unsichtbar, bis auf die Augen, rot und grün. Und die Beine, weil sie helles Licht haben. Da draußen ziehen viele, viele Ungeheuer. Lautlos, nur mit Augen, vorbei. Lautlos. Schemenhaft. Nur mit Augen, rot oder grün, und auch mit erleuchteten Beinen. Die Küste zieht Lichterketten und ist in Abständen dunkel ... da fehlen Perlen. Lichtaugen stechen in die Nacht – Blinkfeuer. Lichtfinger greifen in die Nacht – Leuchtfeuer. In dieser Nacht, auf dieser Wache, muss ich heizen. Ein Heizer ist ausgefallen, hat sich verbrannt, liegt in der Koje. Der Neue muss heizen. Oh, der Neue kann heizen. Der Neue hat schon geheizt. Die Feuerschlünde der Dampfkessel werfen Glut und brennendes Licht auf die nackten, blanken, schweißtriefenden Oberkörper. Die Feuerschlünde sind gierig und unersättlich und fressen und fressen Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Eisen, Fleisch, Schweiß. Die Feuertüren der Kessel klappen auf und zu, auf und zu. Klapp klapp, die Feuertüren. Kohle, Kohle. Gebückte Menschen, geduckte, gebeugte Oberkörper und wieder aufgereckte. Schaufel auf Schaufel mit Kohle. Schweiß. Blanke Rücken. Schaufel. Kohle. Feuerschlünde. Ratsch, ratsch, die Schaufeln auf den Eisenplatten. Gepolter der nieder rauschenden Kohle in den Bunkern. Dünner Tee aus versprengten Tassen. Rote Glutpyramiden der Zigaretten. Sie peilen mich auch hier von der Seite an. Sie sagen nichts. Feuertüren. Aschfall. Schaufel. Die Feuerschleusen reißen die Glut auf. Die Feuerkrücken verteilen die Glut. Dann wieder Kohle – Kohle. Schaufel auf Schaufel. Und Manometernadeln zittern, und der Aschfall unter den Rosten ist hell. Und oben an Deck gehen die Nacht und die See und die Nacht und die See und der Mond. Ziehen an den Küsten Perlenketten. Die Augen des Ungeheuers starren in die Nacht, rot und grün.
Die Tage werden von den Wachen aufgefressen. Die Nächte von den Wachen geschluckt. Der Schein des Leuchtfeuers von Kap Vincent hastet über die See. Wir verlassen Europa. Heizen tue ich nicht mehr, bin wieder Schmierer. Stehe zwischen auf- und abwärts schwingenden Eisenmassen und zähle die Öltropfen in die Lager. In Armlänge fauchen die Nieder- und Hochdruckkolbenstangen auf und nieder, schlittern die Gleitbahnen, zischt der Dampf. Und ich zähle die Tropfen in die Lager. Alles ist von glühender Wärme. Das Geländer, die schwingenden Eisenteile, die Lager. Der Neue hat natürlich die Mittelstation, wo es am wärmsten ist. Ich schwitze wie ein chinesischer Kuli, der Schweiß steht mir in den Schuhen. Ernesto ist mein Wachkumpel, und Ernesto ist in Ordnung. Ernesto ist eine Art Mann, vor dem jeder so etwas wie Respekt aufbringt. Sogar die „Ärmelstreifen“. Was Ernesto für ein Landsmann ist, sagt er nicht, und ich habe es auch nie erfahren ... so ist er staatenlos. Er selbst behauptet von sich, dass er Kosmopolit sei. Seinen Namen bekam er von einer Hure, die in Buenos Aires besoffen in der Gosse lag und ihn anscheinend mit jemand anderem verwechselte. Sie lallte immer nur „Ernesto“. Der Rest ersoff im Speichel, der ihr aus dem geschminkten Mund triefte. Ernesto half ihr auf die Beine und ins Bett. Ernesto hatte überhaupt bei den Huren einen dicken Schlag; er konnte auch mit ihnen umgehen, und vor allen Dingen, er übersah ihr Gewerbe, tat so, als wäre jede seine große Liebe. Ließ das Gespräch gar nicht auf das Geschäftliche kommen, und ich glaube, er war wirklich in jede Hure verliebt. Ernesto spricht Skandinavisch wie ein Nordländer, Deutsch wie ein Hannoveraner und echtes Londoner Cockney, Französisch lernte er in der Legion. Dort ist auch seine Haut gehärtet worden. Er besteht nur aus Sehnen und Haut. Kann tage- und nächtelang saufen, kann aber auch tage- und nächtelang arbeiten. Er ist ein Superzyniker und von einer brutalen Offenheit. Kennt alle menschlichen Schwächen und Fehler und dunklen Seelenflecke und legt sie so schonungslos dar, dass uns alten Halunken noch so etwas wie Schamröte hochkommt. Schamröte aber nur, weil Ernesto das auszusprechen wagt, was wir meinen, sei tief in unserem Innern verborgen. Und wir sind, weiß der Teufel, nicht prüde. – Viel später war das. Am Strand von Miami lagen wir und sonnten unsere Glieder. Zwischen Millionären, Playboys und Welt- und Halbweltdamen rekelten wir uns in der Sonne Floridas. In der Badehose sind Millionäre von Abenteurern und Seeleuten nicht zu unterscheiden, denn auch diese sind tätowiert. Nur dass deren feudale Herrenausrüstung in den Apartments der Strandhotels liegt, unsere Nietenhosen und Buschhemden sich aber hinter der steinigen Strandmauer knüllen. Da brachte es Ernesto fertig, zu einer reizenden und wohl auch eleganten Dame im gewagten Bikini zu sagen „Auch Sie, meine Dame, haben schon mit Ihren reizenden Fingerchen zwischen Ihren Fußzehen herumgefummelt und anschließend Ihre süßen Fingerchen berochen, oder nicht? Die Dame, verblüfft, wurde rot, überlegte, stotterte, von so viel Offenheit entwaffnet, gab es zu. Erhob sich aber dann und ging, schmalhüftig, ohne ihn auch nur noch eines Blickes zu würdigen. So sagte Ernesto zu mir: „Neuer, hast du schon jemals an deine Fußsohlen gedacht?“ „An Fußsohlen?“ „Ja, hast du sie schon jemals gewaschen? Sei doch ehrlich. Wozu auch? Wenn du an Land gehst und mit einem Mädchen schlafen willst, bearbeitest du doch deinen ganzen Körper. Schrubbst ihn von oben bis unten, besonders den unteren Teil, oder nicht? Deine Haare kriegen das, was du gerade zur Hand hast, Haarwasser, Öl oder Brillantine, zumindest aber eine Handmassage, oder nicht? Deinen Fingernägeln versuchst du doch einigermaßen weltmännischen Schliff zu geben und kratzt den Scheiß aus den Trauerrändern. Aber an deine Fußsohlen denkst du nicht. An sich verständlich. Denn mit Fußsohlen kann man keinen Staat machen, mit Fußsohlen kann man auch keine Frau verführen. Mit Fußsohlen kann man nicht angeben. Ob sie weich und weiß wie Hühnerfleisch sind oder fest und trocken wie Rindleder, niemand kümmert sich darum, nicht einmal du selbst. Ich habe jedenfalls noch mit keiner Frau im Bett gelegen, die nach meinen Fußsohlen gefragt hat, geschweige sie hat sehen wollen. Ich muss sagen, seitdem wasche ich meine Fußsohlen.