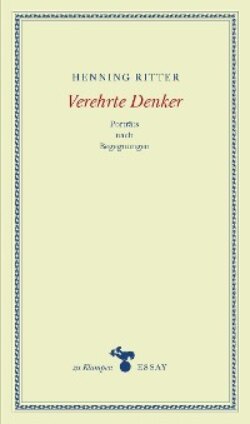Читать книгу Verehrte Denker - Henning Ritter - Страница 5
Carl Schmitt Besuch in Plettenberg
ОглавлениеEs klingelte, und ich lief zur Tür. Ein wichtiger Besucher war angekündigt. Ich sollte meinen Diener machen und den kleinen älteren Herrn, gewiß weit über sechzig, hereinlassen – »Legen Sie bitte ab«. Daß uns Kindern das Empfangsritual übertragen war, daran waren meine Schwester und ich schon lange gewöhnt. Vaters Amtsgeschäfte – er war seit 1947 Professor für Philosophie an der Universität Münster – wurden in den ersten Jahren zu Hause abgewickelt, da das Seminargebäude noch nicht wieder aufgebaut war. Es war unsere Aufgabe, die Studenten, die zur Sprechstunde kamen, zu empfangen und zu Vaters Arbeitszimmer zu bringen. Wenn sie warten mußten, pflegten wir sie mit allerlei »Döntjes« zu unterhalten. Beim Mittagessen gaben wir zum Besten, was wir aufgeschnappt hatten, aber auch unsere oft grausamen Urteile über die Studenten. Unser Examen bestanden nur wenige.
Seltener kamen namhafte Besucher, abends bekamen wir sie nicht zu Gesicht. Den Gast, der sich als Carl Schmitt vorstellte, hatte mein Vater als einen bedeutenden Mann angekündigt. Als er bei uns erschien, es war 1957, war ich noch nicht vierzehn Jahre alt. Von den näheren Umständen seines Besuchs wußte ich nichts. Er sollte im Collegium Philosophicum, dem Diskussionskreis der fortgeschrittenen Studenten, einen Vortrag halten. Das war nicht selbstverständlich. Carl Schmitt war wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus nach 1945 kaltgestellt und ohne Aussicht, in die akademische Welt zurückkehren zu können.
Daß er in Münster auftreten konnte, ohne daß es seitens der Universität zu einem Einspruch kam, erklärt sich dadurch, daß diese Veranstaltung als private Begegnung deklariert wurde. Die Teilnahme war sogar für die Mitglieder des Collegiums freiwillig, und die Zuhörer brachten die gesamten Kosten des Besuchs von Carl Schmitt in Münster aus der eigenen Tasche auf. Ernst Wolfgang Böckenförde, der zum engeren Kreis um Carl Schmitt gehörte, hatte das Treffen angeregt, und mein Vater meinte, daß ein Mann vom Range Carl Schmitts, trotz seiner nationalsozialistischen »Belastung«, als bedeutender Kopf und Gesprächspartner nicht ignoriert werden dürfe.
Carl Schmitt war der erste, der wie mit einem Erwachsenen mit mir redete. Er setzte voraus, daß ich wußte, mit wem ich es zu tun hatte, und als wollte er zeigen, daß er ein umgänglicher Mensch war, stellte er sich mir von einer unerwarteten Seite vor – als Erzähler. Er holte ein schmales Büchlein hervor, ein in grünes Leinen gebundenes Reclamheftchen. Darin würde ich, meinte er, spannende Geschichten über Piraten und Abenteurer finden. »Land und Meer« lautete der Titel. Darunter stand: »Eine weltgeschichtliche Betrachtung«. Daß der Verfasser damit auf einen großen Historiker des neunzehnten Jahrhunderts anspielte, auf Jacob Burckhardts »Weltgeschichtliche Betrachtungen«, konnte ich damals nicht wissen.
Als ich das Heft aufschlug, fand ich darin eine handschriftliche Widmung: »Für Hanns Henning Ritter zur Erinnerung an den Besuch von Carl Schmitt, Münster im März 1957«. Und unter der Widmung standen in der schönen, aber für mich nicht gleich lesbaren Handschrift noch ein paar Zeilen: »Ich denke, lieber Hanns Henning, daß dich die Sache mit dem Wal (Seite 15 ff.) und die Geschichte der Lady Killigrew (Seite 27 ff.) besonders interessieren könnte. C. S.« Auf der Rückseite des Titelblatts fand ich später eine gedruckte Widmung: »Meiner Tochter Anima erzählt.« In gewisser Weise sollte ich mich durch die handschriftliche Widmung einbezogen fühlen in die Intimität dieser väterlichen Erzählung.
Das Gewand, in das er seine Gedanken über die europäischen Raumrevolutionen gehüllt hatte, war dazu angetan, Leser irrezuführen. Ja, offenbar war es die Absicht dieses schmalen Büchleins, seine Leser nicht merken zu lassen, daß der Verfasser in dieser Erzählung dieselben Ansichten darlegte, die er in gelehrten und umstrittenen Abhandlungen und Büchern vertreten hatte. Auf diese Weise hatte Carl Schmitt sich ein Schlupfloch geöffnet, durch das er aus dem Gehege der öffentlichen Ächtung auszubrechen vermochte.
»Land und Meer« ist eine Geschichtsphilosophie in nuce, zweifellos ein Wunderwerk doppelter Lesbarkeit. Die Geschichten über die Walfänger, die bei ihrer Jagd nach dem Wal als erste die Weltmeere in allen Richtungen durchpflügten, und über die räuberische Lady Killigrew, die zur Zeit der Königin Elisabeth mit ihrer Piratensippschaft die Schiffe, die der Küste zu nahe gekommen waren, unbehelligt ausraubte und niemanden mit dem Leben davonkommen ließ, lasen sich wie spannende Abenteuer und waren doch zugleich Wegmarken in der ungeheuren Geschichte der Verwandlung Englands in ein Seereich.
Während der Leser sich als Zuschauer der Abenteuer der europäischen Welteroberung in der Sicherheit eines lange zurückliegenden Geschehens weiß, wird ihm von den Umwälzungen des Raumbewußtseins buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen. An der Schwelle zur Gegenwart folgt auf die maritime Expansion die Eroberung des Luftraums, die die herkömmlichen Unterscheidungen von Land und Meer obsolet macht. Der Märchenton, in den die Vergangenheit getaucht war, ließ die Zukunft eher noch beunruhigender erscheinen.
Mich hat der Hinweis auf »die Sache mit dem Wal« und die Geschichte der Lady Killigrew lange davon abgehalten, die andere Geschichte, die Carl Schmitt erzählte, zu bemerken und den Hintersinn dieser kleinen Weltgeschichte der europäischen Expansion zu erfassen. Seinen literarischen Rang offenbart das sechzigseitige Buch aber erst dann, wenn man einer solchen jugendlichen Lektüre in späteren Jahren eine andere folgen läßt, die ein Gespür für die untergründigen Beängstigungen hat, die tiefer gehen als die von den Abenteuern der Piraten geweckte Spannung.
Die Geste Carl Schmitts hat mich dauerhaft für ihn eingenommen. Damals konnte ich nicht durchschauen, welch geniale Menschenfängerei eines alten Mannes darin lag. Der Eindruck dieser ersten Begegnung war so stark, daß ich noch während meiner Schulzeit auf Bücher von Carl Schmitt zu achten begann. Eine Nachwirkung jener ersten Begegnung war auch, daß ich während meines vierten Semesters – ich war inzwischen von Marburg nach Berlin gewechselt und hatte dort Philosophie zu studieren begonnen – eine Einladung von Carl Schmitt erhielt, ihn in Plettenberg zu besuchen. Für die Übernachtung in einem Dorfgasthaus hatte er gesorgt. Ich sollte ihn nachmittags und abends in seinem Haus aufsuchen, mit Abendessen und Wein, und am nächsten Vormittag noch einmal vorbeikommen. Er wollte mich dann zum Bahnhof fahren lassen. Das tat er auch und begleitete mich.
Carl Schmitt war ein großzügiger, unkomplizierter Gastgeber und widmete mir die ganze Zeit meines Besuchs in Plettenberg. Ich wußte mittlerweile eine Menge über den Staats- und Verfassungsrechtler, der schon in den zwanziger Jahren einen großen Ruf hatte und nach 1933 dem nationalsozialistischen Regime diente. Nach einem Angriff im »Schwarzen Korps« im Jahre 1936 verlor er seine Parteiämter. Er zog sich vom Staatsrecht zurück und lehrte und publizierte auf dem Gebiet des Völkerrechts. Sein Buch »Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum«, das 1950 erschien, war aus Vorlesungen und Seminaren zu Beginn der vierziger Jahre hervorgegangen, und auch »Land und Meer« war 1942 zuerst veröffentlicht worden.
Ich wäre damals nicht nach Plettenberg gefahren, wenn ich erwartet hätte, mit nationalsozialistischen Apologien konfrontiert zu werden. Es gehört zu den irrigen Ansichten über jene Jahre, daß man damals in dieser Hinsicht weniger wach gewesen sei als später, besonders nach 1968. Das Gegenteil trifft wahrscheinlich zu. Wer zwischen Ruinen aufgewachsen war, mit vier Jahren den Vater zum ersten Mal gesehen hatte, als er aus der englischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrte – »Da bist du ja endlich!« –, wer den Bemerkungen über Unbelehrbare gelauscht hatte, konnte als Zwanzigjähriger sich zutrauen, daß er Nostalgie für das untergegangene Reich sofort bemerken würde. Die Gewißheit, daß Carl Schmitt seinem nationalsozialistischen Engagement keineswegs nachhing, ist mir seit dieser Begegnung geblieben. Mehr noch, daß er von seiner geistigen Herkunft und seinen intellektuellen Loyalitäten her keine substantiellen Beziehungen zum Nationalsozialismus hatte. Seine Affinität zum reaktionären Denken hatte ihre Wurzeln im neunzehnten Jahrhundert, im Kulturkampf und im Frankreich der Dreyfuskrise. Léon Bloy war der Kopf, zu dem er über die Jahre immer wieder eine besondere Affinität bekundete.
In seiner mit Büchern vollgestopften Bibliothek ließ er sich von einem vielleicht zufälligen, aber traumwandlerisch sicheren Griff zu Büchern leiten, von denen er annahm, daß sie mich in ein Gespräch ziehen könnten. Wie konnte er, als er Lucien Goldmanns Buch über Racine, »Le Dieu caché« herauszog, wissen, daß der französische Literatursoziologe, ein führender Kopf der Linken, mir nicht unbekannt war? Woher wußte Schmitt, daß der Kunsthistoriker Erwin Panofsky einer meiner Lieblingsautoren war? Auf wundersame Weise zog er dessen jüngste Publikation, »Pandora’s Box«, aus einem Bücherstapel hervor. Panofsky, der von seinen Freunden »Pan« genannt wurde, hatte es zusammen mit seiner Frau Dora geschrieben, nicht zuletzt um des Effekts willen, der sich aus der Verbindung ihrer beiden Namen in dem mythischen Namen »Pandora« ergab. Carl Schmitt erledigte nun dieses so gelehrt wirkende Buch als ein oberflächliches Spiel mit einem großen mythischen Thema. Mit wenigen Sätzen hatte er einen meiner akademischen Heroen demontiert.
Woher schließlich konnte Carl Schmitt von meiner intensiven Beschäftigung mit Walter Benjamin wissen? Durch den Band »Illuminationen« hatte ich ihn zuerst kennengelernt, und die beiden von Friedrich Podzus herausgegebenen Bände der »Schriften« hatte ich mir damals aus der Universitätsbibliothek entliehen und Aufsatz für Aufsatz studiert. Nun trat ein anderer Benjamin hervor. Carl Schmitt erwähnte den Brief, den Benjamin ihm 1930 über seine Abhandlung »Politische Theologie« geschrieben hatte und der heute in der Ausgabe der Briefe Benjamins nachzulesen ist, nachdem er von deren Herausgebern zunächst unterschlagen worden war. Für mich war die Erwähnung des Kontaktes zwischen Benjamin und Carl Schmitt eine aufregende Neuigkeit. Carl Schmitt sprach mit großer Hochachtung von Benjamins ästhetischen Forschungen. In seinen Augen war Benjamin weder Marxist noch Materialist, vielmehr stand seine intensive Beziehung zur Romantik und zum Mythos im Vordergrund.
Was mich bei dem Besuch bei Carl Schmitt am meisten beeindruckte, mindestens ebenso stark wie die instinktive Sicherheit, mit der der alte Herr das Gespräch auf Themen brachte, die auf mich wirkten, als hätte er meine geheimen Vorlieben erraten, war seine Fähigkeit zuzuhören. Er wußte sicher, daß junge Menschen am leichtesten zu fassen sind, wenn man sie für voll nimmt, also genau darauf hört, was sie sagen, und darauf antwortet. Da war, wie mir nicht verborgen bleiben konnte und sich wenige Jahre später weltweit zeigen sollte, ein Mann, dessen Ruhm noch längst nicht ausgeschöpft war, der darauf wartete, daß die Dinge sich zurechtrückten und er den Platz einnehmen würde, der ihm zustand. Diese Erwartung, die den ungeheuer ehrgeizigen Mann bis in alle Fasern durchdrungen haben mochte, war es wohl auch, die ihn auf so einzigartige Weise aufmerksam sein ließ und zu einem Zuhörer machte, wie ich noch keinen erlebt hatte und auch später nicht erlebte. Denn der junge Mann, dem er aufmerksam zuhörte, war ein Gefäß jenes Nachruhms, auf den er zuversichtlich hoffte.
Aus den Notizen, die ich mir nach meinem Besuch bei Carl Schmitt machte – sie beginnen am 2. Januar 1964 –, ist nicht viel zu gewinnen. Es fiel mir nicht leicht, meine Eindrücke zu fixieren. Aber ich fühlte mich magisch berührt von Schmitts Art zu sehen, zu denken, fasziniert von der Spannung, die er zu erzeugen vermochte. So gewann das Gespräch eine lange nachwirkende Intensität. Einer seiner Sätze, der sich mir besonders einprägte, lautete: »Entfesselung ist nicht schwer.« Er könne sich die Kleider vom Leib reißen, sagte er mit einer heftigen Geste: »Dann bin ich nackt, das ist eher komisch: Der Mensch ist nicht nackt.«
Das waren unumstößliche Sätze. Wir waren die Treppe zum Obergeschoß hinaufgestiegen, wo der Tisch gedeckt war, und vor einem Bild des deutschen Romantikers Reinhardt stehengeblieben. Es stellte den Ausblick aus einem Hafen auf das offene Meer dar, ein Segelschiff fuhr hinaus. Ein Mädchen mit einer leuchtend roten Bluse hatte den Satz über die Entfesselung ausgelöst. Es »drohte«, wie Carl Schmitt sagte, mit Entfesselung. Aber der Maler beschränkte sich darauf, deren Möglichkeit anzudeuten. Erst viel später sei es zu dieser Explosion gekommen, bei Nolde zum Beispiel – gewiß ein großer Maler, aber doch einer, der die schon von früheren Malern angedeutete Möglichkeit lediglich vollstreckte. Wollte man begreifen, was geschah, dann müsse man, so Carl Schmitt, auf jene Maler zurückgehen, die vor der Lizenz zur Entfesselung gelebt hatten.
Es scheint im Gespräch eine Heidegger-Stimmung aufgekommen zu sein, der alte Herr rezitierte eine Gedichtzeile von Mörike, »die Magd am morgendlichen Herd«, und es fiel auch der Name Richard Wagner, wohl eine Erinnerung an seine Jugend, als er Klavier spielte, sich für Wagner begeisterte und bald auch in den »Bayreuther Blättern« publizierte.
Malerei war für ihn vor allem spanische Malerei – die Malerei des zweiten Weltreichs nach dem römischen. Welche Formen entwickelte die Kunst dieses Weltreichs nach seinem Ende? Es war kein Zufall, daß die große Malerei Spaniens am Ende zur Karikatur hin tendierte. War sie ihr Schicksal? Zwei große Namen mußten hier fallen, Goya und Manet, der nicht nur die spanische Malerei für sich entdeckte, sondern dessen »Erschießung Kaiser Maximilians« Spanien sogar direkt betraf. Zu seinen Bildern meinte Carl Schmitt, sie nähmen sich neben der Malerei Goyas wie Stilleben aus.
Es konnte schließlich nicht ausbleiben, daß die Rede auch auf den spanischen Schelmenroman kam und auf die Gestalt des Picaro, auf Quevedos abenteuerlichen Buscón. Was ist der Picaro? Carl Schmitts Antwort auf diese Frage bediente eines seiner ältesten Ressentiments: Thomas Mann ist der Picaro. Das sollte wohl heißen, daß das Schicksal einer Welt, die die Geschichte verloren hat, von Spanien nach Deutschland gewandert sei.
Schmitts Bemerkungen zur Malerei waren obsessiv an die Frage »Woher?« fixiert. Woher kam diese lichtgebende Kerze bei Georges de la Tour, woher, sollte dies heißen, erhielt sie ihre Bedeutung? Ein parodistisches Element, bezogen auf die Bedeutungsobsession der Kunsthistoriker, war nicht zu überhören. Die Gewißheiten der Ästhetik waren ihm fragwürdig.
Natürlich war auch von Theodor Däubler die Rede. Wie man aus vielen Briefen und Gesprächsberichten weiß, gehörte der Dichter zum eisernen Bestand der Gesprächsthemen Carl Schmitts. Er benutzte ihn als eine Art Lackmustest. Wer auf Däubler ansprach, wurde als Gesprächspartner willkommen geheißen. Die dramatische Geschichte der Freundschaft des jungen Rechtswissenschaftlers Carl Schmitt mit dem avantgardistischen Poeten der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war mir damals noch nicht bekannt. Die Broschüre, die er über Däubler geschrieben hatte, lernte ich erst später kennen. Sie war ihm jetzt wieder wichtig geworden und diente ihm als Beleg für die Ungerechtigkeit der Epoche, die den großen Dichter vergessen hatte.
Däubler war in diesen späten Jahren zum Raumdichter geworden, wie Carl Schmitt selbst, der um den Begriff des Raums etymologische Dichtungen wob. Ein Reclamheftchen mit Gedichten Theodor Däublers wurde mir für die Lektüre im Hotel übergeben. Nachdem ich das Heft spät abends noch durchgelesen hatte, waren es Zeilen wie »Die Libellen besorgen den Schwebeverkehr« oder »Ein Nachen begleitet die einsame Stunde«, die meine stärkste Sympathie fanden. Däubler dichtete in seinem großen Versepos »Das Nordlicht«, mit dem er bei dem Publikum kein Echo gefunden hatte, nicht nur in ausgreifenden Raumvisionen, sondern war auch phonetisch in die Raumwelten vorgedrungen, in denen sich der späte Carl Schmitt bewegte, indem er seinen Untersuchungen über Leistungsräume, politische Raumordnungen und wie seine Neuprägungen noch heißen mochten, ein sprachliches Fundament geben wollte.
Es war an dieser Stelle, nach den Ritualen der Anwerbung, fast zwingend, daß Carl Schmitt mir die Festschrift für Wilhelm Ahlmann, in die Hand drückte. Es handelte sich um den »Tymbos für Wilhelm Ahlmann«, die Gedenkschrift für einen Freund, der als junger Mann 1915 erblindet war, mit einem Beitrag zur Blindenpsychologie promoviert worden war und nach 1933 im Preußischen Kultusministerium tätig war. In nähere Verbindung zum Widerstand getreten und mit Jens Jessen befreundet, nahm er sich 1944 das Leben. Carl Schmitt begab sich gleichsam in den Schutz dieser Freundschaft mit einem Mann, der die Probe der Zeit bestanden hatte. Es war auch insofern genau erwogen, wenn er in dieser Festschrift seinen ersten Aufsatz über die Frage des »Nomos« veröffentlichte, die auf einer neuen, tieferen Ebene ansetzte.
In ästhetischen Reflexionen war ich damals so geübt, daß meine Notizen gerade in diesen Passagen am ausführlichsten, leider aber auch am wenigsten verständlich sind. Was mir einst völlig vertraut war, macht mich heute ungeduldig. Mein Gesprächspartner ließ den Ästhetiker, der sich auf sicherem Terrain wähnte, aber offenbar gewähren. Listig flocht er Aperçus ein, die zur Ernüchterung beitragen sollten. Über Hegels Ästhetik, meinte er, sage die Tatsache, daß Rossini für ihn ebenso wie für seinen erbitterten Gegner Schopenhauer die Erfüllung der Musik war, mehr als alle philosophische Interpretation: jenseits der Heiterkeit das Nirwana der Töne. Dieses Nirwana verband die verfeindeten Philosophien!
Zu Carl Schmitts Umkreis gehörten Rüdiger Altmann und Johannes Gross, die in der Studentenzeitung »Civis« mehrere Gedichte von ihm unter dem Pseudonym Erich Strauß veröffentlicht hatten. Auch in ihren eigenen Aufsätzen griffen sie freizügig auf seine Gedanken zurück, die sie, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, in die studentische Diskussion einbrachten, ohne ihre Herkunft zu erkennen zu geben. Carl Schmitt billigte dieses Vorgehen offenbar. Er schenkte mir die unter dem Titel »Die neue Gesellschaft« erschienene Sammlung von Aufsätzen und Glossen von Altmann und Gross, die auch einige der Gedichte von Erich Strauß enthielt. Am bekanntesten wurde im Lauf der Jahre die drei Seiten lange »Ballade vom reinen Sein« mit der Überschrift »Die Substanz und das Subjekt«. Sie beginnt so: »Die Substanz und das Subjekt / Liegen müßig hingestreckt. / Die Substanz kaut an der Prosa / Eines Benedikt Spinosa / Das Subjekt liest nur noch Hegel / Und benimmt sich wie ein Flegel / Jeder hofft den jeweils Andern / Mit sich selbst zu unterwandern.«
Am meisten beeindruckte mich damals, wie umfassend Carl Schmitt über aktuelle Entwicklungen informiert war. Er mußte ein ganzes Netz von Informanten gehabt haben, die ihn intellektuell auf dem laufenden hielten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien und Frankreich. Er war mit den erstaunlichsten Neuerscheinungen versorgt, von denen er vieles zur Kenntnis nahm, so daß er die darin formulierten Thesen im einen oder andern Fall ins Gespräch einflechten konnte. So saß offenbar im Deutschen Taschenbuchverlag jemand, der ihn regelmäßig über die neueste Produktion in Kenntnis setzte. Wie ich später erfuhr, war es der Chef Heinz Friedrich selbst, der Carl Schmitt schickte, was ihm in Frage zu kommen schien.
So war nicht verwunderlich, daß wir manche frische Lektüre teilten, etwa die der soeben erschienenen Tagebücher von Cesare Pavese. Schmitt zeigte sich von diesem stark beeindruckt, seine Bemerkungen verrieten eingehende, ja intensive Beschäftigung. So erwähnte er Paveses Ansicht, daß Shakespeares Drama aus dem Dialog lebe, nicht aus der Handlung. Das gehörte in den Zusammenhang von Benjamins Trauerspielbuch und Schmitts Antwort in »Hamlet oder Hekuba«.
Wenn ich mir heute darüber klarzuwerden versuche, welchen Eindruck der bald achtzigjährige Carl Schmitt auf mich machte, dann war es wohl vor allem die Mischung von altmodischer Höflichkeit und anarchischer Freiheit im Gespräch. Er wirkte nicht wie ein Professor, sondern wie ein Künstler, der ein uferloses Werk erläutert. Ich wunderte mich, wie jemand, der doch zweifellos ein Gelehrter alten Stils war, so vielseitig interessiert sein konnte und überall originelle Gesichtspunkte ins Spiel brachte. Dadurch entstand das Gefühl der existentiellen Wichtigkeit geistiger Gegenstände. Alles konnte jederzeit von neuem erschlossen werden und völlig neue Ansichten freigeben.
Die gutmütigen, blauen Augen des alten Mannes verscheuchten dabei jeden Eindruck des Unheimlichen oder Dämonischen. Seine Beweglichkeit verblüffte mich. Zu allem schien er sofort Zugang zu finden, nie ging er schematisch vor. Er setzte die gleiche Unabhängigkeit des Urteils auch bei seinem Gesprächspartner voraus, vor allem aber die Überzeugung, daß es sich nicht um spannungslose Themen handelte, sondern um Fragen, die ihre eigene Brisanz hatten. Sein intellektuelles Abenteurertum schien kaum nachgelassen zu haben, auch wenn eine gewisse Erschöpfung zu bemerken war. Er wirkte wie ein von einer Irrfahrt zurückgekehrter Abenteurer, der nun ohne Rechthaberei in seinen gesicherten Überzeugungen lebte. Er hatte mit aller Kraft die Integrität seiner Schriften verteidigt, nicht nur die der Zeit vor 1933, sondern auch der ungleich angreifbareren aus den Jahren danach, vor allem die über den »Leviathan«. Er suchte junge Leute an sich zu binden, die seine Absichten richtig deuteten und in die Situation der Nachkriegsuniversität zu übersetzen imstande waren. Hinzugekommen waren Arbeiten, in denen er die aktuelle Lage zu interpretieren versuchte, in seinem Stil und auf der Grundlage seines Werkes, das allmählich wieder zugänglich zu werden begann.
»Haben wir ein Thema?« lautete die berühmte und gefürchtete Eingangsfrage an seine Besucher. Er hatte jedenfalls ein Thema, und neuerdings hatte er sogar eines, das mitten ins Weltgeschehen eingriff. Seine Abhandlung über den Partisanen war gerade erschienen, er meldete sich mit ihr zurück. Die Positionen von Mao oder seinem General Giap, von Castro und Che Guevara waren ihm in den zugänglichen Ausgaben bekannt, und natürlich war ihm die europäische Genealogie des Partisanenkampfes seit der napoleonischen Zeit vertraut. Nicht nur war er besser informiert als die meisten, er glaubte darüber hinaus einen Schlüssel zur aktuellen Weltlage in Händen zu halten.
Das alles war der sehr weitgehenden Isolierung in einem Nest des Sauerlandes geschuldet. Er versuchte seine Themen einzukreisen und bemühte sich, sie zusammenzuhalten. Anders als Akademiker, die sich auf die Diskussionen in ihrem Fach verlassen, war er darauf angewiesen, seinen Fragen ein Maximum an konkreter Evidenz mitzuteilen. Sie konnten nur als Fragen und Thesen Carl Schmitts, unverwechselbar mit anderem, in die Welt gehen. Er strebte für sich nach einer gewissen geistigen Schlüsselgewalt, die ein Gegengewicht für seine Angreifbarkeit bot.
Das Bild des Schlüssels paßt zur Physiognomie des clerc, und zweifellos hatte er etwas von einem französischen Weltgeistlichen. Seine verhängnisvolle deutsche Biographie macht seine französischen Wurzeln leicht vergessen. Carl Schmitts Mutter war Französin, er war mit ihrer Sprache aufgewachsen, er sprach und schrieb fließend Französisch, die stärksten Elemente seines geistigen Gepräges stammten aus Frankreich. Französisch war auch die Mischung aus Bäuerlichkeit – seine Vorfahren stammten aus den Weingegenden der Mosel – und Intellektualität, wie man sie beim französischen Geistlichen antreffen mag. Vor allem war es der Rationalismus der französischen Juristen des siebzehnten Jahrhunderts, der ihn geprägt hatte. Sein Leben lang hatte er entscheidende intellektuelle Impulse aus Frankreich aufgenommen.
Carl Schmitts Denkstil war lateinisch und französisch, er gehörte auch in seiner Lebensauffassung eher zur romanischen Welt. Es ist auffallend, daß die wenigen bedeutenden Köpfe seiner Generation, die in den Sog des Nationalsozialismus gerieten, alle eine starke Beziehung zu Frankreich hatten. Das ist der Fall bei Friedrich Sieburg, dem das Kunststück gelang, ein Buch über Frankreich und die Franzosen zu schreiben, in dem diese sich zweifellos wiedererkennen konnten – nicht zuletzt in der französischen Übersetzung des deutschen Titels »Gott in Frankreich?«, der lautete: »Dieu est-il français?« Kaum anders ist es bei Ernst Jünger, der in der französischen Literatur mehr zu Hause war als in der deutschen und der in Frankreich ein größeres Ansehen erlangte als in Deutschland. Trotz seiner Zugehörigkeit zur Besatzungsarmee rechneten die Franzosen ihn zu ihrer Literatur. Das ist zwar bei Gottfried Benn nie der Fall gewesen, vielleicht wegen seiner schon früh ausgeprägten germanischen Attitüde, aber auch Benn hatte eine französische Mutter und einen Heidenrespekt vor allem Romanischen. Schließlich kann man auch Heidegger nennen, der zwar keinen originären biographischen Zugang zu Frankreich hatte, aber von dem einzigartigen Echo, das seine Philosophie in Frankreich fand, gleichsam eingemeindet wurde.
Es mag sein, daß in allen diesen Fällen die französische Tradition der Staatlichkeit, die Staatsräson, auf die politischen Orientierungen dieser frankreichnahen Autoren sich ausgewirkt hat. Bei Carl Schmitt scheint dies der Fall gewesen zu sein. Denn in Frankreich hatte das Jus publicum Europaeum seine klassische Ausprägung erfahren. Damit war es zum idealen Bezugspunkt für alle Auseinandersetzung mit der modernen Staatlichkeit geworden. Die Bewunderung des Staats und die Feindschaft gegenüber Staat und Staatlichkeit liegen in der deutsch-französischen Herkunft Carl Schmitts nahe beieinander. Daraus ergeben sich besondere Einsichten wie Irrtümer.
Nach meinem Besuch in Plettenberg begann ich, von Carl Schmitt alles zu lesen, was ich erreichen konnte. Nach der Lektüre des Partisanenbuches bestellte ich den dort mehrfach zitierten Band der Gesammelten Werke Maos bei der Foreign Language Press in Peking. Es war wohl das erste Buch, das die Berliner Buchhandlung Marga Schoeller direkt aus Peking besorgte, ein paar Jahre bevor es Mode wurde, die Worte des Großen Vorsitzenden zu zitieren.