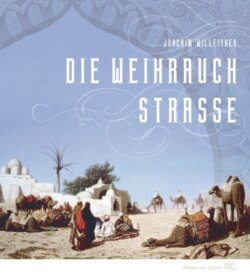Читать книгу Die Weihrauchstraße - Joachim Willeitner - Страница 11
Das Weihrauchland Punt
ОглавлениеEines der populärsten Beispiele für den frühen Fernhandel mit dem wertvollen Baumharz – wenn auch nicht das früheste Ereignis seiner Art – stellt zweifelsohne die Fahrt dar, welche zur Zeit der Pharaonen des Neuen Reiches die Königin Hatschepsut (ca. 1479–1457 v. Chr.) in ihrem neunten Regierungsjahr mit fünf Schiffen in das legendäre Gold- und Weihrauchland Punt – das »Gottesland«, wie es in altägyptischen Hieroglyphentexten genannt wird – entsandte. Der spektakulären Expedition widmete sie einen ausführlichen Reliefzyklus in ihrem Totentempel im Talkessel von Deir al-Bahari gegenüber der alten Reichshauptstadt Theben. Diesen detaillierten Darstellungen an den Wänden des terrassenförmigen Heiligtums auf dem Westufer des Nils verdankt man bislang die genaueste Kenntnis vom Aussehen der kleinen ägyptischen Flotte, die entlang der Küste des Roten Meeres nach Süden segelte. Zudem zeigen sie die Zustände, die das ägyptische Expeditionskorps unter Leitung des Kanzlers und Schatzhausvorstehers Nehesi am Reiseziel antraf.
Dort angekommen tauschten die Ägypter – den Gepflogenheiten der europäischen Kolonialmächte gegenüber den Entwicklungsländern in jüngerer Vergangenheit nicht unähnlich – mitgebrachte Glasperlen und Bronzewerkzeuge gegen Weihrauch oder Myrrhe und Gold ein. Es wurden sogar 31 komplette Weihrauchbäume mitsamt ihren Wurzelballen an Bord gebracht, und zwar in Pflanzkörben, die jeweils von mehreren Männern mit Tragestangen transportiert werden mussten. In den Beischriften heißt es: »Grünende Weihrauchbäume, 31 Stück, herbeigeführt unter den Kostbarkeiten für die Majestät des Gottes Amun, des Herrn der irdischen Throne. Niemals ist ähnliches gesehen worden seit der Erschaffung der Welt.« und: »Das Beladen der Transportschiffe mit einer großen Menge von herrlichen Produkten Arabiens, mit allerlei kostbaren Hölzern des Gotteslandes, mit Haufen von Weihrauchharz, mit grünen Weihrauchbäumen … Niemals ist gemacht worden ein Transport gleich diesem von irgendeinem Herrscher seit Erschaffung der Welt.« Die exotischen Gewächse wurden zwar in Deir al-Bahari beidseitig des Aufwegs, der zum Terrassentempel der Königin führte, eingepflanzt, dürften aber wegen ihrer hohen Ansprüche in ihrer neuen Heimat nicht lange überlebt haben, da im Niltal weder die Bodenqualität noch die klimatischen Verhältnisse stimmten. Immerhin sind heute die alten Pflanzgruben – nach Ausgrabungen und Restaurierungen an dem Heiligtum – wieder als runde eingefasste Löcher sichtbar.
Populär geworden ist die Darstellung der – möglicherweise an einer Stoffwechselkrankheit leidenden – dickleibigen Königin von Punt, welche gemeinsam mit ihrem offensichtlich normalgewichtigen Gatten die pharaonischen Ankömmlinge empfängt. Ihre Untertanen bewohnten Hütten, die auf Pfählen standen und über Leitern erreichbar waren, sie verwendeten Esel als Tragetiere für Lasten und hielten Rinder mit kurzen Hörnern als Haustiere. Bei der Vegetation des Landes nahmen offensichtlich Palmen die wichtigste Rolle ein. In der Takelage der ägyptischen Schiffe kletterten Mantelpaviane herum, die einen bergigen oder zumindest felsenreichen Lebensraum benötigen; doch es wird im Widerspruch dazu auch eine Giraffe wiedergegeben, die nur in flachen Savannengebieten lebt. Obwohl auch die Meeresfauna von Punt so detailliert abgebildet wurde, dass zum Teil eine exakte zoologische Bestimmung der dargestellten Fische und Schalentiere möglich ist, lässt sich nicht eindeutig klären, ob sich das Weihrauchland nun auf der arabischen oder der afrikanischen Seite des Bab el-Mandeb befunden hat, ob es also im Jemen oder im heutigen Somalia zu lokalisieren ist. In beiden Regionen gedeiht zwar Weihrauch – wenn auch nicht an der Küste, so doch jeweils im dahinter liegenden Bergland –, doch sind bislang in keiner der beiden infrage kommenden Gegenden Goldvorkommen in abbauwürdigen Mengen aufgefunden worden, geschweige denn antike Abbauoder Verhüttungsreste dieses Edelmetalls.
In die Diskussion ist kürzlich ein Kompromissvorschlag eingebracht worden, der vermeintliche Schreibfehler der pharaonenzeitlichen Beamten ernst nimmt. Die semitischen Sprachen kennen neben Singular und Plural für Paare oder doppelte Gegenstände eine eigene grammatikalische Form, den Dual. Dessen Endung »-ui« wird in der Hieroglyphenschrift zumeist durch zwei benachbarte kurze Striche geschrieben, und einer der »wichtigsten« Fälle für dessen Anwendung war, als Bestandteil der Königstitulatur, die Benennung des Herrschers als »Herr der beiden Länder« Unter- und Oberägypten. Nachdem diese Dualstriche nun auch in mindestens zwei Texten unter der »Land«-Hieroglyphe »ta« (t3) (einem waagrechten Strich) auftauchen, in denen vom »Gottesland« Punt die Rede ist, sodass man eigentlich wörtlich »die beiden Gottesländer« übersetzen müsste, hielt man dies bislang für ein Versehen der Schreiber, die aus alter Gewohnheit vom »Herrn beider Länder« gedankenlos die hier unsinnige Dualschreibung verwendeten. Doch warum soll man den vermeintlichen Irrtum nicht doch wörtlich nehmen, sodass Punt sowohl auf der östlichen wie auch auf der westlichen Seite des Roten Meeres zu lokalisieren wäre?
Die Hieroglyphentexte an den Tempelwänden von Deir al-Bahari berichten davon, dass Hatschepsut in der Planungsphase ihrer Unternehmung alle alten Tempelakten nach Angaben über das Zielland Punt durchforsten ließ, weil angeblich die Kenntnis von dessen Lage zwischenzeitlich verloren gegangen war und deswegen schon lange keine Fahrten mehr dorthin stattgefunden hatten. Dem widersprechen jedoch die zahlreichen Erwähnungen des »Gotteslandes« in anderen Quellen seit dem Alten Reich, die belegen, dass Punt immer im Bewusstsein der alten Ägypter präsent war. Die zeitgenössischen ägyptischen Berichte reichen bislang bis in die frühe 5. Dynastie zurück. Damals bezog Pharao Sahure (ca. 2458–2446 v. Chr.), wie dem heute in Palermo aufbewahrten Fragment eines Annalensteins zu entnehmen ist, in seinem 13. Regierungsjahr Myrrhe und Elektron, eine Gold-Silber-Legierung, aus Punt. Dieser kurze und nüchterne Textbeleg ist 2002 und 2003 auf spektakuläre Weise um bildliche Darstellungen erweitert worden, als die ägyptische Altertümerverwaltung unter Leitung von Tarek al-Awady Ausgrabungen am Aufweg zur Pyramide des Sahure in Abusir zwischen Giza und Saqqara durchführte. Wie bei all diesen Prozessionswegen zwischen dem Taltempel am Fruchtlandrand und dem Verehrungstempel am Fuß der königlichen Pyramide üblich, war auch derjenige im Grabkomplex des Sahure mit Reliefquadern dekoriert. Zwei dieser monumentalen Blöcke von je rund 1,8 m Höhe, 2,2 m Breite und 70 cm Dicke, die bei diesen Ausgrabungen wiederentdeckt wurden, zeigen in mehreren übereinander liegenden Reliefbänder Szenen in Zusammenhang mit dieser Punt-Expedition: Den Bildern, die die erfolgreiche Rückkehr der Expeditionsflotte zum Thema haben, ist zu entnehmen, dass auf den ägyptischen Schiffen auch ganze Familien aus Punt einschließlich ihrer Kinder nach Ägypten mitgekommen waren, die ebenso wie die Ägypter selbst dem Pharao beim Einlaufen der Schiffe zujubeln. Auf einem weiteren Block wird die Sockelzone von zwei Reihen von mindestens fünf aus Punt zurückkehrenden Schiffen, auf deren umgeklappten Mastbäumen jeweils von dort mitgebrachte Meerkatzen herumklettern, eingenommen. Im großen Bildfeld darüber ist Sahure zu sehen, der, begleitet von seinem Hofstaat sowie seiner Mutter Neferhetepes und seiner Gemahlin Meretnebti, mit einem dechselähnlichen Werkzeug den Stamm eines importierten Myrrhestrauches, der vor ihm in einem Pflanzgefäß aufgestellt ist, einritzt, damit das kostbare Baumharz austritt. Am erhalten gebliebenen Rand der Szene sind gerade noch die ausgestreckten Arme eines knienden Mannes zu sehen, der die herabtropfenden Harzstückchen auffängt. Auf einem anderen Quader wird ein Bankett am Königshof gezeigt, in dessen Verlauf Sahure seiner Mutter Neferhetepes das gewonnene aromareiche Baumharz aus Punt zum Geschenk macht. Bei Königin Hatschepsut sollte später ihr angeblicher göttlicher Vater, der damalige Reichsgott Amun, Empfänger der Gaben aus Punt werden.
Von einer weiteren Punt-Expedition, mit einem Aufgebot von rund 3000 Mann, und zwar am 3. Tag des 1. Monats der Schemu-Jahreszeit im 8. Regierungsjahr von Pharao Mentuhotep III. (ca. 1957–1945 v. Chr.) kündet die Inschrift M 114 im Wadi Hammamat, dem Trockental in der ägyptischen Ostwüste, das Koptos im Niltal mit Qusseir am Roten Meer verbindet. Den Hieroglyphentext hat der Expeditionsleiter Chenenu an den Wänden der dortigen Grauwacke-Steinbrüche hinterlassen. Er listet dort für seinen Hinweg ans Rote Meer die Brunnenstationen Bat (B3t), Idaht (Jd3ht) und Jahteb (J3htb) auf, die sich allerdings nicht lokalisieren lassen. Auf dem Rückweg seiner offensichtlich erfolgreichen Mission ließ er von den Felswänden des Wadis Blöcke für Statuen brechen.
Da Hatschepsut in ihrem Expeditionsbericht ausdrücklich erwähnt, dass ihre Schiffe mit den wertvollen Gütern in Theben anlandeten, hielt sich die (falsche) Vorstellung, die Königin hätte einen künstlichen Wasserweg zwischen dem Niltal und dem Roten Meer, mithin also den ältesten antiken Vorläufer des Suezkanals, anlegen lassen. In Wirklichkeit wurden die seetüchtigen Schiffe – deren Holz, nämlich Zedern, zuvor aus dem Libanon importiert worden war – zwar in Theben zusammengebaut; jedoch wenig weiter im Norden, in Koptos – wenn sie nicht ohnehin erst in den dortigen Werften hergestellt worden waren –, wurden sie bereits wieder zerlegt und auf dem Landweg durch das Wadi Hammamat, über eine Distanz von rund 175 km, die mit Eselskarawanen in rund zehn Tagen bewältigt wurde, an die Küste und, dort angekommen, offensichtlich noch ein gutes Stück nach Norden transportiert. Dort fügte man die Einzelteile wieder zusammen. Das Verfrachten der Schiffe auf dem Landweg wurde durch deren leichte Zerlegbarkeit erleichtert, da die alten Ägypter die Planken nicht mit Metallnägeln fixierten, sondern mit Tauen zusammenbanden.
Den ägyptischen Hafen am Roten Meer, wo der erneute Zusammenbau stattfand und von dem aus die Handelsflotte nach Süden segelte, hatte der ägyptische Archäologe Abdel Moneim Sayed von der Universität Alexandria bereits 1976/77 beim heutigen Marsa Gawasis (»Hafen der Erkundungsboote«) wiederentdeckt und teilweise ausgegraben. Der etwa 550 mal 250 m große Fundplatz – am nördlichen Ende des Wadi Gawasis, rund 25 km südlich von Safaga und 50 km nördlich von Qusseir gelegen – erstreckt sich am Fuß und auf der flachen Erhebung einer fossilen Korallenterrasse. Dort ist er durch das Tal des Wadi Gawasis im Süden, einen breiten Sandstreifen im Westen und die Küstenlinie im Osten begrenzt. Wie weit sich diese seit der pharaonischen Zeit geändert hat, konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden. Mitten durch das Gelände verläuft eine Eisenbahnlinie, deren Bau die archäologischen Reste in Mitleidenschaft gezogen hat.
Am Ostrand dieser Korallenterrasse nahe der heutigen Küstenlinie stieß Sayed auf eine annähernd ovale Plattform, die mit über 700 Seemuscheln bedeckt war und bei der es sich, wenn man den Befund kultisch deutet, um einen Zeremonialplatz der Seefahrer handeln könnte.
Die beschrifteten Stelen und Ostraka, die Sayed damals entdeckte und die nicht nur Punt und Bia-Punt (»Klein-Punt«) erwähnen, sondern auch den pharaonenzeitlichen Namen des Hafenplatzes, nämlich Sawu, nennen, stammten jedoch ausschließlich aus der Periode des Mittleren Reiches (ca. 2050–1800 v. Chr.), in der ebenfalls Fahrten nach Punt stattfanden. Für die Nutzung des Hafens im Neuen Reich und insbesondere zur Zeit der Hatschepsut gab es seinerzeit keine Hinweise.
Die fand nun ein Team der Universität Neapel »L’Orientale« (UNO) und des Italienischen Instituts für Afrika und den Orient (IsIAO) in Rom unter Leitung von Rodolfo Fattovich sowie der Universität Boston unter Kathryn Bard, welches die Ausgrabungen an dem Hafenplatz im Jahr 2001 wieder aufgenommen hatte. Anfänglich gruben die Archäologen im Westhang der Korallenterrasse neben Siedlungsresten mit halb in den Boden eingetieften Hütten ein »Industriegebiet« aus, in dem zahlreiche Fragmente von Luftdüsen aus Keramik zutage traten, die von Blasebälgen für Metallschmelzöfen stammten, genauer gesagt von einer Kupferverhüttung, wie daneben aufgefundene Erzbrocken und Schlackereste belegten. Auch diese Relikte stammten wiederum aus dem Mittleren Reich.
Am Weihnachtsabend des Jahres 2004 entdeckte Kathryn Bard an einer Klippe in Küstennähe den bis auf ein faustgroßes Loch verschütteten Eingang in eine große künstliche Höhle, der rasch freigelegt wurde. Nur zwei Tage später stieß sie in rund 30 m Entfernung unter Sandmassen auf das rechteckige Portal einer weiteren, ursprünglich natürlichen und von Menschenhand erweiterten Höhle, die über zwei Nebenkammern verfügte. Den Zugang hatte man unter Wiederverwendung von Kalksteinplatten ehemaliger Anker und Zedernholzbalken abgetakelter Schiffe abgestützt und danach mit Lehmziegeln und einer Verputzschicht ausgekleidet. In den Höhlen traten weitere Zedernbalken und -planken zutage, außerdem zwei komplett erhaltene gebogene Steuerruder aus demselben Holz, welche die bis dahin einzigen vollständigen Teile eines altägyptischen Seeschiffs repräsentierten. Außerdem hatte man hier weitere Anker aus Granit und Kalkstein – davon zwei komplett erhalten – deponiert, möglicherweise als Votivgaben für eine glückliche Heimkehr, daneben aber auch sonstiges Schiffszubehör wie Taue, in die teils sogar noch Seemannsknoten geschlungen waren. Auch anderes organisches Material war nicht verrottet, wie eine Holzschale und eine Flechtwerktasche. Zwar stammen all diese Relikte, was auch naturwissenschaftliche Untersuchungen bestätigt haben, aus dem Mittleren Reich, doch gab es daneben Funde von Keramik aus dem 15. Jahrhundert v. Chr, der Zeit, in der Hatschepsut ihre Expeditionsflotte nach Punt schickte.
Unstrittig ist die Funktion von Sawu als Hafen nach Punt auch deswegen, da unter den dort aufgefundenen 21 zumeist stark von Termitenfraß befallenen Holzkisten eine noch ihre Aufschrift »Kostbarkeiten aus Punt« erhalten hatte.
Die zweite, größere Höhle fungierte offensichtlich über einen langen Zeitraum als Kultstätte, denn in Eingangsnähe waren mehrere kleine Felsnischen ausgehöhlt, von denen vier noch Kalksteinstelen enthielten. Die besterhaltene davon nennt Details einer bislang nicht belegten, von Pharao Amenemhet III. im späten Mittleren Reich ausgesandten Expedition nach Punt und Bia-Punt unter Leitung von Nebsu und Amenhotep. Das Bildfeld der Stele trägt eine Darstellung des Fruchtbarkeitsgottes Min, der seinen Hauptkultort in Koptos hatte und dem, da von hier aus der wichtigste Karawanenweg ans Rote Meer seinen Anfang nahm, auch der Schutz der Ostwüste oblag.
Schon im 19. Jahrhundert hatten die beiden Ägyptologen Burton und Wilkinson in rund 7 km Entfernung von der Küste im Wadi Gawasis an einer römischen Wasserstation zwei dorthin verschleppte Stelen aus Basalt des Mittleren Reiches entdeckt, die von einer erfolgreichen Rückkehr aus Punt und der Anlandung in Sawu berichten. Beide Monumente, sowohl das (aus dem 28. Jahr Amenemhets II.) des Würdenträgers Wer-chenti-cheti, das ihn im Bildfeld vor Min von Koptos zeigt, als auch dasjenige (aus dem 1. Jahr Sesostris’ II.) des Kanzlers Chnumhotep, der vor dem Wüstengott Sopdu wiedergegeben ist, befinden sich heute im Museum der nordostenglischen Stadt Durham.
Auch das Gros der Keramikfunde von Marsa Gawasis stammt aus dem Mittleren Reich, allerdings gibt es daneben ältere Scherben aus dem späten Alten Reich, die für eine Nutzung des Hafens zu diesem früheren Zeitpunkt sprechen würden. Es sind jedoch auch Gefäßfragmente nubischen Ursprungs belegt. Diese im heutigen Nordsudan hergestellten Keramiken gehören teils der sogenannten »C-Gruppe« (ca. 2300–1500 v. Chr.), teils der »Kerma-Ware« (ca. 2500–1500 v. Chr.) – so benannt nach der Residenzstadt eines bedeutenden lokalen Königreichs unweit südlich des dritten Nilkataraktes – an. Es stellt sich damit die Frage, ob diese Stücke als »exotische« Gebrauchsgegenstände von Ägyptern aus dem Niltal an die Küste des Roten Meeres gebracht worden sind oder ob auch ein Teil des Nubienhandels nicht nur über das Niltal mit seinen Katarakten und über die Kette der Oasen in der Libyschen Westwüste, sondern auch über das Rote Meer abgewickelt wurde. Dies würde voraussetzen, dass man die für Ägypten bestimmten Produkte zuvor aus dem nubischen Niltal an die Küste des Roten Meeres gebracht hätte, um sie weiter im Norden wieder von dort zurück ins Niltal zu bringen. Bislang ist an der sudanesischen Küste kein entsprechender Hafenort ermittelt worden, doch darf man vermuten, dass die pharaonenzeitlichen Seeleute und Händler auch ohne ausgebaute Anlegestellen ausgekommen sind, indem sie die Schiffe einfach an geeigneten Stellen an Holzpflöcken oder Ähnlichem am Ufer vertäuten.
Dieser vermeintlich komplizierte Handelsweg über das Rote Meer ist nicht unwahrscheinlich, denn seit den letzten Jahren häufen sich die Hinweise darauf, dass es im alten Nubien nicht nur eine mehr oder minder parallel zum Niltal verlaufende Nord-Süd-Route ins pharaonische Ägypten gab, sondern auch eine Ost-West-Verbindung an die Küste und weiter über das Rote Meer hinweg an die südlichen Gestade der Arabischen Halbinsel. Denn 1996 stieß eine gemeinsame Expedition des Deutschen Archäologischen Instituts Sana’a und der Russischen Akademie der Wissenschaften in Sabir unmittelbar an der Verbindungsstraße zwischen Aden und Lahedj – in rund 40 km Entfernung von der erstgenannten Stadt – bei einer systematischen Prospektion der Küstenebene auf eine flache und weitläufige Erhebung im Gelände, die von antiken Scherben übersät war. Bereits an der Oberfläche des niedrigen Siedlungshügels konnten Keramikfragmente aufgelesen werden, die sich als zugehörig zu einer bis dahin noch unbekannten bronzezeitlichen Kultur aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. erwiesen, die jetzt nach dem beschriebenen Fundort im flachen Hinterland von Aden als »Sabir-Kultur« bezeichnet wird. Bedauerlicherweise spielte der Platz während des jemenitischen Bürgerkrieges von 1994 eine Rolle als Schlachtfeld bei der Eroberung von Aden, und da das Gelände auch heute noch über weite Passagen vermint ist, können die Archäologen nur auf kleinen geräumten Flächen ihrer Tätigkeit nachgehen.
Immerhin sind zwischenzeitlich unter dem Meer von Scherben die Grundmauern einer aus Lehmziegeln errichteten Ansiedlung freigelegt worden, deren Wohnbauten sich um ein zentrales Gebäude gruppieren. Seine Bauweise und seine Ausstattung machen die Deutung als Tempel wahrscheinlich. Die von den Archäologen in die zweite Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. datierten Baureste erbrachten zahlreiche Kleinfunde, unter denen Terrakottastatuetten hervorragen. Die Keramik erwies sich als besonders interessant, denn sie scheint Parallelen zu Töpferwaren von der gegenüberliegenden Seite des Roten Meeres – aus Äthiopien und Eritrea und wahrscheinlich sogar darüber hinaus aus dem heutigen Nordsudan, dem antiken Nubien – zu besitzen. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, inwiefern auch dieser südjemenitische Siedlungsplatz mit dem Land Punt in Zusammenhang steht.
Zu diesem Befund passt hervorragend, dass es sich bei einigen der in den Höhlen von Marsa Gawasis zutage getretenen Gefäßen allem Anschein nach wiederum um Importe aus dem Jemen handelt. Damit dürfte die Streitfrage, ob Punt auf der afrikanischen oder der arabischen Seite des Roten Meeres (in beiden Regionen wachsen die Boswelliasträucher, aus deren Harz Weihrauch gewonnen wird) zu suchen ist – die zugunsten der erstgenannten Möglichkeit entschieden schien – aufs Neue entfacht werden.
Für die nahe Zukunft ist geplant, das Gelände mit geophysikalischen Methoden, das heißt einem Bodenradar, auf weitere Höhlen absuchen, von denen mehrere, vielleicht mit noch spektakulärerem Inhalt, im Gelände vermutet werden.
Möglicherweise ist in der zweimaligen Nennung des Volkes der »Genbetju« in Hieroglyphentexten eine weitere Verbindung Ägyptens mit Südarabien gegeben. Diese Leute werden erstmals in den Annalen des Hatschepsut-Nachfolgers Thutmosis III. (ca. 1479–1426 v. Chr.) erwähnt und sollen ihm in seinem 32. Regierungsjahr durch eine Delegation Myrrhe dargebracht haben. Die Genbetju erscheinen dann nochmals in einer topografischen Liste Ramses’ II. (1279–1213 v. Chr.), in welcher Länder des Ostens, darunter auch erneut Punt, aufgezählt werden. Ihren Namen möchte man mit Vorfahren der »Geban« altsüdarabischer Inschriften bzw. der später unter anderem von Plinius als Bewohner Südarabiens genannten Gebbaniter bzw. Qatabaner in Verbindung bringen.