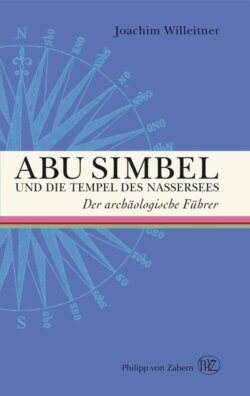Читать книгу Abu Simbel und die Tempel des Nassersees - Joachim Willeitner - Страница 10
ОглавлениеNubien im Wandel der Geschichte
Der Begriff „Nubien“, der heute für die Region südlich von Assuan und des ersten Kataraktes verwendet wird, erscheint erst spät in der Überlieferung, und zwar indirekt bei den antiken Historikern als griechisch „Nubai“ bzw. lateinisch „Nubae“ für die Bevölkerung dieser Gegend. Erstmals spricht im 3. Jh. v. Chr. Eratosthenes (ca. 284–202 v. Chr.) von ihnen, allerdings ist sein diesbezügliches Originalwerk verloren gegangen und man kennt seine Ausführungen nur als Zitat bei Strabo (17. I, 2–3.53). Der Begriff wird dann von Plinius (23/24–79 n. Chr.) in seiner „Naturgeschichte“ (VI.35) und von Ptolemaios in seiner „Geographie“ (IV.6,5; IV.7,10) erneut aufgegriffen. Dabei ist es verwirrend, dass die griechischen Autoren die Bewohner des Gebietes südlich des ersten Kataraktes „Aithiopen“ („Sonnenverbrannte“) nennen, womit man heute die Bevölkerung des modernen Staates Äthiopien – zwar gegenwärtig das östliche Nachbarland des Sudan, jedoch topographisch weit abseits von Nubien liegend – bezeichnet. Der Ländername „Sudan“ wiederum ist eine Verkürzung der arabischen Bezeichnung „Bilad al-Sudan“, „Land der Schwarzen“.
Der erste Nilkatarakt
Bevor der Nil einige Kilometer südlich von Esna die Kalksteinformation erreicht, in die er sich bis zu seiner Mündung ins Mittelmeer sein Bett eingegraben hat, durchfließt er das bis weit ins Innere des afrikanischen Kontinents hineinreichende Plateau des „Nubischen Sandsteins“, das sich in der Kreidezeit durch Sedimentablagerungen gebildet hat. Dessen horizontale Schichten werden immer wieder von magmatischem Tiefengestein durchbrochen, das seinen Weg an die Erdoberfläche gefunden hat und sich als Granitbarriere dem Nillauf entgegenstellt. Insgesamt sind es sechs solcher natürlicher Hindernisse zwischen der heutigen sudanesischen Landeshauptstadt Khartum, am Zusammenfluss von Weißem und Blauem Nil, und Assuan, der südlichsten Großstadt Ägyptens. Diese in pharaonischer Zeit qebechu (qbhw) oder mu bin (mw bjn, „böses Gewässer“) genannten, aufgrund ihrer Stromschnellen, unberechenbaren Strömungen und Untiefen kaum schiffbaren Abschnitte des Niltals hießen schon bei den antiken Autoren „Katarraktes“, was im heutigen Begriff „Katarakt“ weiterlebt. Diese natürlichen Barrieren wurden im Zug der allmählichen Expansion der Pharaonen nach Süden immer wieder als Reichsgrenzen genutzt und durch Befestigungsanlagen abgesichert. Entsprechend ihrer Entdeckungsgeschichte, die stromaufwärts erfolgte, werden die Katarakte von Norden nach Süden nummeriert, so dass die entsprechende Region südlich von Assuan als erster Katarakt zählt. Dieser erstreckt sich, beginnend mit der Insel Elephantine, über eine Länge von etwa 10 km nach Süden bis zur Insel Al-Hesa und schließt damit als weitere wichtige Inseln Sehel sowie Philae (bzw. Agilkia als neuer Standort der Tempel von Philae) mit ein. Seit der Nil durch die beiden Staudämme südlich von Assuan zurückgehalten wird und nur noch erheblich reduzierte Wassermengen diese Region durchfließen, fällt es schwer, sich das vormalige bedrohliche Chaos aus Granitfelsen, Stromschnellen, Wasserwirbeln und Untiefen, die eine ständig wechselnde Fließgeschwindigkeit des Nils verursachten, vorzustellen. Dieser von den alten Ägyptern euphemistisch als „enge südliche Türöffnung“ (r’ ’3 g3w rsj) bezeichnete Nildurchbruch bildete die natürliche Südgrenze des pharaonischen Kernlandes, und ab Assuan, dem „Haupt“ Ägyptens, begann stromabwärts die Zählung der 22 oberägyptischen Gaue bis zur Auffächerung des Nils in seine ehemals sieben Mündungsarme im Nildelta. Zwischen den Granitfelsen des ersten Kataraktes lokalisierte man in der Frühzeit die Nilquellen und hielt an dieser Vorstellung in der Mythologie auch dann noch fest, als längst feststand, dass der Fluss weiter im Süden seinen Ursprung hatte. Man verehrte dort weiterhin die Götter der Kataraktentriade, den widdergestaltigen Chnum und seine beiden Begleiterinnen Satis und Anukis, als Bringer des Nils. Selbst in griechisch-römischer Zeit wurde am Hadrianstor im Tempelbezirk der Göttin Isis auf der Insel Philae noch ein Relief angebracht, das den Nilgott Hapi inmitten der Kataraktenfelsen mit einem Gefäß zeigt, aus welchem der Nil herausquillt. Damit erhielten die lokalen Kataraktengottheiten Chnum, Satis und Anukis überregionale Bedeutung für ganz Ägypten als Urheber des Flusses und Verursacher der für die Landwirtschaft wichtigen alljährlichen Überflutungen.
Das „Zwölf-Meilen-Land“
Unmittelbar an das Kataraktengebiet von Assuan schloss sich stromaufwärts der Dodekaschoinos, das „Zwölf-Meilen-Land“, an. Diese Grenzregion zwischen Ägypten und Nubien verdankt ihren Namen der bereits von Herodot erwähnten Tatsache, dass sie – nach Auskunft ptolemäischer und römischer Tempelinschriften auf Philae und in Nubien, die von dem nubischen König Ergamenes (3. Jh. v. Chr.) bis zum römischen Kaiser Hadrian (117–138 n. Chr.) datieren – genau diese Ausdehnung von 12 iteru bzw. schoinoi besaß. Dabei galten als südliches Ende dieses Landstrichs wechselweise Maharraqa (das antike Hierasykaminos) 118 km südlich von Assuan oder die kleine Insel Takompso (heute Djerar) etwas nördlich davon. Letztere war bereits beim Bau des ersten Dammes von Assuan unter die Fluten des damaligen Stausees gekommen. In ihrem alten Namen Takompso dürfte sich ebenfalls eine Zahlenangabe erhalten haben, nämlich die „vier“, die in den drei nubischen Sprachfamilien „kamsu“, „kemso“ bzw. „kemsi“ ausgesprochen wird, und die darauf anspielt, dass man von Assuan aus, wie es bereits Herodot angibt, die Insel erst nach viertägigem Treideln erreichte.
Die Kultstätten des Mittleren und Neuen Reiches
Während des Mittleren und frühen Neuen Reiches sollten die in Nubien errichteten pharaonischen Tempelbauten in erster Linie den ägyptischen Beamten und Soldaten, die in dieser fern der Heimat gelegenen Region stationiert waren, die Möglichkeit bieten, weiterhin ihren gewohnten Gottheiten huldigen zu können. Deswegen befinden sich die meisten dieser Kultanlagen als freistehende Gebäude innerhalb der Grenzfestungen wie Buhen und Semna oder an Orten, die als Verwaltungszentrum, Handelsstützpunkt oder Warenumschlagplatz Bedeutung besaßen. Hierzu kann z.B. der thutmosidische Tempel von Amada gerechnet werden. Daneben gab es aber auch vereinzelte Felskapellen, wie diejenige, die Thutmosis III. in Ellesiye bei Qasr Ibrim oder später Haremhab in Abu Oda südlich von Abu Simbel in die nubischen Sandsteinberge einmeißeln ließen.
Unter Ramses II. erfuhren dann die nubischen Tempel einen Bedeutungswandel. In ganz Unternubien wurden fast nur noch Kultstätten errichtet, die entweder vollständig (wie die beiden Tempel von Abu Simbel) oder doch zumindest in ihrem rückwärtigen Teil (Beit el-Wali, Gerf Hussein, Wadi es-Sebua, Ed-Derr) als Felsenheiligtümer angelegt waren. Vielfach befinden sie sich abseits dicht besiedelter Gebiete, dafür in exponierter Lage. Mit ihren Dimensionen und monumentalen Fassaden, am ausgeprägtesten in Abu Simbel, sollten sie die Macht des Pharao demonstrieren und damit die einheimische Bevölkerung disziplinieren. Von den genannten sechs Kultstätten, die Ramses II. zu Propagandazwecken an fünf verschiedenen Orten in der Region zwischen dem ersten und zweiten Katarakt errichten ließ, liegen lediglich zwei, Beit el-Wali und Gerf Hussein, innerhalb des Dodekaschoinos, die übrigen im südlichen Rest Unternubiens. Darüber hinaus gründete oder erweiterte Ramses II. mehrere Tempel in Obernubien, die jedoch wieder freistehende Bauten und keine Felsenheiligtümer waren.
Ptolemäisch-römische Präsenz in Unternubien
Anders stellt sich die Situation in griechisch-römischer Zeit dar, als nur noch das „Zwölf-Meilen-Land“ zu den nubischen Außenbesitzungen Ägyptens zählte. Es kam dort erneut zu einer verstärkten Bautätigkeit, wobei aber keine Felsentempel mehr, sondern ausschließlich freistehende Kultbauten entstanden. Zuletzt reihten sich von Norden nach Süden die Heiligtümer von Debod (Parembole), Qertassi (Tzitzi), Taffa (Taphis), Kalabscha (Talmis), Dendur (Tutzis), Dakka (Pselchis) und Maharraqa (Hierasykaminos) aneinander. Knapp die Hälfte davon geht auf den römischen Kaiser Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.) zurück, der mit den baulichen Anstrengungen seinen Anspruch auf den Dodekaschoinos als Teil des Römischen Reiches gegenüber dem Reich von Meroe als seinem südlichen Nachbarn behaupten wollte. Allerdings sind die meisten seiner Anlagen undekoriert oder zumindest in ihrem Reliefschmuck unvollendet geblieben. All die genannten Tempel, die ausnahmslos auf dem Westufer beheimatet waren, sind, um sie vor den Fluten des Nasser-Stausees zu retten, abgebrochen und entweder in Nubien auf einem höheren Standort wiedererrichtet oder einigen an der Rettungskampagne beteiligten Staaten zum Geschenk gemacht worden.