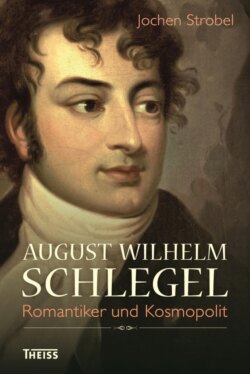Читать книгу August Wilhelm Schlegel - Jochen Strobel - Страница 8
2. Der Kritiker
ОглавлениеNach fünf Jahren beendete Schlegel 1791 sein Studium in Göttingen, ein formaler Studienabschluss war nicht notwendig. Das ursprüngliche Ziel, Pfarrer zu werden, war längst passé; der begabte junge Mann hatte sich in die Sprachen und die Literaturen der Welt hineinstudiert. Nun war guter Rat teuer. Auch examinierte Theologen überbrückten damals die Wartezeit auf eine freie Pfarrstelle als Hauslehrer oder Hofmeister, wie man es nannte. Diesen Weg schlug Schlegel ein. Ungewöhnlich war, dass er in die Niederlande ging. An das Studium schloss sich ein vier Jahre währender Auslandsaufenthalt als Hauslehrer in Amsterdam an.
Niederländisch war eine neue, eine weitere zu erlernende Sprache für ihn. In einem ersten Brief an den Göttinger Lehrer Bürger vom 11. Juni 1791 wird das Selbstverständnis des Poeten offenbar, aber auch, ironisch durchkreuzt, das Selbstbewusstsein des Weitgereisten: „Siehe ich habe nun die Welt gesehn, und weiß vermittelst der Anschauung, wie die Amsterdamer Kanäle stinken. Du begreifst leicht, daß dieß einen vortheilhaften Einfluß auf meine Poëterey haben muß, wenn ich erst wieder dazu kommen kann, zu dichten.“ (Strodtmann, 123)
Was sich hier abzeichnet, ist die beginnende Laufbahn eines Nebenstundenpoeten. In einer Zeit, da der freie Schriftsteller noch Seltenheitswert besaß, konnte er sich mit guten Konnexionen – wenn überhaupt – allenfalls als Zeitschriftenredakteur oder Theaterschriftsteller etablieren. Vorerst sah sich Schlegel aber vor allem als Lyriker; leben konnte er von seinem Lehrberuf, bald von Rezensionen und später dann auch von Übersetzungen – Tagesschriftstellerei also. Doch sollte er sich bald und zuallererst als Kritiker einen Namen machen.
Schon während seines Studiums hatte Schlegel durch die Vermittlung Bürgers ab 1789 für die Göttingischen Gelehrten Anzeigen zu rezensieren begonnen; hier erschienen 25 Artikel von ihm. Bedeutend mehr wurden es 1795 bis 1799 in der Allgemeinen Literatur-Zeitung; diesmal vermittelte Schiller den Kontakt. Er hatte den noch in Amsterdam weilenden Schlegel nach Jena eingeladen. Als ständiger Kritiker im belletristischen Fach wurde Schlegel zum Mädchen für alles. Und man kann wohl davon ausgehen, dass die umfangreiche Lektüre von Neuerscheinungen sein Urteilsvermögen weiter schärfte und sein Sprachempfinden zusätzlich schulte.
Mit der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, einer 1765 von dem Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai gegründeten Zeitschrift, war erstmals ein publizistisches Organ entstanden, das sich ausschließlich dem Bekanntmachen und Bewerten von Neuerscheinungen zuwandte. Die 1785 in Jena gegründete Allgemeine Literatur-Zeitung war mit 2.000 Abonnenten schon bald Marktführer auf diesem Gebiet. Sie war am Standort der Sachsen-Weimarischen Universität angesiedelt und zählte Goethe, Schiller, Wieland, Kant und Fichte zu ihren Mitarbeitern. Für heutige Verhältnisse ganz unglaublich ist, dass diese täglich erscheinende Zeitung das gesamte neu erscheinende Schrifttum anzuzeigen beanspruchte. Erscheinungsweise und Umfang belegen die enormen Vorzüge dieses Mediums für die Leser. Für den Rezensenten und Redakteur wirkte sich der Aktualitätsanspruch des Blattes nachteilig aus: Rezensiert werden musste so schnell und so entschieden wie möglich.
August Wilhelm Schlegel steuerte von 1795 bis 1799 den, wie er sagte, größten Teil der belletristischen Rezensionen in der Allgemeinen Literatur-Zeitung bei. Für ihn wie auch für seinen Bruder Friedrich war Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), der erste berühmt gewordene scharfzüngige Literaturkritiker in deutscher Sprache, ein leuchtendes Vorbild. An ihn knüpfte die Praxis der Brüder Schlegel an. Das in der Aufklärung wurzelnde Rezensionswesen verfolgte didaktische Ziele, Fehler wurden gesucht und mitgeteilt. Diese Methode lässt sich auch an August Wilhelm Schlegels zahllosen Tageskritiken noch belegen: Sie konzentrierten sich nicht selten auf die Darlegung von Fehlern in der Metrik oder Übersetzung oder auf die mangelhafte Bühnenwirksamkeit. Programmatisch war damals noch die Anonymität der Kritik, umso leichter konnte sie bis zur Beleidigung des Autors gehen.
Gleich in seinen ersten Rezensionen für die Allgemeine Literatur-Zeitung wandte sich Schlegel Goethe und Schiller zu; unter dem Deckmantel der Anonymität hatte er offenbar nicht die Absicht als Schmeichler zu gelten. Er begann mit dem 8. Band von Goethes Schriften, der gerade bei Göschen in Leipzig erschienen war, und erlaubte sich die Bemerkung, Goethes Geist, seine Individualität komme auch in minderen Werken zum Ausdruck – somit würden auch diese vor dem Untergang bewahrt. Allein die Behauptung, selbst dem bereits renommierten Goethe gelängen auch mindere Werke, war ein Wagnis.
Nicht ungnädig, aber abwägend gab er sich in den Artikeln zu den Heften von Schillers erster Zeitschrift, der Rheinischen Thalia. Mit Thümmel, Iffland, Gotter liefen ihm Größen der zeitgenössischen deutschen Literatur vor die Flinte. Er rezensierte auch englisch-, französisch- und italienischsprachige Bücher, so etwa ein Englisches Wörterbuch oder Transactions of the Royal Academy. Von Anfang an waren ihm Versbau, Rhythmus, Metrik wichtig, zeigten sich seine komparatistischen und übernationalen Interessen.
Über die von dem Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voss in dessen eigenem Musenalmanach veröffentlichten Gedichte schrieb er: „Die überall hervorleuchtenden Gesinnungen des Verfs. sind ächt weltbürgerlich, frei und herzlich, männlich und doch sanft.“ (Böcking X, 337) Er vernichtete tagesaktuelle Bühnenstücke und Moderomane, er wandte sich Shakespeare-Bearbeitungen (sein künftiges Feld!) und Petrarca-Übersetzungen zu, und immer wieder den für die schöne Literatur wichtigsten Periodika seiner Zeit, den Musenalmanachen.
Begierig griff er Ludwig Tiecks Übersetzung von Shakespeares Tempest auf – noch kannte man einander nicht, doch würde sich dies bald ändern! –, auch der kaum vierundzwanzigjährige Tieck wurde gezaust. Zu seinem Aufsatz Shakespeares Behandlung des Wunderbaren fiel Schlegel zuerst ein: „Die Schreibart ist nachläßig; ein so trivialer Satz an der Spitze: ‚Man hat oft Sh’s Genie bewundert‘, verspricht noch weniger, als der Aufsatz nachher leistet.“ (Böcking XI, 20)
Eine Blaupause seines gesamten weiteren Schaffens waren seine Texte zur antiken Literatur und zur Antike-Rezeption, die er von einer naiven Wiederbelebung unterschieden wissen wollte. Goethes vaterländisches Epos Hermann und Dorothea, das um eine Romanze zwischen einem deutschen ‚Jüngling‘ und einem weiblichen Flüchtling während der Revolutionskriege kreist und mit damals überragendem Erfolg versuchte, Homers Formensprache auf ein epochales Ereignis zu übertragen, fand er gelungen – im Unterschied zu vielem, was auf den, wie er sagte, Vorurteilen über die Antike beruhte. Die Antike habe Urbilder für die wichtigsten poetischen Gattungen hervorgebracht, aber Urbilder mussten, so Schlegel, als solche verstanden und konnten nicht immer aufs Neue nachgeahmt werden. Es bedurfte der Philologen und der Historiker, um aus einer vorurteilsbeladenen Antike-Rezeption eine den Tatsachen gerecht werdende entstehen zu lassen.
Ludwig Tieck
August Wilhelm Schlegel: Jugendbildnis
Schlegel beendete seine vierjährige Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Literatur-Zeitung 1799, nachdem dort eine negative Kritik über die von ihm und seinem Bruder Friedrich im Jahr zuvor gegründete Zeitschrift Athenaenum erschienen war. Er entschloss sich zu einem seine Kränkung auskostenden Rückzug, hatte man doch seine Zeitschrift ausgerechnet an einem Ort verrissen, der ihm jahrelang seine eigenen Heimspiele als Kritiker beschert hatte. Nun ‚outete‘ er sich: Er listete im Athenaeum alle seine Rezensionen der vergangenen Jahre auf, durchbrach also bewusst das herrschende Gebot der Anonymität, indem er einerseits die Verantwortung für seine Publikationen übernahm und zugleich sein Selbstbewusstsein als kritischer Autor zur Schau stellte.
Trotz der anonymen Erscheinungsweise der Rezensionen war die Identität manches Rezensenten ohnehin durchgedrungen, konnten die Leser bestimmte Individualstile und Vorlieben wiedererkennen. Auch hatte zu dieser Zeit die Neigung, als Autor und zugleich in der Rolle des Kritikers persönlich in Erscheinung zu treten, sein Selbstbewusstsein auf den Markt zu tragen, gewiss zugenommenen. Andere zu kritisieren hieß auch, die Bedingungen der eigenen Autorschaft festzulegen und damit für das Publikum sichtbar zu werden.
Die Literaturkritik war lange Zeit von Dilettantismus geprägt gewesen. Zu einer Professionalisierung des Gebiets, die erst innerhalb des modernen Kulturbetriebs seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte, trugen Lessing wie auch die Brüder Schlegel entscheidend bei. Erst der moderne Kulturbetrieb kannte die wechselseitige Abhängigkeit der Instanzen Kritiker, Verleger, Autor und Leser. Es entstand ein Markt, dessen Produkte auf die (oft erst noch zu schaffenden) Bedürfnisse des Lesers zugeschnitten waren und der hauptberufliche Akteure kannte – darunter den freien Schriftsteller, der das Kunststück vollbringen musste, für Geld zu arbeiten und doch seine Kunst so unabhängig und selbstbestimmt darzubieten, wie es ihm vorschwebte. Der Fluchtpunkt, auf den sich der Literaturkritiker bezog, war die zu dieser Zeit ebenfalls erst entstehende theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Schönen; an der Bewertung des einzelnen Kunstwerks durch den Kritiker konnte sich der philosophische Streit darüber, was das Schöne sei, konkretisieren.
Da immer mehr Bücher erschienen, bestand die Funktion der Literaturkritik auch darin, für die gesamte Leserschaft im späten 18. Jahrhundert alle Neuerscheinungen anzuzeigen. Sie konnte die Leser von dem Erfordernis breiter eigener Lektüre entlasten, indem sie ihm aus der Fülle der unüberschaubar vielen Neuerscheinungen eine Auswahl der als wertvoll erachteten Werke präsentierte. Wenn man denn den Kritikern trauen durfte. Es lässt sich aber leicht nachvollziehen, dass diesen recht schnell Macht zuwuchs, zumal auch damals Qualitätskriterien nicht unumstritten waren.
Friedrich Schiller (1795/97)
So hatte sich der Kant-Leser Schiller in existenzvernichtender Weise über die schrankenlose Subjektivität von Schlegels Mentor Bürger geäußert, zudem hatte er schon 1792 Friedrich Schlegel als „kalte[n] Witzling“ (KFSA XXIII, 51) tituliert, also als reduziert verstandesdominierten, auf sein Kalkül setzenden Autor. Nach kurzer Annäherung – wir werden darauf zurückkommen – standen sich Schiller und die Schlegels schließlich unversöhnlich gegenüber; August Wilhelm hielt allerdings noch bis über die Jahrhundertwende hinweg Kontakt.
Der Hass auf Schiller und das Bedürfnis, diesen öffentlich, im Medium der Kritik, mit Hohn und Spott zu übergießen, verließ Schlegel noch lange nach Schillers frühem Tod nicht. Als der alte Goethe seinen Briefwechsel mit Schiller herausgegeben hatte, in dem die Jenaer nicht gut wegkamen, veröffentlichte Schlegel 1830 eine Reihe von boshaften Gedichten wie die folgende Elegie:
Schiller im Spiegel seiner Theorie
Weil kein frisches Gefühl dem vertrockneten Herzen entströmte,
Alles in Röhren gepumpt, nannt’ er sich sentimental.
Weil er die Nacht in Toboso vergeblich gesucht die Prinzessin,
Auch Windmühlen bekämpft, nannt’ er sich Idealist.
(Böcking II, 205)
August Wilhelm bezichtigt Schiller hier – wie dieser einst seinen Bruder – der Kopflastigkeit. Die Anspielung auf den chronisch kranken Körper ist ebenso perfid wie die ja gegenstrebige Identifikation mit Don Quixote (ausgerechnet einer Lieblingsfigur der Romantiker): Schiller habe aufgrund phantasmatischer Verblendung nicht mehr ausmachen können, dass es sich bei seinen vermeintlichen Gegnern nicht um Ritter, sondern nur um Windmühlen handelte. – Wie konnte sich eine so tiefe Feindschaft entwickeln, die in den folgenden zwei Jahrhunderten mit zu dem Missverständnis beitrug, Klassik und Romantik seien einander diametral entgegengesetzt?
Was wir heute als selbstverständlich gegebenes Zweiparteiensystem der Zeit um 1800 in Deutschland hinnehmen, Weimarer Klassik und (Jenaer) Romantik, begann damit, dass die Brüder Schlegel Goethe und Schiller (vor allem und auf Dauer aber Goethe!) verehrten und umwarben, dass dann aber aus für uns fast harmlos anmutendem Schlagabtausch Distanzierung, Unverständnis, ja Feindschaft resultierten. Schlegels ‚Affäre‘ mit Schiller steht beispielhaft dafür, wie in einer entstehenden bürgerlichen Öffentlichkeit, in der der Kulturbetrieb hohe Geltung besitzt, Machtkämpfe ausgetragen werden: Die Etablierten werden von den herandrängenden, ehrgeizigen Vertretern einer jungen Generation erst hofiert, werden bald aber, wenn sie allzu dreist nicht nur eigene Positionen formulieren, sondern sich auch noch explizit gegen ihre älteren Förderer wenden, von den Etablierten sorgsam weggebissen und von den Schaltstellen diskursiver Macht, also von den Zeitschriften und den Musenalmanachen, entfernt. Das damals noch relativ neue Geschäft, mittels dessen sich Konkurrenz entwickeln und Macht erworben werden konnte, war die Literaturkritik.
Für die Allgemeine Literatur-Zeitung arbeitete Schlegel vor allem von Jena aus, wohin er sich 1796 kurz nach seiner Hochzeit mit Caroline Böhmer begeben hatte. Hier begann er auch, Shakespeare zu übersetzen. Das Verhältnis zu Schiller war noch intakt. Dieser bat ihn weiterhin um Beiträge für die eigene, 1795 bis 1797 herausgegebene Zeitschrift Die Horen. Dort fand Schlegel ein Forum zur Auseinandersetzung mit einigen seiner wichtigsten Themen, also Sprache, Metrik und Rhythmus zum einen; und mit den großen Dichtern Homer, Dante, Shakespeare und Goethe zum anderen. Die Zusammenarbeit mit Schiller hätte sich kontinuierlich fortentwickeln sollen, doch waren Streit und Trennung vorprogrammiert.
Der Kampf der Jungen gegen die Alten (oder hier: die Mächtigeren, Älteren) wurde nicht von den Romantikern in die Literatur eingeführt, obendrein sollte man Schlegel nicht vorwerfen, dass er Schillers Gutmütigkeit ausgenutzt habe. Schiller selbst wird daran interessiert gewesen sein, sich den vielversprechenden jungen Literaten näher anzusehen, im besten Fall ‚an sich zu ziehen‘, wie man damals gesagt hätte. Für Schlegel war der Wechsel nach Jena mehr als die Chance, dem verehrten Goethe näher zu kommen und von Zeitschriftenpublikationen leben zu können. Es winkte vielleicht eine Professur (danach hatte sich Schlegel schon vor seiner Umsiedlung recht deutlich bei Schiller erkundigt) oder gar die Herausgeberschaft der Allgemeinen Literatur-Zeitung (wie Schiller in seiner Antwort auf diese Anfrage andeutete).
Im Zusammenhang mit Schiller ist genauer von Caroline Böhmer (1763–1809) zu sprechen, der Professorentochter, die Schlegel schon als Student in Göttingen kennengelernt hatte. Der Kontakt riss nie ganz ab, man schrieb einander Briefe. Als junge Witwe hatte sie sich ins revolutionäre Mainz begeben und war von preußischem Militär unter dem Verdacht, Jakobinerin zu sein, verhaftet worden. August Wilhelm kümmerte sich nach ihrer Freilassung um sie; 1795 begegnete man einander in Braunschweig wieder, wo er sich nach seiner Rückkehr aus Amsterdam aufhielt. Die eigenwillige, unabhängig lebende Frau – mit ihren 32 Jahren war sie vier Jahre älter als Schlegel – war sozial geächtet; die von Friedrich vorgeschlagene Heirat mit dem älteren Bruder rehabilitierte sie in einer sehr moralinsauren bürgerlichen Gesellschaft. Auf einem anderen Blatt steht, dass der Jenaer Kreis sich um Caroline als seinem Mittelpunkt versammelte.
Caroline Schlegel-Schelling, verw. Böhmer, geb. Michaelis
Hier soll nur interessieren, dass sie es war, die Missklänge in das Verhältnis ihres Mannes zu seinem damaligen Förderer Schiller brachte. Für ihre Spottlust war sie bekannt, über Schiller zog sie besonders gern her. Der nannte sie daher bald „Dame Lucifer“ (Oellers, 8). Aber der Anstoß zur Trennung kam von Friedrich Schlegel. Er hatte gleich mehrfach Anti-Schiller-Rezensionen in einem Organ des Schiller-Gegners Johann Friedrich Reichardt lanciert. Daraufhin vollzog Schiller am 31. Mai 1797 sehr formell eine briefliche Trennung von dem älteren Bruder, deren schneidender Schlusssatz lautet:
Und um Sie, einmal für allemal, von einem Verhältniß frey zu machen, das für eine offene Denkungsart und eine zarte Gesinnung nothwendig lästig seyn muß, so lassen Sie mich überhaupt eine Verbindung abbrechen, die unter so bewandten Umständen gar zu sonderbar ist, und mein Vertrauen zu oft schon compromittierte. (ebd., 84)
Der von dieser Erklärung offenbar völlig überfahrene Schlegel entschuldigte sich sofort am folgenden Tag von Jena aus wortreich (natürlich ebenfalls brieflich), beteuerte seine Loyalität und verleugnete zugleich seinen Bruder. Caroline tat in ihrer Nachschrift ganz unschuldig, doch es half nichts. In seiner Replik vom selben Tag – diese Briefe hatten keine weiten Wege zurückzulegen – setzte er Vertrauen gegen Konkurrenzdenken. Natürlich hatte letzteres längst die Oberhand gewonnen, und für einen vertrauensvollen Umgang schien nun kein Platz mehr zu sein. Umso erstaunlicher, dass Briefwechsel und Zusammenarbeit noch einige Monate weitergingen. Zwar ließ der Bruch zwischen Schiller und den Schlegels auch eine nie mehr zu heilende Wunde aufreißen, doch setzte August Wilhelm alles daran, wenigstens den Kontakt zu seinem Idol Goethe zu erhalten, was ihm auch gelingen sollte. Im Briefwechsel mit Schiller hat Goethe die Schlegels gegen jenen da und dort verteidigt.
‚Kritiker‘ sein, sich gegen literarische ‚Feinde‘ wenden, dies konnte auch heißen, boshafte Parodien auf die hochgelobten Arbeiten dieser Feinde zu schreiben. Manchen der Romantiker zeichnete ein unkonventionelles Frauenbild aus – was konnte schlimmer sein als das von Schiller in seinem Gedicht Würde der Frauen gezeichnete:
Ehret die Frauen! Sie flechten und weben Himmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe beglückendes Band. Sicher in ihren bewahrenden Händen Ruht, was die Männer mit Leichtsinn verschwenden, Ruhet der Menschheit geheiligtes Pfand. (Schiller NA I, 240)
Schlegel, der wohl gegen diese altvertrauten Rollenzuweisungen manches einzuwenden hatte, schrieb dazu die Parodie:
Ehret die Frauen, sie stricken die Strümpfe,
Wollig und warm, zu durchwaten die Sümpfe,
Flicken zerrißene Pantalons aus;
Kochen dem Manne die kräftigen Suppen,
Putzen den Kindern die niedlichen Puppen,
Halten mit mäßigem Wochengeld Haus. (Böcking II, 172)
Diese Fingerübung war wohl für den eigenen Kreis gedacht und wird dort für Erheiterung gesorgt haben. Es verwundert also nicht, dass Caroline 1799 brieflich überlieferte, man sei bei der Vorlesung von Schillers Lied von der Glocke beinahe vom Stuhl gefallen vor Lachen.
Der Kampf setzte sich aber in der Öffentlichkeit fort. Goethe und Schiller weiteten ihre gemeinsame Produktion von literaturpolitisch scharfen Attacken in ihren Xenien aus. Nachdem Friedrich Schlegel sich in einer Rezension kritisch zu Schillers Musenalmanach auf das Jahr 1796 und wohl auch zu den Horen geäußert hatte, rächte sich Schiller im Musenalmanach 1797 mit Versen wie diesen:
Neuste Kritikproben
Nicht viel fehlt dir, ein Meister nach meinen Begriffen zu heissen,
Nehm ich das einzige aus, daß du verrückt phantasierst.
Eine zweyte
Lieblich und zart sind deine Gefühle, gebildet dein Ausdruck,
Eins nur tadl’ ich, du bist frostig von Herzen und matt.
(Schiller NA I, 346)
Es wiederholten sich die immergleichen persönlichen Kränkungen, und in seinen letzten Lebensjahren lagen Schlegels Nerven noch einmal blank. Goethe selbst edierte 1829 in kanonbildender Absicht seinen Briefwechsel mit Schiller, der jede Menge spitzer Bemerkungen über Zeitgenossen enthielt, auch solche über die Schlegels. Schlegels beißende Kritik, so ließ sich nun nachlesen, hatte Schiller, der den letztlich unerreichbaren Olympier Goethe hofierte, ihm näherkommen wollte (wie die Schlegels auch), tief getroffen.
Dennoch holte August Wilhelm Schlegel nochmals gegen Schiller aus und stellte in eigenen Xenien die Wiederholungen und ewigen Banalitäten in der (weitgehend ungekürzt publizierten) Korrespondenz zwischen Goethe und Schiller bloß. Dass er wiederum Schillers Körper, seine Krankheiten verspottete, wirft kein gutes Licht auf ihn, deckt seine lebenslange Missgunst und Eifersucht auf. Zeigt sich darin auch die Glätte, die Schlegel häufig nachgesagt wird, seine Illoyalität, im Grunde seine Unmenschlichkeit? Eine kaum verhohlene Abneigung hatte seine Meinung über Schiller wohl bereits geprägt, bevor es zur ersten Kontaktaufnahme durch diesen kam. Dennoch hatte Schlegel sich geschmeichelt gefühlt, hatte kooperiert, um Karriere zu machen, hatte sich nach außen loyal gezeigt. Aber seinen Groll gegen ihn trug er, wie schon gesagt, noch viele Jahre nach Schillers Tod an die Öffentlichkeit:
Der erste Eintritt
Viel kratzfüßelnde Bücklinge macht dem gewaltigen Goethe
Schiller; dem schwächlichen nickt Goethes olympisches Haupt. (Böcking II, 204)
Dichterischer Briefwechsel.
Morgenbillet.
Damit mein Freund in’s Schauspiel rutsche,
So steht ihm heut zu Diensten meine Kutsche.
Antwort.
Ich zweifle, daß ich heut’ ins Schauspiel geh’;
Mein liebes Fritzchen hat die Diarrhee. (ebd., 207)
Diese Verse sind ein Stück romantischer Literaturkritik. Im Klartext sagen sie: Der Abfall der Alltagskommunikation ist nicht überliefernswert, auch wenn große Geister miteinander sprechen. Im Vorwort zu seinen 1828 erschienenen Kritischen Schriften, in denen Schlegel die seiner Meinung nach immer noch gültigen Texte versammelte, zeigte er sich empfindlich. Dort schrieb er, man habe ihn zu Unrecht verdammt:
Der Kritiker, aus dessen Schriften man hier eine Auswahl versammelt findet, stand in seinen jüngeren Jahren in üblem Ruf. Man schilderte ihn wie einen Wütherich, einen Herodes, der an einer Menge unschuldiger Bücher nichts geringeres als einen Bethlehemitischen Kindermord verübt habe. (Schlegel 1828, III)
Dies mag übertrieben erscheinen. Doch das bis heute vertraute Bild des harten, gnadenlosen Kunstrichters hat Schlegel selbst durch sein Verhalten sicherlich mitgeprägt. Rückblickend jedenfalls behauptete er, es seien ihm weder die „Wagnisse“ seiner Partei noch die Aggressivität der Gegner verständlich. Doch konnte er genüsslich verzeichnen, dass er mit seinen Ansichten Recht behalten hatte, dass etwa das klassizistische französische Drama tot war, selbst in Frankreich! Was einst journalistische Praxis gewesen war, erwies sich inzwischen als ein häufig gelungener Akt von Kanonisierung und Dekanonisierung. – Eben: Wieland war lange schon gestürzt, war inzwischen sogar vergessen, und Schlegel hatte sein Teil dazu beigetragen.
Erst mit dem Zusammentreffen mehrerer Gleichgesinnter in Jena lassen die Literaturhistoriker ‚die Romantik‘ beginnen. Bleiben wir bei dieser Einteilung, selbst wenn Vor- und Nachgeschichten als langsame Übergänge zu verzeichnen sind. Auch der Romantiker Schlegel also war vor allem Kritiker, nun aber in einem umfassenden Sinn. Die ‚romantischen‘ Medien dieser Kritik waren (wie zuvor) die Zeitschrift und das Gespräch, dessen Intensität sich an zeitweilig enger Lebensgemeinschaft und an intensivem brieflichem Austausch bemaß. Doch vor allem für Friedrich Schlegel und für Novalis wurde die Rezension selbst kunstwürdig, verstand sich der Kritiker als ein erweiterter Autor, einer, der das rezensierte Werk gleichsam fortsetzte.
1801/02 gaben die Brüder Schlegel zwei Bände mit ihren kritischen Texten unter dem Titel Charakteristiken und Kritiken heraus. Sie beließen es nicht bei der bloßen Bewertung eines Textes, sondern arbeiteten auch das für Autor und Werk Charakteristische heraus. Lessing, Forster, Goethe und Shakespeare konnten zu klassischen Autoren erhoben werden.