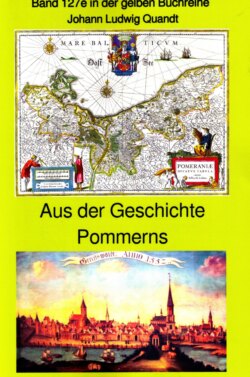Читать книгу Aus der frühen Geschichte Pommerns - die Pomoranen, Liutizen und Obodriten - der 30kährige Krieg - Stralsund 1678 - Johann Ludwig Quandt - Страница 7
Zur Urgeschichte der Pomoranen
ОглавлениеZur Urgeschichte der Pomoranen
Älteste Einteilung des Landes
Abstammung und älteste Verzweigung des Fürstenhauses
1.
Wie ich in einem früheren Aufsatze gezeigt habe, war die Südgrenze der Pomoranen um 1100 die Netze von Cüstrin, bis wohin im Mittelalter der Name reichte, bis vor Labischin, dann breites Bruch und auf eine Meile weit dichter Wald bis zur Weichsel. „Die so starke Naturscheide, überall breites, damals mehr wie jetzt unwegsames Bruch, bestand noch, als Polen unter Boleslaw III schon eine große Macht entwickelte, und unter der schwächeren Herrschaft seines Vaters Wladislaw, also auch unter der nur allmählig erstarkenden Kasemirs I, dem die unbesiegten Pomoranen in gleicher Macht gegenüber standen, und während der Zerrüttung Polens von 1031—1041, wo sie sogar Eroberungen machten, diese jedoch an Kasemir verloren. Boleslaw l hatte als Eroberer und Beherrscher von ganz Pommern keinen Grund es zu mehren oder zu mindern. Sein Vater Mesko I, mit dem Polen in die klare Geschichte tritt, beherrschte Anfangs nur die Kujawen, und erwehrte sich auch, als er schon das eigentliche, (sog. Groß-) Polen dazu hatte, nur mit Mühe einzelner deutscher Markgrafen und liutizischer Völker, wir dürfen also und müssen auch für seine und frühere Zeit die so stark markierte Scheide festhalten.“ Als Ostgrenze der Wenden war seit Karls des Großen Tagen die untere Weichsel bekannt.
Und zwar zeigen sich als pommersch, seitdem Urkunden das Land erhellen, alle ihre Werder bis zu den östlichsten Armen, das sind die Alte Nogat von Kl. Grabau bis zur jetzigen Nogat, dann diese und die bei Wolfsdorf zum Elbing abzweigende Alte Nogat. Auf der Nehrung war die Scheide dem Elbing gegenüber östlich von Lieb, wo die Spuren des uralten, schon vor der historischen Zeit versandeten Tiefs des Haffs. Wenn aber 997 von Danzig berichtet wird, es sondre die Gebiete des Herzogs Boleslaw voneinander, so folgt, dass der den Namen Weichsel behaltende westliche Arm damals Pommern und das gleichfalls von Boleslaw unterworfene Witland (die Geten, Gothen der polnischen Berichte) trennte. Dies blieb bei Masovien und bei der Zerrüttung Polens 1031 ff. unter dessen Fürsten Meczslaw. Sein Untergang im Jahre 1044 ist der einzige sich darbietende Zeitpunkt für den Anfang der später heraustretenden Verteilung des Witlandes, wo der Teil südlich der Ossa polnisch, alle Werder zwischen den Weichselarmen pommersch, das übrige Besitz der Preußen ist. Danzig selber ist bis 993 als Grenzfeste der Geten zu fassen zufolge des Namens Gyddanize, der ist Adjectiv von Gyddanie = Getae, Gythones bei Ptolemaios.
2. Westgrenze der Pomoranen ist am Meer die Swine, Naturgrenze durch die Konfiguration des Landes, der Inseln, Völkerscheide in germanischer Zeit, innere Hauptscheide bis 1653. Nach Adam von Bremen haben (um 1070) die Leuticier die Küste bis zur Oder, jenseits der Oder leben die Pomeranen; dieselbe geht durch die Wenden bis zur Stadt Jumne (Jomsburg, Julin) in ihrer Mündung (auf einer Mündungsinsel), wo sie die Pomeranen von den Witzen oder Leuticiern scheidet; die Insel, worauf die Stadt, bilden drei Sunde Greta) jenseits der Leuticier. Wie Usedom 1124 Stadt in Leuticia, so ist 946 Wanzlowe (die Provinz, in der sie liegt) der letzte der zur Havelberger Diözese gelegten, zu Geros Mart gehörenden Gaue.
Oberwärts ist 949 die Oder Ostgrenze der Brandenburger Diözese, also auch der Mark Geros, der die Wenden bis zur Oder unterworfen hatte; bis zur Adora reichte schon die Herrschaft Ludwigs d. Fr., so lange nämlich die Wilten noch in Abhängigkeit standen. Aus diesen Daten hat man bisher gefolgert, unterhalb der Warthe sei die Oder durchweg die Scheide zwischen Pomoranen und Liutizen gewesen. Aber das ist nach ihnen nicht nötig, im Gegenteil erweislich, dass Stettin wenigstens seit 940 den ersteren gehörte, vorher aber gibt es keine Nachrichten. Zu seinem Gebiete gehörte 1124 die Feste Garz, also das Land bis zur Welse und Randow. Von der Welse an schied 1250 das Bruch Randowa und der Fluss Lokeniza (jetzt Randow) das forthin markgräfliche Land Ukera vom Stettinschen. Das jenem nördliche, 1136 zum Groswinschen Gau gehörende Land Rochow enthielt als äußerste Punkte 1216 das Dorf Eggesin mit der Forst gegen Süden bis an die stets und noch heute bestehende Grenze des Randowkreises von der Randow bei Jägerbrück bis zum (schon 1317 als Grenz- mal genannten) Barnimskreuz und 1195, 1216, 1241 das Dorf (Weil die Diözesen auf drei Strecken nicht durch den jetzigen Hauptstrom der Elbe, sondern durch die jedes Mal Alte Elbe genannten Nebenarme begrenzt werden, so habe ich die sog. Alte Oder bei Gusow als Ostgrenze angenommen. Das ist möglich, mir jetzt unwahrscheinlich. Sicher ist, dass der Werder, auf dem Kienitz (wohl mit Neuendorf, Ortwig c. p.) bis c. 1230 zum Ostlande, zu Pommern gehörte; er genügt, und bildet dann der Stromlauf von Rehselde aus Wriezen hin eine gerade Linie. —Zur FM. von Gizin gehört die Lochniza bis zur Neklonsiza-Brücke; dazu wird vergabt der dieser gegen O. und S. anliegende Wald (nemus) mit dem See Karpin (ino) bis zur silva (hier wie auch sonst, auch bei Tac., im Gegensatz Bruchwald — Fenn) Koniore, die ist offenbar das heutige Grenzbruch an den Kammerbergen westlich des Barnimskreuzes; die Brücke ist dann die bei der neuen Mühle, der ihr und dem Karpiu südliche Wald reicht dann bis Jägerbrück; wie denn auch der zugelegte Wald westlich der Lochniza nordwärts an der FM. Gumuitz endete) Sosnitza mit der Kirche in Warpna (Die darin dem Grobischen Kloster verliehene Kirche ist die demselben 1320 restituierte in Warpe (Zietlow S. 162), von der 1331 die bisherigen Filiale Luckow und Rieth abgezweigt wurden. Sie heißt aber 1376 die Kirche in der Stadt Warpe, die 1295 oppiäuu, Warpis, noch bei Micraelius bloß Warpe, zuerst 1412 Nienwerpe heißt. Das Dorf heißt 1316 und stets Oldenwerpen, seine Kirche erscheint nie als Pfarrkirche, wird nur mator genannt, weil der Diakonus von NW. sie selbstständig curiert. Ist es nun laut des Namens älter als das oppidum, hat dies 1267 die Kirche in Warpna, so kann das beiden gleichzeitige Sosnitza, mit dem die Kirche verbunden wird, nur die sogenannt Altstadt sein. Vermutlich stand dort die Kirche am dortigen Kirchhaken, ist erst zwischen 1241 und 1267 zum neu entstandenen NW. versetzt. Dies zur Correction von C. P.), das ist Neuwarp, also auch dem Kirchspiel, also auch dem Dorfe Warlang, dem 1310 der See Karzene (Karsch) zugehörte, beide an der bis 1816 bestehenden Kreisgrenze bis zum Barnimskreuz. Als ursprüngliche Scheide wird sie dadurch bestätigt, dass sie dem Grenzstrom Swine gerade südlich ist, dass sie. bei der Errichtung der Vogtei Ükermünde um 1300 hergestellt ward (Albersdorf gehörte 1412 dazu. Im Vertrage von 1284 ist das Land Ukermünde bis zur Jasenitz ausgedehnt, aber das ist neue, vom Markgrafen stipulerle, nie ins Leben getretene Festsetzung.) und dass die Gegend vorher nach Auflösung des Landes Rochow um 1250 zu Stettin gelegt war. Auf der südlichen Seite beginnt die Scheide des 1250 von Barnim abgetretenen Landes Ukra gegen das ihm verbliebene Land an der Wilsna (wo sie aus dem Nordlauf in den Ostlauf umbiegt, und jenes begreift, da dem Camminer Bischöfe darin seine Rechte vorbehalten werden, nur den der Camminschen Diözese verbliebenen Teil der späteren Ukermark, der aber reicht gegen SO. nur bis zum Nordlauf der Welse; was zwischen diesem, dem Ostlauf und der Oder ist, bildete das Archidiakonat von Stolpe des Brandenburger Bistums, die Vogtei Stolpe der Markgrafen, die später zur Ukermark gerechnet ward. Beide haben also das Gebiet vor 1250 erlangt, frühestens aber Ende 1233. Nämlich 1215 gründete Markgraf Albert die Burg Oderberg zum Schutz eines (1210) neu erworbenen Landes (Abbas Cinnensis bei Riedel Mark Brandenburg), des Brandenburgischen Archidiakonates Zehdenick-Templin, der markgräflichen Vogtei Liebenwalde. Noch unter ihm († 1221) entstand dicht vor Oderberg das Hospital in Barsdin, das seine Söhne 1231 mit dem Dorf begabten, damit es das Kloster Gottesstadt werde. Dessen Diözesan war nun nach der päpstlichen Bestätigung vom 11. Oktober 1233 noch der Camminer Bischof, und dieser, nämlich Conrad I, hat den Probst mit seinen Brüdern dort angesetzt und geweiht, und begabt das Kloster 1233 in seinem 15. Amtsjahre (also nach 1. August, vor November, lvo sein Nachfolger geweiht ward), „damit durch das Kloster die Grenzen unsers Landes und die Diözese unsers Bistums unverletzt dargetan werden,“ allein bald nach 1232 „kauften die Markgrafen den Teil von Ukera bis zum Fluss Wolsene,“ (Pulcawa bei Barthold 2, 381 n. 1; die Zeit wird nur so bestimmt, dass sie nach 1225 ist und die Erwerbung des Barnim unmittelbar vorhergeht; über den zeigt sich markgräfliche Herrschaft zuerst 1232.) d. h. das Land Stolpe, das der Chronist nach dem Sprachgebrauch seiner Zeit (ca. 1330) zur Ukra rechnet. (Die eigentliche Ukra kann der Chronist nicht gemeint haben, die ward später und nicht durch Kauf erlangt und für sie ist die Welse eine ganz unpassende Grenzbezeichnung, aber das Land Stolpe umfasste sie von zwei Seiten.) Der Bischof nennt es sein Land, (Nostra terra natürlich wie nostri episc. = mein; es ist ja pron. possess., also nicht: das Land, dem ich angehöre — Pommern.) er also, vermutlich Conrad III beim Amtsantritt, ist der Ver-käufer, wie denn vom Herzoge nicht wohl anzunehmen ist, dass er solchen Landstrich verkauft habe. Dass er die angegebenen Grenzen des Stettiner Landes — natürliche, die geradlinigen Brücher um die Welse und Randow, die ausgedehnte Wildnis zwischen Ükermünde, Jasenitz und Clempenow — auch vor dem 13. Jahrhundert bestanden und zwar als Scheide der Liutizen und Pomoranen, beweisen folgende Momente. Jene Wildnis setzte man 1185, wo die Herzöge laut ihrer Titel ihre liutizischen Untertanen noch von ihren Pomoranen unterschieden, als Scheide des eigentlichen Pommern gegen die Penegegend. (Nach Saxo p. 984: die städtelose, bisher von den Dänen noch nicht heimgesuchte reiche Gegend, vom Penelande durch weite Einöde geschieden, kann nur die östlich von Lökenitz sein.) Stettin, dem 1124 Garz und Lebbin, dies hinter der unstreitigen Grenze, untertan waren, das der Hauptort war für alles Land bis an die Drage, gehörte damals zu den eigentlichen Pomoranen, nicht zu den erst kürzlich damit vereinten Liutizen der Penegegend, das zeigt das Totale der Bekehrungsgeschichte Pommerns, (21) und so war es seit lange, weil es nur so als der Pommern älteste Stadt und mater civitatum bezeichnet werden konnte. Zum Brandenburger Sprengel wurden 949 gelegt die Riaciani und die Wucri, beide (mit andern) seine Nordgrenze bildend. Die zweiten, gleichzeitig auch Ucrani genannt d. h. Grenzer (Kraina, mit der Präp. Ukraina kommt als Grenzland öfter vor, ebenso Ukra, Wkra als Grenzfluss. Wucri hat beide Präp. w und u wie das im Slawischen häufig ist.) müssen das Land Ukra von 1250 haben, wegen des Flusses Ukra, des Ukersees, des „Ukerschewolt“, (Gerswalder re. Forst). Der Name Riaciani, gleichzeitig Riezane, Rezem, und 890 Verizane, bedeutet Stromliche, sie haben darnach die Oderseite des Sprengels (s. o.), Wriezen als Tempelstätte, heißen später Leubuzi (Lebuser), bilden mit den Spriawani (Spreeischen) die beiden Theile der liutizischen Wulinen. (Darüber ein andermal. Man hat die R. nördlich der Ukrer gesetzt, dann bilden diese ja nicht die Nordgrenze. Westlich neben diesen ist kein Strom, sind die Tolenser unstreitig.) Die Ukrer dürfen nun nicht über die Randow ausgedehnt werden, sonst sind die Riezanen nicht an der Nordgrenze; aus demselben Grunde müssen diese bis zur unteren Welse gereicht haben, aber nicht über sie hinaus, sonst sind die Ukrer nicht, was ihr Name anzeigt, die Liutizen an der Grenze. Folglich gehörten die Stettiner 949 weder zum Sprengel noch zu Geros Mark. Schwerlich reichten die Ukrer bis ans Haff, sonst wäre wohl das Meer ebenso wohl wie die Oder als Grenze des Sprengels angegeben; dann gehörte Rochow schon damals wie 1136 zu dem 946 der Havelberger Diözese zugeteilten Gau Groswin. — Demgemäß kann die civitas Szchinske, zu der 995 ganz Pommern als Pertinenz gerechnet wird, so dass die Westgrenze die Oder hinab geht nicht bis ans Meer sondern nur bis an die civitas, nur Stettin mit seinem Gebiete sein.
3. Die Einteilung des Landes der Pomoranen in der heidnischen Zeit erhellt zunächst aus seiner Verteilung unter Diözesen bei der Christianisierung.
Karte vor 1945: Bütow
Der Bischof von Kujavien oder Wladislaw erhielt durch die Festsetzungen des Herzogs Boleslaw III und des päpstlichen Legaten Aegidius (ca. 1123) zu seinem polnischen Sprengel das, was man um 1250 Oberpommern, 1148 das Gebiet des Castrum Gdansk in Pomerania nannte; seine Westgrenze war die Leba, soweit sie noch heute Grenze ist, dann ungefähr die Grenze des Stolpischen, Bütowschen und Schlochauschen Kreises bis zur Braa, diese hinab bis zur Grenze zwischen Posen und Westpreußen, die 1349 als alt anerkannte Scheide Pommerns gegen Polen. (Seitdem sind durch Cramers Gsch. d. L. Lauenburg und Bütow die betr. Grenzbeschreibungen genauer bekannt geworden; aus ihnen ergibt sich, dass Wutzkow o. p. (Rakitt), Jassen e. p. und, was östlich einer Linie zwischen den Westenden des Glinow und des Somminer Sees ist, zum östlichen Lande gehörten.) Er verwaltete das Land durch einen archidiaconus Pomeraniae, (Sitz o. Z. Danzig), und nannte sich im 13. Jahrh. oft Bischof der Kujawen und Pommern.
Die Castellanei Rakel gehörte schon 1136 zur Erzdiözese Gnesen, jedoch im Osten nur bis zum Bache Plitucza; es war nämlich das Gebiet von Wischegrod (und vom späteren Bromberg) dem Wladislawschen Sprengel zugelegt, um seinem kujawischen Teil eine (schmale) Verbindung mit dem Pommerschen zu geben. Grenze der Gnesner Diözese ist die Kuddow von der Mündung bis zum Zahnfluss, von hier eine Linie zum Tessentin-See, dann (mit für die Geschichte unwichtigen Abweichungen) die heutige pommersche Grenze bis zum Wladislawschen Sprengel bei Sommin.
Was der Posener Bischof unter sich hatte, 1298 zu einem Archidiakonat machte, ward 1108 polnisch beim Tode des Herrn Gnewomir, der Czarnikow und Filehne, o. Z. auch die dritte Feste Bitom unter sich hatte. Grenzen waren die Drage von der Mündung bis zum Anfange, dann eine Linie durch wüstes Land nördlich des Pieleborgsees etwa auf Knaksee und die Zarne, diese hinab bis zur Kuddow. Die Bewohner nennt Marlinus (schrieb 1113) Czarnken.
4. Alles Übrige vom eigentlichen Pommern bildete den Sprengel des Camminer Bischofs (Nur das Land Cüstrin und das Schloss Kienitz mit seinem Werder wurden definitiv 1262 an den Lebuser Bischof abgetreten). Der erste Bischof Adalbert ward es durch päpstliche Weihung 1140, war aber schon 1124 durch Boleslaw von Polen als dem damaligen Lehnsherrn und durch Wartislaw von Pommern dazu bestimmt als S. Ottos Begleiter (2) diesem wurden 1136 die Kirchen in dem von ihm bekehrten Lande confirmiert, bei seinem Tode seinem Nachfolger provisorisch anvertraut; bis 1140 war also Adalbert sein Vicarius, sein Sitz Usedom, 1147 Stettin. Er und seine Nachfolger nannten sich Bischöfe der Pommern bis zuletzt 1210, dann von Cammin, jedoch auch schon seit 1162. Der Sprengel war demnach das Pommern, welches Otto bekehrte, Wartislaw (mit seinem Bruder) beherrschte und 1121 als polnisches Zinslehn anerkannte; er repräsentiert das Pommern von 1121, 1123. Was die polnischen Diözesen im Lande erhielten, war also vor 1121 polnisch geworden, wie es vom Teil der Posener auch berichtet ist, ward im Herzogtum gar nicht als Pommern sondern zu Polen gerechnet, bis die Fürsten an der Weichsel eine freiere Stellung erhielten.
Die päpstliche Confirmation von 1140 überweiset nun dem Bistum: die oastra Demmin, Tribsees, Gützkow, Wolgast, Usedom, Groswin, Pyritz, Stargard mit Dörfern und allen Zubehörungen, Stettin und Cammin desgleichen und noch mit Markt und Krug (torum et taberna), Wollin mit Markt, Krug und allen Zubehörungen, Colberg noch dazu mit einem Salzkoten und mit Zoll. (Zu Tribsees gehörte das davon benannte Schwerinsche Archidiakonat, zu Demmin Tolense, Plote, Loitz, zu Gützkow noch Medziretsch, zu Wolgast Wusterhusen und Bukow, zu Usedom die Insel, Lassan/Ziethen, zu Groswin noch Rochow. Darüber künftig.) Man hat das früher nur von Einsprengelung der Castellaneien verstanden, Giesebrecht zuerst hat gesehen, dass eine Überweisung zu wirklichem Besitze gemeint und im Wortlaut der U. ausgedrückt ist, dass folglich [da ja die Burgen mit ihren Bezirken fürstlich blieben, auch der Bischof das ganze Land erhalten hätte,] castra hier die befestigten unbewohnten Tempel sind, die mit ihrem Eigen und Einkommen dem Bischöfe gegeben wurden nach dein Grundsatz: Tempelgut wird Kirchengut. (Zur Stiftung von Dargun gibt der Bischof nichts an Grund und Boden als das castrum Dargon, die Tempelfeste.) Indessen ist dies doch so aufzufassen, dass die frühere Ansicht mit festgehalten wird, weil sonst gegen alle Analogie jede Bestimmung über den Sprengel fehlen würde, und weil wir durch Thietmar wissen, dass jeder wendische Gau seinen Tempel hatte. Die omnes appendiciae bezeichnen eben das zum Tempel gehörige Gebiet nach den verschiedenen Arten der Abhängigkeit und Pflichtigkeit, auch der bloßen Zugehörigkeit der Orte. Die zugewiesenen Krüge und Märkte sind denn Zubehör der Tempel gewesen, entstanden für und durch die Cultusfeierversammlungen, wie solche S. Otto bei seiner Ankunft in Pyritz vorfand. Diese castra mit ihren Zubehörungen sollen hier Tempelgaue, die nachmaligen fürstlichen castra mit ihren Bezirken Burgen und Burgwarde, die größeren Verwaltungsbezirke, welche außer der Hauptburg noch andre Burgen enthielten, Castellaneien, die castra ohne Gebiet Vesten genannt werden.
Aus jener notwendigen Auffassung der castra in der U. von 1140 folgt, dass man dein Bischofe alle Tempelfesten hat überweisen wollen, dass also Prenzlau mit Markt, Krug und allen Zubehörungen in den Confirmationen von 1188, 1217 steht (C. P. 152. 163 In beiden ist Cammin als nunmehr Cathedralsitz voran gestellt zulgleich mit den Worten, die in der U. von 1140 zu der Gruppe Stettin und Cammin gehören (daher eorum fälschlich in earum verwandelt,) und nun Stettin ahnenden Zusatz cum taberna x. gelassen. Es ist also die U. von 1140 reproducirt mutatis mutandis. und zwar ungeschickt), in der von 1140 fehlt, weil das Land Ukra erst dazwischen an Pommern gekommen ist, wahrscheinlich in Folge des Heerzuges von 1157.
Karte vor 1945: Kolberger Gebiet – Köslin
Da ferner die Dotation des Bischofs besteht in allen kurz vor 1120 pommersch gewordenen westswineschen Landschaften und in den Tempelgauen Pyritz und Stargard aus den Eigentumsdörfern der Tempel, in Wollin, Colberg und Prenzlau aus den Krug- und Markteinkünsten, in Stettin und Cammin aus beiden: so können die in der U. von 1188 auf die castra folgenden Worte „ganz Pommern bis zur Leba mit Märkten und Krügen“ nicht von der ganzen Diözese verstanden werden, sondern nur vom Lande hinter Colberg bis zur Leba, zumal noch der Zehnte vom Markte in Ziethen folgt. Diese Worte aber ersetzen in der U., welche die von 1140 mutatis mutandis wiederholt, (7) die hier an gleicher Stelle zwischen Colberg und dem Ziethenschen Marktzehnt stehenden: „in ganz Pommern bis zur Leba von jedem Pflüger zwei Maaß Korn und 5 Pfennige“. Diese Unterscheidung in der Dotation muss ihren Grund haben, und der ist erkennbar; die Burgwarde des bezeichneten Landes standen unter Ratibor, das ist dadurch bestätigt, die Teilung ist vor 1140 geschehen, bei Lebzeiten Wartislaws.
Die Märkte und Krüge in seinem Landesteile müssen den übrigen gleichartig sein, d. h. auch zu Tempelfesten gehörig, zumal der große Raum nicht ohne solche zu denken ist, wenngleich sie 1188, wo solche längst aufgehört hatten, so nicht mehr bezeichnet werden konnten; es sind ihrer mehrere, offenbar die drei Burgen Ratibors, Belgard, Schlawe und Stolp. Belgard, die von S. Otto zweimal besuchte civitas, um 1100 urbs regia et egregia, Landeshauptstadt, (9) muss auch religiöser Mittelpunkt gewesen sein; Slawna [berühmte], in der ersten Erwähnung Slawina [slawische], o. Z. gleich nach Ratibors Tode Residenz und schon von ihm mit kirchlicher Stiftung versehen, zeigt sich durch den Namen als ältester Hauptort der Slawen, und der s. g. Geograph von Ravenna [schrieb um 700] lässt die im sechsten Jahrhundert an der Unterdonau erscheinenden Sclavini aus dem skythischen [d. i. gothischen] Bernstein-aestuarium stammen als dort Nachbarn der Vites (Witländer), also aus dem östlichen Pommern, während er das weitere Land bis Dania, und zwar noch östlich der Oder, mit altem deutschen Namen belegt (Die Ausführung anderswo.); Slawianie nennen sich die Kassuben selber.
Dem Wladislawschen Bischofe ward 1148 confirmiert castrum Gdansk in Pomerania mit dem Zehnten sowohl vom Korn als von allen Schiffsabgaben, auch der zehnte Teil von der moneta und den Gerichten [Gerichtsgefällen] des ganzen Bistums. Da jede anderweitige Angabe über die Einsprengelung fehlt, die Danziger Burg schon vor 1178 Residenz ist, Schwetz schon 1112 Hauptburg war, der Bischof die Zehnten in ganz Oberpommern hatte (Im Landesteile Grimislaws C. P. 182, Sambors 625, 627, Swantipolks 570.): so ist dies als der zugehörige Tempelgau, das castrum gleichfalls als Tempelfeste zu fassen. Ebenso denn auch für die Anteile des Gnesener und Posener Sprengels Rakel, schon 1109 castrum antiquissimum, (13) und Czarncowe, das Czarnkische, vom Volk benannte.
Die Dotation des Camminer Bischofs war eine ärmliche, ungenügende, ward noch dazu erweislich nur teilweise eingeräumt. Daher hat die U. von 1188 den Zusatz: Der Papst bestätigt die durch Resignation der Laien oder auf andere rechtmäßige Weise in ruhigem Besitz befindlichen Zehnten. Die Entrichtung derselben hatte Bischof Conrad durch (nicht erhaltene) U. des Papstes Alexander (wohl bald nach beider Amtsantritt, der in 1160) „mit Gottes Hilfe erlangt, wie es allgemeine Gewohnheit ist bei gläubigen Völkern“ (C. P. 131 (von 1179 f. B. St. 10, 1, 149) jedoch erst nach der neuerlichst (C. P. 1082) von Dr. Hasselbach mitgeteilten richtigen Lesung der Matr. a subditis nostris (statt vestris). Vorher musste ich die Stelle der U. von 1188 erklären, wie L. P. 983 zu lesen ist.); jedoch in den liutizischen Landschaften hatte sie der Bischof schon 1153 o. Z. in Folge des Versprechens, das Ratibor 1148 auf dem Fürstentage zu Havelberg nach dem Kreuzzuge von 1147 gegen sein Land gab, das Christentum zu fördern. Doch ward in Pommern nur der Kornzehnt, und zwar in einer für den ganzen Ort festbestimmten Scheffelzahl, und der kleine Zehnt (vom Viehzuwachs) eingeführt. — Damit ist wohl die Dotation von 1140 meist an die Herzöge gekommen; wenigstens zeigt sich später nur eine Spur derselben; 1240 erhielt der Bischof von Barnim eine Jahresrente von 26 Mk. Pf. für „die Pfennige (= das Geld), die er gehabt hat von Krügen und Zehnten, Märkten, Zöllen und Münten in den Burgwieken Usedom, Stettin und Pyritz“, in denen er doch, wie in derselben U. vorhergeht, die kirchlichen Zehnten dem Herzoge abgetreten hat. Jene Zehnten sind daher andere, sind wie die Hebungen, zwischen denen sie stehen, aus der Dotation von 1140, sind von den Dörfern der genannten Tempelfesten; dann sind die Bauern in solchen die decimi rustici, die rustici quos decimarios usitalo nomine appellare solemus (In Rügen kommen dessitli vor, das ist Übersetzung.) die nur vereinzelt, in den frühsten U. und in der Nähe von Tempelfesten, aber als herzoglich vorkommen, während die kirchlichen Zehnten von allen Bauerhufen entrichtet wurden.
5. Suchen wir nun den Umfang der pomoranischen Tempelgaue des Camminer Sprengels zu ermitteln.
Das Land Stargard trat Barnim 1240 an den Bischof ab „mit allen seinen Zubehörungen bis zum Flusse Plöne, und ihn hinab bis zum Dammschen See, vom Ursprung aber des Flusses (im Berlinchenschen See) aufwärts gegen Polen, wie diese Grenzen von verschienenen (rectroactis) Zeiten her bestimmt sind;“ bei Broda (Pass) gehörte 1186 nur das eine Ufer der Plona und des schwarzen Fließes (ihres südlichen Nebenarmes Fließ) zur Burg Pyritz, wie auch die Dörfer Brietzig und Strohsdorf; die Geistlichkeit zwischen Ihna und Plöne gehörte nachmals, obwohl das Land politisch durch die Ihna zerschnitten war, unter den Archidiakonus von Stargard und hatte dort ihren Kaland.
Schon früher habe ich bemerkt, dass jene Grenze sich durch die Westgrenze des Landes Friedberg oder früher Driesen (die Zanze) fortsetzt, dass dies Land, ehe es (1178?) polnisch ward, nur zum Stargarder Gau gehört haben kann, und dass in Ebbos Meldung, Herzog Wartislaw sei 1124 vom Schlosse Zitarigroda nach Uzda (Guscht) zum H. Otto übergegangen, castrum als Burgward zu verstehen sei (Baltische Studien 15, 1, 188 s. Jetzt habe ich beizufügen, dass Tankow 1303 im Lande Friedberg.), wie es nicht selten vorkommt.
Karte vor 1945: Dammscher See
Die Nordgrenze wird 1240 nicht angegeben, woraus folgt, dass hier die unter Wartislaw III stehende Camminer Castellanei austieß. Als Barnim 1248 das Land Stargard als Lehn zurücktauschte, jedoch dem Bischofe das davon abgezweigte Land Massow ließ, und er 1264 den Vetter beerbt hatte, da wurden, dem Versprechen von 1264 gemäß, 1269 auch die Nordgrenzen von Massow und weiterhin von Stargard bestimmte vom Einflüsse der Pilesche in die Stepenitz gegen das bischöfliche Land Naugard (dessen letzte Orte Wismar, Pflugrade, H. Schönau), dann (gegen das Land Daber, neben Schönenwalde nordwärts) auf den See Mokere (Oker), von ihm den Fluss Halbirte Dobere hinab bis zur Furt des Weges von Schwerin nach Stargard (O. von Kannenberg), von da — über den Anfang des Crampel — auf das (mir unbekannte) Moor Rogo, dann auf den See Dolgen (bei Blankenhagen), von dessen Ostende ostwärts zum Fräuleinspfeiler (am Frauenberg) durch die Seen Klein und Groß Gniz (bei Kanitzkamp, und so weiter ostwärts zur Drawe; hier waren 1248 die Seen Fercnitz, Stüdnitz und Gr. Mellen (bei Grassee) 1248 in Stargard unter Barnim, Wosterwitz und Wollen 1254 unter Wartislaw, also zu Daber (Siehe mein Aussatz: Die Grenzen des Landes Massow, B. St. 10, 2, 163 ff. (wo S. 167, Z. 21 zu lesen: nach säst gleichzeitigen), etliche Verbesserungen 15, 1, 185 s. Durch den Aussatz veranlasst, teilte mir Herr Sup. Wentz, früher in Mulkentin, mit, dass genau da, wo ich nach der U. und der G. St. Karte pons Brunonis, castrum Peszik und die sepulcra paganorum gesetzt, sich die Brunsbrügge als vergangener Weg durch das Moor bei Carlsruhe, ein Burgwall und Hünengräber befinden.). Das ist denn die Grenze, die nach der U. von 1248 „hinter dem Crampel bis zu den Grenzen der Polen in gerader Linie durch die Wüste in verschiedenen (rolroaotis) Zeiten bestimmt ist“.
Endete die Grenze des Landes Stargard 1240 am Damm- schen See bei Plöner Ort, so kann das zuerst in der U. von 1248 genannte Land Golnow (der Ort erscheint schon 1220) als nebst der unteren Ihna unter Barnim stehend, nur von Stargard abgezweigt sein. Seine Grenze mit Massow endete 1269 am Einfluss der Pilesche in die Stepenitz (s. o.); diese begrenzte das Land nordwärts, ward 1295 die Scheide zwischen dem Stettiner und dem Wolgaster Landesteil vom Haff bis zum Gubenbach, dann dieser bis ans bischöfliche Land Massow (Das Haff wird der Länge nach geteilt bis zum Fluss magnus Stepeniza; zum Stettinschen Teil gehören östlich der Oder zuletzt civitas Golnowe usque in fluvium magnus Stepeniza et sic ulterius usque in altum pontem, (das Komma ist notwendig) Stepeniza ulterius usque in fluvium Ghouena, Ghouena ulterius (längs des Massowschen) usque in campum ville primus. Darnach gehört das 1291 existirende D. Kriwit nicht zu Golnow, wohl aber 1269; entweder findet ungenauer Ausdruck statt, oder es ist Veränderung eingetreten; ich nehme das erste an, weil das D. 1291 ein Gerh. v. Golnow erhielt und später die Carthaus bei Stettin. Basentin war nicht in Golnow, weil die FM. von der Stepnitz durchschnitten ist, also auch Retztow nicht.).
Karte vor 1945: östlich der Oder – Cammin – Stettin
Die gesamte Nordgrenze wird bestätigt durch das, was über die Camminer Castellanei bemerkt werden wird.
Das Land Massow ist neue Abzweigung, seine Grenzen also neu außer gegen Naugard, wo sie nicht spezialisiert werden, weil beide Gebiete bischöflich. Die übrigen Grenzen des Stargarder Landes werden als die in vorigen Zeiten bestimmten bezeichnet, sind aber nicht überall die zu der Zeit der U. bestehenden politischen.
Denn die alte Nordostgrenze durchschneidet die 4.000 Hufen, welche Barnim 1257 an Graf Gunzelin von Schwerin verlieh, die bald hernach von (Neu-) Schwerin und Welsenborg benannten Distrikte, gelegen „zwischen dem Lande Stargerth und dem Lande Doberen“ und längs der Drage bis nahe Reetz hinabreichend. Und auf der andern Seite durchschneidet der Grenzfluss Plöne das Land Colbatz, das der fürstlichen Nebenlinie der Swantiboritzen und mit ihr zur Stettiner Castellanei gehörte (9). Ja Barnim verfügt 1243 über die Holzungen und Weiden zwischen Damm und Golnow, welche 1220 von Swantibor an Colbatz vergabt wurden, und das hat wohl lange Streitigkeiten des Herzogs mit der Abtei, aber nicht mit dem Bischofe veranlasst (Vgl. C. P. 696, 300, 755 x. Der Streit hatte noch andere Gründe.). Die retroacta tempora, in denen die 1240 überwiesenen Grenzen bestimmt wurden, liegen demnach vor Wartislaw, dem ersten bekannten Besitzer des Landes Colbatz und Stifter der Abtei, sind die heidnischen; die Grenzen aus ihnen her sind dann die des Tempelgaus, und es muss eine Beziehung gegeben haben, in welcher sie in Erinnerung bleiben und dem Bischofe überwiesen werden konnten, ohne den Swantibor zu beeinträchtigen, den Herzog in jener Verfügung zu behindern.
Zuvor jedoch von den durch den Stargarder Gau abgeschnittenen westlicheren. Da er an der Plönemündung dicht vor Stettin endet, so wird der Pyritzer gleichfalls westlich durch die Oder begrenzt sein, was durch die 4.000, die S. Otto 1124 zu Pyritz bei einem Cultusfest versammelt fand, durch die 7.000, die er dort taufte, in Berücksichtigung der damaligen Bevölkerungsverhältnisse eine Bestätigung findet. Auch steht nach Einführung deutscher Verwaltung um 1245 alles zwischen Plöne und Oder unter dem Vogt von Pyritz; er ist (nur noch mit dem Marschall) Zeuge in der U., wodurch von des Klosters Colbatz Leuten Pfandgeld zu nehmen verboten wird, (mit anderen) in einer Bestätigung der Besitzungen und Grenzen des Klosters, bei einem Vergleiche mit demselben über die Fischerei im Dammschen See, die Dörfer Kl. Mellen, Damerow und Borin, bei allen einzelnen Vergabungen Barnims an dasselbe, nämlich von Falkenberg, Wartenberg, Babin, Lukowe Zedeliz (Dreger p. 349, 376, 420, 364, 379, 380, 535, 356 (stets nur Godekin, Advocatus, er war es von Pyritz, lb. 379, 422, 441, 481, der gleichzeitige Stettiner hieß Wilhelm, Willekin). Das Colbatzische Selow nördlich der Plöne lag auch 1268 in der Vogtei Stargard, Dreger 435, 220.) (d. i. Kerkow im spätem Lande Schildberg), im Stiftungsprivilegium von Greifenhagen. Und die Vogtei Stettin, wie sie 1278— 1312 Leibgedinge der Wittwe Barnims war, begreift nur das pomoranische Land westlich der Oder, es ist auch vorher kein Indicium, dass ihr überoderisches angehört habe; beide Vogteien repräsentieren denn die Tempelgaue.
6. Der Bischof erhielt 1240 das Land Stargard „mit allem Recht, nämlich Vogtei, Zoll und moimta.“ Von der Vogtei war Colbatz eximirt, natürlich auch Fürst Swantibor. Die moneta hält man für eine Münzstätte, ich halte sie für die Geldabgabe, welche so, deutsch Münte, Müntepenninge, Olde munt hieß, sie für den zur heidnischen Zeit auferlegten Tribut, der dann nach den Tempelgauen erhoben ward, diese in der Beziehung fortsetzte, so dass sie als Vogteien wieder ins Leben treten konnten.
Zum Tribut oder census argenti wurden die nordwestlichen Wenden successive durch Kaiser Otto I verpflichtet, und sie entrichteten ihn außer den Zeiten des Abfalls, der Freiheit. Die dem Sachsenherzoge untergebenen wurden zu ihm, der dort wojewodniza, Herzogsgeld, hieß, wieder seit 1093 genötigt, die östlich der Reknitz 1114. Auch Markgraf Albert muss die Liutizen seiner Mark durch die Feldzüge von 1135, 1130 dazu gezwungen haben, denn mit dessen Zustimmung vergabte am 10. August 1130 Kaiser Luthar die Tribute der vier Provinzen in dessen Mark, Groswin mit Rochow, Lassan, Ziethen und Medziretsch an Bischof Otto, den Bekehrer des Landes, und fügte vom seinigen (als Herzog von Sachsen) den der Provinz Tribsees hinzu (Dreger p. 349, 376, 420, 364, 379, 380, 535, 356 (stets nur Godekin, Advocatus, er war es von Pyritz, lb. 379, 422, 441, 481, der gleichzeitige Stettiner hieß Wilhelm, Willekin). Das Colbatzische Selow nördlich der Plöne lag auch 1268 in der Vogtei Stargard, Dreger 435, 220.), aber diese und die anderen pommerschen Liutizenlande kamen vor 1170 unter Heinrichs des Löwen Oberhoheit, wurden von dem Tribute frei, als Boguslaw I 1181 Reichsherzog, 1185 dänischer Vasall ward. — Auch für das pomoranische Land von der Randow bis zur Leba musste sich Wartislaw I 1121 zum Geldtribut an den Herzog von Polen verstehen, der 1138 dem Krakau besitzenden Oberherzoge zu Teil ward, durch die späteren inneren Kriege in Polen ein Ende nahm; auch die Fürsten von Niederpommern, Ratibors Nachkommen, wurden 1178 davon befreit, gleichzeitig auch die in Oberpommern, beide bis dahin von polnischen Chronisten quaestores vectigalium betitelt, die zweiten pflichtig seit c. 1115 (Dreger p. 349, 376, 420, 364, 379, 380, 535, 356 (stets nur Godekin, Advocatus, er war es von Pyritz, lb. 379, 422, 441, 481, der gleichzeitige Stettiner hieß Wilhelm, Willekin). Das Colbatzische Selow nördlich der Plöne lag auch 1268 in der Vogtei Stargard, Dreger 435, 220.).
Dass nun mit der Zahlung des Tributs an die Oberherrn die Erhebung desselben im Lande nicht ein Ende nahm sondern für die Fürsten sich fortsetzte, ist an sich zu praesumieren, — sie hatten ihn ja als mit der Reichsherzogswürde verbundenes Lehn vom Kaiser, als Erben des polnischen Oberherzogs durch dessen Aufgeben, und das Aufhören einer Steuer ohne Aequivalent ist etwas so wenig vorkommendes, dass man positiven Beweis zu fordern hat, — aber auch urkundlich zu erweisen; der Schwetzer Fürst Grimislaw verlieh den Johannitern das Schloss Stargard (a. d. Ferse) „mit zugehörigem Tribut“. Er wird auch sein müssen das vectigal (s. o. quaest. vect., auch sonst für den Tribut gebraucht,) von dessen Zahlung die Besiedler von Duckow in Tolense 1229 und von Rakow c. p. in Loitz 1232 befreit wurden, der census (f. o. census argenti), den 1176 die Colonen auf der Fm. Prilipp (in Stargard NB.) dem Landesfürsten nicht entrichten sollten „mit dem übrigen Volke“ (ib. 412, 445, 98. Als das Schloss Lebbin 1186 der Dompropstei zugewiesen ward, befreite der Herzog es mit den Zubehörungen et ab omni exaetione et servitio [das ist gewöhnlich, das folgende nur hier] et a qualibet extorsione quocunque nomine censeatur, que nobis et nostris successoribus debentur (ib. 142). Eine dem Fürsten schuldige extormo kann nicht Erpressung übersetzt werden, wiederum darf man auch das Wort nicht mildern; es passt nur für den von Polen zwangsweise auferlegten Tribut, ist vermutlich Übersetzung seines slawischen Namens; qualibet soll alle ihm ähnlichen, an seine Stelle tretenden Auflagen ausschließen.).
Dieser Zins ist also eine allgemeine Grundsteuer in Gelde, wie der Tribut, alle übrigen damals vorkommenden Lieferungen und Leistungen in ganz Pommern sind naturale. Auch die Münte ist eine von den Dörfern entrichtete Grundsteuer, — sie ward später teils mit den Dörfern verliehen, wovon das älteste mir bekannte Beispiel von 1292 ist (Die Herzoge confirmieren der Stadt Demmin ihre Eigentumsdörfer mit allem Recht und Nutz, mit Vogtei, Bede, moneta, mit Gericht etc.), teils zu den Burgen abgeführt und mit Burglehn auch ohne die Dörfer verliehen (Die Müntepenninge der Eldenaschen Dörfer im rügischen Gebiet kamen zur Burg Loitz und mit ihrem Burglehen an die v. Penz (Klempin u. Kratz Matrikeln etc. der pomm. Ritterschaft S. 14.), war einst die einzige, da der Name — Geldabgabe, ist nach dem Vorkommen und der Benennung Olde munt älter als die etwa 1250, also bei eintretender Verdeutschung eingeführte Bede, precaria, bestehend in Bedekorn und Bedepenningen, (daher gegensätzlich Müntepenninge). Die daraus erschließbare Identität von Tribut und Münte, ergibt sich direkt aus ostpommerschen Verhältnissen. Der Bischof von Wladislaw ward 1148 bewidmet auch mit dem zehnten Teil der moneta (8); er verlieh den Johannitern zu Stargard von der Jatlunschen Provinz die mannigfachen Zehntungen, darunter auch die zehnte Mark von der moneta, Mistwi I dotierte 1217 das Zuckausche Nonnenkloster mit Dörfern und „fügt hinzu, auch was [darin natürlich] an Pferden, Geld und andere Sachen auf seinen Teil trifft“; er war nun damals einziger Landesherr; der den anderen Teil bezog, kann also nur der Bischof sein, dem der zehnte Teil von dem allen, auch von Füllen (nach der U. von 1198) zustand. Die moneta ist weder in der ersten noch in der zweiten U. als Münzstätte zu fassen, — sonst würde nach dieser der unbedeutende nie wieder genannte Jatlunsche Distrikt eine solche, nach jener das damals in vier Herzogtümern getrennte, aus zehn in den Lardesteilungen heraustretenden Hauptprovinzen bestehende Polen nur eine einzige gehabt haben (Man könnte einwenden, wenn die moneta der Tribut Oberpommerns, so sollte man ihn in der U. mit dem Zehnten des castrum Gdansk verbunden erwarten. Aber damals ward der Tribut noch an den polnischen Oberherzog abgeführt, von ihm hatte der Bischof den Zehnten zu empfangen, nicht von den Zahlern in Pommern.), beides unannehmlich, — sie muss in beiden und mit der Geldabgabe der dritten identisch sein; und diese muss (da die Dotation des Gnesener Erzstifts von 1186 nicht nur die Eigentumsdörfer sondern auch alle Bauern darin namentlich, ebenso ganz speziell alle ihm zehnpflichtigen Gegenstände aufführt, aber nichts von der moneta hat, sie muss etwas sein, was nur der Wladislawsche Sprengel hat, was nicht in Polen, nur in Pommern vorkommt, sie muss der Tribut sein (Man könnte einwenden, wenn die moneta der Tribut Oberpommerns, so sollte man ihn in der U. mit dem Zehnten des castrum Gdansk verbunden erwarten. Aber damals ward der Tribut noch an den polnischen Oberherzog abgeführt, von ihm hatte der Bischof den Zehnten zu empfangen, nicht von den Zahlern in Pommern.), — wie 946 die Havelberger, 965 die Magdeburger Kathedrale den Zehnten vom Tribut, vom Silberzins wendischer Völker erhielten, — und dieser, noch 1198 so benannt muss sein als Geldsteuer die Geldabgabe von 1217, die monota. Dass in der U. von 1198 die damit verschwindende und die neuere Benennung zugleich vorkommen, ist nicht dagegen; auch findet ein Unterschied statt, der Bischof erhielt seinen Zehnten nur bar, als moneta, der Zahlungspflichtige konnte überall im MA. auch durch äquivalente Naturalien zahlen.
Für Anweisungen auf die Münte halte ich nun in unserm Herzogtum die Verleihungen bleibender Jahrgelder, wo es bloß heißt in, de moneta (wie in, de taberna, theloneo, in aqua), dagegen für Anweisungen auf die herzoglichen Münzstätten, wo es heißt: marcas denariorum in moneta (Stettin z. B. oder Stetinensi) persoluendas, per-, ac-cipiendas, die älteste ist von 1236 (C. P. 840 (1018 über die Zeit). Münzer erscheinen zuerst c. 1200 im Fürstentum Rügen, 1220 zu Stettin (C. P. 202, 331), hier Echiherd, nach der Namensform (= Eckard) ein Süddeutscher, Bamberger.); wo possidendas, possidendas et recipiendas steht, kann auch das erste stattfinden, nämlich dass der Berechtigte die Summe von der Münte seines Eigentums selbst erheben (recipere) soll. Diese Zahlungen aus den Münzstätten können nun nicht von dem Profit beim Prägen und Umprägen geleistet sein (Dazu war derselbe zu gering und schwankend, die Zahlungen zu groß; aus die Stettiner moneta z. B. finden sich aus den Jahren 1240 f. s. jährliche Zahlung von 16, 6, 5, 4, 2, 2, 10, 10, 30 Mk. Pf. nach vorhandenen U. gelegt, wie viel kann das Unbekannte sein! Die Annahme: die Müntepenninge seien eine Auflage, damit gemünzt werden könne, supponiert eine Art Schwabenstreich. Auflagen sind im MA. stets nur durch die Not erzwungen und bewilligt.), sondern diese fungieren als fürstliche Hauptkassen, — daher auch, wenigstens später, als „wessel“, — die aber, weil neben den Zahlungen aus ihnen die von Krügen, Märkten, Zöllen, Wassern vorkommen (17), ihren Zufluss zunächst und vornehmlich von den Müntepenningen gehabt haben müssen (Im MA. sank der Silbergehalt und Wert der Münzen beständig und verhältnismäßig rasch; die Geldabgaben wurden o. Z. in Münzen der verschiedensten Art und Zeit, auch in arabischen Dirhems entrichtet; so erklärt sich die Abführung an die Münzstätten leicht; das Umprägen der älteren mehr silberhaltigen Münzen in currente warf auch etwas ab.). Dies bestätigt sich daraus, dass Belbuk 1263 von der Münze in Camin 15 Mk. Pf erheben soll, auch wenn etwa diese Münze an einen andern Ort verlegt werden sollte, überall wo sie im Lande Camin sein wird (Dreger 471; conferimus aummam de moncta colligendam [da bei Dr.]; also sollen die 15 Mk. in mehreren Posten erhoben werden.); die Münzen waren also an die Hauptdistrikte gebunden, wofür kein andrer Grund ersichtlich ist, als weil sie daraus ihre Zuflüsse hatten, und ist auch hier Camminer Land = Tempelgau. Dafür ist auch, dass monetae nur von Tempelfesten vorkommen, zwar nicht von allen aus Urkundenmangel, z. B. nicht von Demmin, wo sie doch zweifellos. — Aus dem dargelegten folgt aber nicht, dass nur Münzstätten die Kassen waren, in welche die Münte abgeführt ward; für Stargard namentlich möchte ich das Gegenteil daraus erschließen, dass 1248 das Kloster Marienfließ im Lande Stargard als Zeugnis, dass es mit 500 wüsten Hufen in demselben dotiert sei, eine Kanne Honig jährlich empfangen solle in der moneta der Stadt Pyritz, also in der Münzstätte daselbst, die es also in Stargard wohl nicht gab.
Dem Tribut waren natürlich auch die Güter der Swantiboritzen unterworfen; ist er die moneta, so ist die Beziehung gefunden, nach welcher dieselben dem Bischofe 1240 untergeben werden konnten. Ich schließe mit der Bemerkung, dass der Bischof, war die moneta nicht die Münte, ein schlechtes Tauschgeschäft gemacht hätte, da die Güter Swantibors, der Abtei Colbatz, der Johanniter frei von sonstigen Abgaben und Leistungen waren, ebenso o. Z. das zu Stargard gesessene Herrengeschlecht (21); ein Teil war schon alter Besitz des Stifts, der Rest meist wüste (Ist moneta, Münte = Geldabgabe, speziell die durch die Münzstätten vereinnahmte, so kann sie in andern Ländern einen ganz anderen Ursprung, mit der in Pommern, Mecklenburg etc. nur den Namen gemein haben.).
Karte vor 1945: Swinemünde – Wollin
7. Zum Wolliner Tempelgau gehörte selbstverständlich die Insel Wollin, auf ihr zunächst das castrum Lebbin. Es stand 1124 unter Stettin, S. Otto predigte dort, machte den Anfang einer Kirche, stellte Geistliche an; Kasemir I verlieh es mit Zubehör der Kirche S. Nicolai im Schloss, Boguslaw I legte diese damit Ende 1186 der Dompropstei bei, es gehörten dazu [zu Kasemirs Vergabung] (Alles angeführte pertinent ad locum, auch Lauen, Brietzig in Pyritz, Vitense in Gützkow, das konnte erst nach der Vergabung gesagt werden.): die Wiek vor dem Schlosse, die Dörfer Trestingowe (Stengow , Soramtzt [bei Viezig?] (2) Lasca (Lazig), Kampenze (Werder), Szulomino (Soldemin), Selaszo [Karzig?] (zrambiz = Aushau (im Walde), zlasu = aus dem Walde sind zufolge der Reihenfolge, die local, für die angegebenen Propsteidörfer genommen; wy‘zke = hoch belegnes, karszke = ausgerodeles.), die Schiffe und Krüge [d. h. Fischereistätten, Bitten, stationes] zwischen Swina und Swantuntz [dem ehemaligen Ausfluss bei Swantust d. h. heilige Mündung], die Wehre in diesem (Notwendig in ipso mit dem zweiten Transsumt, da „alle in der Swine“ folgen.), Uszt [d. h. Mündung], die Lauensche Becke] mit dem [zugehörigen Fischer-] Dorfe Lewen (Lauen, c. 1600 Lowen), eine Hufe im Dorf Szolbino [Swantust) (Keinenfalls Scholvin, sondern, weil es von den Dörfern und Zehntnern ganz getrennt steht, gleichfalls Zubehör von Uszt und Schwantuntz.) mit dem Zehntbauern Szolbitz, alle in der Swina befindlichen Wehre, die ganze Wüste, die sich erstreckt von der Swina bis jenseits des Sees Gardino [Jordan auf der G. St. K., aber Gordan bei den Umwohnern] (Wie töricht daher, dass jemand hier des Tacitus See der Hertha [Nerthus richtig] gesucht hat, weil Erde = nordisch Jord.) und des Dorfs Charnetiz [vgl. den Berg Granick, N. von Wolmerstädt] mit Beutnerei und Jagd, die Zehntbauern Pletsenitz (C. P. 142 mit der Anm. dort und 991; wo ich hier abweiche, habe ich scharfe Klammern.) [bei Plötzin, vermutlich zu Soldemin geschlagen] (Plötzin selbst war 1288 adlig, kam hernach ans Wolliner Nonnenenkloster. Die Zehntner heißen vom Dorf, wie der Szolbitz von Szolbino. Zwischen vematione und decime ist ein Punkt zu setzen, denn was sollte in der so ausgedehnten Wildnis Honig- und Jagdrecht eines Bauern bedeuten?). — Die Lauensche Beck und Swantust erscheinen später als Grenze des Camminschen, gehörten offenbar auch 1180 dazu mit den Zubehörungen Lauen und Szolbino, der Zehntbauer nach unserer Auffassung, zur Camminschen Tempelfeste, wie die Pletsenitz zur Wollinschen.
Zur Burg Wollin gehörte denn der Rest der Insel, aber 1121 auch Landung jenseits der Divenowbrücke, 1194 das D. Drammin (Ksp. Zebbin). Die Kirchen zu Latzke, Sabin (Zebbin) und Marentin (Martentin) erscheinen 1288 als Filiale der Kirche S. Georgen in Wollin (Vgl. Steinbrück Klöster 161 mit Oelrichs U. V. 18 über das Wolliner Nonnenkloster.), der von S. Otto gestifteten S. Adalberts Kirche, wie es die erste geblieben ist, aber Kirchspiele und Distrikte sind in der ersten christlichen Zeit in Pommern identisch. Conow ist um 1290 im Besitz eines Edeln, der den Wollinern beizuzählen ist, Hohenbrück erscheint in der Teilungs-U. von 1295 als ein Grenzpunkt. Da Jomsburg eine dänische Anlage war, deren Vikinger natürlich zu ihrer Sicherheit auch etwas östlich der Divenow in Besitz nahmen, da Wollin hernach nur Burgherrschaft (11), Cammin aber eine herzogliche Hauptburg war, deren Edle die pomoranischen Besitzungen der Demminer Linie repräsentieren: (Vgl. besonders C. P. 445: quam plures Caminensis et Diminensis provinciarum nobiles.) so wird man das Wolliner Gebiet nicht über jene Kirchspiele und Hohenbrück hinaus setzen dürfen.
8. Im Jahre 1273 verglich sich Barnim mit den Capiteln zu Cammin und Colberg über die Abgaben, die statt der Zehnten in den Ländern Cammin und Colberg von den in den Wüstungen anzulegenden Dörfern entrichtet werden sollten, von den Hufen der Deutschen einen Schilling an den Bischof, zwei an das betreffende Capitel, von den Haken der Wenden resp, einen halben und einen Schilling (Extrakt der U. bei Wachsen Altstadt Colberg S. 458 und C. P. S. 814 n.). Es sollte also das Domcapitel solche von der Camminer Castellanei beziehen, hatte sie zufolge der Verträge 1318, 1338 im Lande Quarkenburg (dessen südlichste Orte im 15. Jahrhundert Wolchow, Kykker und [ein kleiner Antheil von] Schönhagen), 1277 im Lande Daber, 1338 in den dazu gehörigen Dörfern der v. Wedel zu Mellen, Schwerin etc. (also im Lande Neu-Schwerin), 1297 in den Gütern der Loden zu Trieglaff, 1315 der Manteuffel zu Cölpin (2). Die drei ersten stoßen unmittelbar an die ermittelte Grenze des Stargarder Tempelgaues, die letzten ein wenig ans Colbergsche. Zum castrum Camin gehörte 1159 die Provinz Sliwin (von Schleffin mit dem D. Pustichow am Meer (3). Im Caminschen districtus lagen 1261 Klötikow, 1255 Carow, mit diesem also auch das schon existirende und den Borken gehörende Land Labes, mit jenem das Land Treptow, worin es 1221 lag. Dies nun, wie es damals zum Treptowschen Nonnenkloster und unter den Abt von Belbuck gegeben ward, enthielt alle Dörfer ausdrücklich bis zum Grenzbach Dambsniz (Zarbensche Bach) mit Einschluss von Lestin, Roman und Reselkow, ein Teil jedoch mit anderen, auch Zarben war schon 1177 und 1208 an Belbuk vereignet (C. P. 70, 205. 987. Papenhagen ist 1802, Lestin c. 1580 zum Fürstentum Lammin geschlagen.). Und 1201 machten die Pröbste von Camin und Colberg über die Scheide ihrer Amtsbezirke den Vergleich, dass jenseits des Flusses Dampsne, welcher das Colbergsche Land scheidet gegen Trebetowe und Grisenberge, die Parochien Czarben, Guslaveshagen und Ghoravin mit allen ihren Dörfern zur Colbergschen Präpositur gehören sollen, damit sie mehr Mittel habe die dem Colbergschen Capitel in ihnen zustehenden Zehnten einzutreiben, von Ghoravin aber (wovon also die Parochien Drosedow und Reselkow erst später abgezweigt sind) gegen Schivelbein oder seu (Nie ist seu als rein = et zu fassen, zeigt vielmehr an, dass die verbundenen in irgendwelcher Hinsicht identisch sind, für einander gesetzt werden können.) Stoltenberg sollen die Grenzen sein, wie sich die wahren Grenzen des Colbergschen Landes erstrecken; wobei zu bemerken, dass die Parochien Zarben und Drosedow noch heute von der Dambsnitz durchschnitten sind, und nur die Orte östlich derselben Zehnten ans Colberger Capitel entrichten konnten, weil von den westlichen sie Belbuk hatte. Aus dieser U. und der obigen von 1273 erhellt, dass die Amtsbezirke der Pröpste und die Zehntdistricte ihrer Capitel bis dahin grundsätzlich identisch waren mit den beiden Castellaneien, darnach die Scheide zwischen beiden schon so bestand, als beide Propsteien gestiftet wurden; beide Pröpste aber erscheinen zuerst 1175.
9. Die Westgrenze des Landes Colberg wird nun 1321 also beschrieben: Die Drawe von Reppow hinab bis zum Einfluss des (Küchen-) Fließes, das aus dem (Bornschen) See (bei) Wusterwitz ausgeht, das Fließ hinauf bis in diesen See, bis wo in ihn geht ein Fließ, das (durch den Gr. Netzin- und den Gellin-See geht, und als Rie) aus dem See Clantse (Klanzig) kommt, und aus diesem weiter zur Reghe geht; diese hinab bis zum Fließ Klemperitz (Glüziger Mühlenbach), dies hinauf bis zum (Glüziger) See Klempesicke, aus dessen anderem Ende die Moltstow ausgeht; diese hinab bis zu einer Rie (bei Wischenort) aus einer Quelle zwischen Petershagen und Resenekow; dann gerade vor das Bruch Belawe (das am Belowberge) bis zur Landstraße von Belgard nach Roman, quer über sie zum Ursprung der Dambsiz (östlich von Lestin), so dass die Haide stiftisch, der Acker herzoglich; die Dambsiz hinab bis in die Blotnitz (Spiebach), diese bis See Reghe (Campsche) und wo dieser ins Meer geht (U. mit der Bestätigung von 1856 in Schöttgen und Kreysig Pom. dipl. N. 48.). — Diese Grenze bestand, wie wir gesehen, vom Meer bis zur Molstow schon 1175, o. Z. auch längs der Molstow bis zur Rega; aber weiterhin muss das Land Schivelbein mit der Westgrenze von 1337 — sie ist die heutige bis Nuthagen, welches erst 1388 von den Borken verkauft, so Pommern entfremdet ward, endet zwischen Sarranzig und Dramburg (Vgl. Blt. St. 15, 1, 196 ff. Dort habe ich die Identifizierung Nylep = Nelep, Gressen = Grössin verworfen; im zweiten hatte ich Recht (Grössin ist alte Pfarre, Gressen war es nicht), aber nicht im ersten.), — ursprünglich zu Colberg, nicht zu Cammin gehört haben; das ist in der Alternative schon aus der Lage und dem so geraden, sonst stark eingebogenem Grenzzuge zu präsumieren; es lässt ferner die U. von 1291 erschließen, dass wie Stolzenberg (bis ins 17. Jahrh. oppidum), so auch Schivelbein, gewissermaßen identisch, binnen der alten Grenzen des Colbergschen war; daraus allein lässt sich der Anspruch des Camminer Bischofs ans Land Schivelbein erklären, den der Markgraf durch Lehnsempfängnis anerkannte, wie zugleich beides bei dem bis 1276 bischöflichen Lande Lippene stattfand.
Die Grenze zwischen Belgard und dem (zuerst 1281 und als solches verkommenden) Stiftslande Tarnhusen (Arnhausen waren 1321: die Tepele (Teipel) vom Einflüsse in die Persante bis zu ihrem Anfang im Rorbrugk zwischen den D. Ganscow und Navin; dies Bruch (das bei Teipelskrug und Judsgrund) hinauf zum und über den Fluss Mugellize (Müglitz), zum See Lype (ist nach der Richtung und der späteren Grenze der zwischen Retzin und Lutzig), von da zum Diefberg (Dewsberg), zum Malbaum vor dem Walde Loine (Polzinschen Busch), mitten durch ihn (und dann mit der heutigen Kreisgrenze) bis Cemine (Zemmin) gegenüber, wo ein Fluss ausgeht, bis zu einem Steinhaufen, von da zwischen beiden Dörfern Wrow (Alt und Reu Wurow) bis zum Dorfe Repekow (Reppow) an die Drawe. Und die Grenze zwischen Belgard und dem Stiftslande Cusfalin: die Radduje von, Einfluss in die Persante aufwärts bis zum Fluss Cotle (Kautel), dieser aufwärts bis zu Wendengräbern (wohl bei Gräberhof), dann zur Quelle des Wassers Lubank, dann gerade aus zum See Lositze (Lottsen), der stiftisch, dann entlang zwischen dem herzoglichen See Wirchow (dem Wurchowschen) und stiftischen Virchow (noch so), durch denselben Pfad zu den herzoglichen Seen Schmoltzigk (Schmaunsch) und Sparse (Sparseesche) und den stistischen Plottiz und Kitan (Plötschen, Küter), — bis hierher ist die Scheide die heutige, nur dass einige Dörfer auf beiden Seiten Äcker haben, — dann den Dolgen (noch so) mitten entlang, von da zum Orte Sadiker, dann zum Flusse Sarne (Zahn). — Von der Südgrenze der Castellanei Schlawe war 1310, 1313 das Westende (also das Dreiortmal mit dem Stiftslande) der Einfluss der Salnitz in den Tessentin-See (Blt. St. 15, 1, 175. Der genauer Abdruck der U. bei Cramer Gesch. von Lauenburg etc. 2, 4. 8 gibt statt Lessentin und Rewditz — Cezentzin und Czelditz, dies ist die Salnitz, über welche s. die U. in Benno Gesch. v. Cöslin S. 311.); es ist der ins Ostufer mündende Bach auf der heutigen Scheide der Provinzen. Von da südwärts ging die zwischen dem Bischofe und dem deutschen Orden 1342 so, dass unter jenem noch ein Punkt östlich des Wassers Balde (Ball) auf der Straße von Bublitz nach Schlochau (also wo hernach Baldenburg, und dann der ganze See Belizk (Belzig), von dessen anderen Ende (ohne nähere Bestimmung) zum Flusse Czarne und von ihm zum Orte Czadiker (s. o.). Durch den Grenzvertrag von 1350 ist dort ungefähr die heutige Grenze entstanden, auch die Feldmark Dolgen an den Orden gekommen, diese hernach (c. 1460?) ans Neustettinsche. Die stiftischen Orte an der Radüe, soweit sie die Grenze bildet, kommen als Colbergisch schon früher vor, namentlich 1159 die Brücke über die Radüe mit dem Holzflößzoll auf der Persante (also Cörlin, wegen des Zolls an der Grenze) 1224, 1227 Parsow, Zmogozewic und Chluco (zu Marrin gelegt), Mistiz (zu Schwemmin), Nedlin; andrerseits sind Bulgrin und die Nassowsche Heide 1288 Belgardisch. Aber Lüllevitz, 1299 Nachbarort des Eigentums der Stadt Belgard, wird um 1318 ins Colbergsche Land gesetzt (Die U. des Bischofs Conrad bei Wachsen S. 276 ist ohne Datum; mit Recht hält Wachsen Conrad IV (seit 1318) für den Aussteller (dann ist sie vor dem Grenzrecess von 1321), denn sie legt den Zehnten des Dorfs der Colberger Scholasterei zu, aber 1276 gehört er mit dem von Zimines zu einer der letzten, also jüngsten Präbenden. Er ist später so groß, wie sonst nur von mehreren Dörfern (s. Wachsen 385), also ist Zimines dazu gelegt, vor 1318.); es ist zu unbekannter Zeit vor 1454 an die Stadt Belgard gekommen, ich vermute 1320, und dadurch dem Stift entzogen. Südlich der Radüe lehren uns ältere U. zwar nur, das Bevenhusen (Schlosskämpen), der Virchow-See und die Feldmark Sülkow (Sassenburg) um 1280 im Stift, die Gegend um Persantica 1268, 1289 im Belgardischen lagen; es ist aber an der Ursprünglichkeit der Grenzen nicht zu zweifeln.
Ostgrenze des seit 1248 bischöflichen Landes Colberg war 1309 urkundlich der ganze Restbach von der Mündung ins Meer bis zur Quelle; er ist sie aber erst durch die Fehden von 1296 ff. geworden. Vorher verfügen die ostpommerschen Herzoge (und die zeitweiligen andern Herren der Castellanei Schlawe) seit 1248 über den ganzen Bukowschen See und die Landenge daneben, die Feldmarken Bukow, Jesitz oder Wiek und Damerow, ebenso über Pankenin und Zirchow, die nebst Kuhz (Cusiz) zu der von Bischof Sigwin (1193—1219) eingerichteten Parochie Nemitz, die 1250 unter Swantopolk stand, gehörten. Dagegen Eventin mit kleiner Fischerei in dem Teil des Bukowschen Sees bis Damke stand 1262 unter dem Bischofe, der es 1278 nebst den Feldmarken Belkow, Glesenowe (Wandhagen) und Karnkewitz an Bukow verkaufte, nachdem diese drei Feldmarken dem Kloster bereits 1265 verliehen waren mit solchen Grenzen, die erschließen lassen, dass sie nicht ganz in seiner Herrschaft (Dreger 454, 486, 501. 557. Oelrichs UB. 9, 10, 92. Die Unsicherheit der Grenze (in Dr. 486) rührt daher, dass das magnum stagnum vergangen ist; entweder war es die Schübbenschen Wiesen am Walde, bis 1704 See oder das Bruch westlich von Neu-Wiek.). Ebenso waren bischöflich 1278 Lase, 1287 Moker, 1278 der v. Cegelyn (Steglin) als Vasall; zum bischöflichen Gorbant gehörte bis 1308 ein Strich östlich des Nestbachs (also die nachmalige Feldmark Zanow). Oberwärts ward zwischen 1308 und 1820 von Peter, Swenzos Sohn (Herrn von Pollnow), Sydow im Lande Pollnow ans Kloster Pölplin vergabt mit den Grenzen: der ganze Pobanzin- (Papenzin-) See einschließlich, der See Geland (Giller) exclusive, der See Sidowe (Nieder-See) zur Hälfte, doch mit dem Werder darin, aus ihm die Mitte der Raduie hinab bis zur Scheide von Chucemin (Gutzmin); was südlich und westlich dieser Grenze (der heutigen des Kreises), besaßen 1357 als bischöfliche Vasallen dreizehn v. Kameke von ihren Vorfahren her seit lange (U. Schöltgen und Krehsig 1. c. N. 81. Das vom See benannte Sydow ist o. Z. die Erbbesitzung Prentwin des Klosters Pölplin, über die Peter und sein Bruder Jasco, Herr von Schlawe, 1320 einen Streit beilegten. Bagemihl 3, 6.). — Nach diesen ersichtlichen Grenzpunkten wird der Arrondierung wegen die Parochie Cösternitz bis 1296 dem Colbergschen Lande beizurechnen sein.
10. Der Umfang des Landes Belgard ist durch die dargelegten Grenzen der Castellanei Colberg und die Nordgrenze des Gebiets der Czarnken bestimmt, das Land Neustettin ist erst um 1350 davon abgezweigt.
Die Scheide zwischen den Castellaneien Schlawe und Stolp habe ich früher angegeben, und es sind mir seitdem keine Daten bekannt geworden, wodurch sie bestätigt oder modifiziert würde.
Karte vor 1945: Kolberg – Köslin – Bergard
Der Ostteil der Colberger heißt zuerst 1267 Land Cöslin; damals vereinigten sich seine Pfarrer mit denen des engeren Landes Colberg zu einem hier zu haltenden Kaland. Die Grenzbeschreibung von 1321 nennt als Belgard angrenzende Distrikte nur Arnhausen und Cöslin, scheidet sie durch die Persante, negligiert den dazwischen, auf beiden Seiten des Flusses liegenden Bezirk des Schlosses Cörlin, zu welchem später dienstpflichtig waren die Dörfer des Kirchspiels Marrin, das früher auch Schwemmin begriff. Daran stößt das große desertum, das nach 1260 mit den Dörfern der Parochien Lassehne, Schulzenhagen, Cordeshagen, Varchmin, Sorenbohm, Gr. Möllen, Bast und Gr. Streitz, auch Plumenhagen und Todenhagen im Kirchspiel Tessin bebaut wurde (Damit wird nicht geleugnet, dass einsame Höfe in der Einöde existiert haben können; Barchmin. Bast, Parpart.). Offenbar war dies desertum die Westgrenze des Landes Cöslin; zwischen ihm und dem Grenzfluss Radüe ist auf einer Stelle nur das Dorf Cratzig, dessen Pfarre 1278 dem Cöslinschen Nonnenkloster verliehen ward; zum Kirchspiel gehörte ehemals auch das Dorf Parsow, zum Lande denn auch bis 1320 Lüllevitz (s. o.). Seinen, den östlichen Teil des Landes Colberg, trat Barnim 1248 an den Bischof ab „mit allen seinen Zubehörungen, nämlich den Distrikten Poditzol und Contrine“ (C. P. 813 (die n. 4 vorzeschlagene Änderung ist unstatthaft) vergl. 1017.); sie können schwerlich etwas anderes sein, als das hernach von Cöslin benannte Land, der zweite nach der Bedeutring (Winkelung, Ecke) die südliche Spitze. — Überblicken wir nun den Umfang der Colberger Castellanei, so umfasst derselbe das Belgarder Gebiet von drei Seiten, reicht mit dem westlichen Teile südwärts so weit als dieses, bis zur Drage, mit dem östlichen bis zum Zahn, beinahe eben so weit. So kann es nicht ursprünglich gewesen sein, das obige Land Cöslin muss von Belgard, bis vor dessen Burg es mit Lüllevitz reicht, abgezweigt sein, daher deute ich jetzt den Namen Poditzol als das polnische podzial Teilung = abgetrenntes, wozu sich die Veranlassung bald zeigen wird.
11. Sehen wir nämlich, wie sich die vorgeführten Tempelgaue gruppieren.
Der Camminer Sprengel von 1140 ist das Pommern, worüber 1124, 1128 Wartislaw I Herzog war, welches Bischof Otto von Bamberg bekehrte. Dieser zog Ostern 1124 aus, um „die Lande der Pomeranen samt etlichen Städten des Landes Leuticia zu bekehren (Sein eigener Bericht in Ekkeh. ehr. univ. Pertz SS. 8, 263.). Indessen besucht er diese, Demmin, Gützkow, Wolgast und Usedom mit ihren Zubehörungen damals gar nicht (Anon. V. Ott 2, 37 Jasch. Ottos Bericht will sie nicht als damaligen Wirkungskreis, sondern als Zubehör des zu bekehrenden Landes darstellen.), 1128 sind sie Hauptziel seines Wirkens, wohin er kommt durch Deutschland, unter kaiserlichem Geleit, mit Gesandten des Markgrafen Albert; Wartislaw nennt (in Ansehung ihrer) den Kaiser seinen Herrn; als bald darauf Albert die Mark des Stadischen Hauses erlangt hatte, werden sie 1186 zu derselben gerechnet, und er bezog den Tribut. Das Christentum wird eingeführt durch gemeinsamen Beschluss des Herzogs und der zu einem Landtage versammelten Barone. Im Lande der Pomeranen missioniert Otto 1124 von Polen aus, aus Veranlassung und unter Geleit des Polenherzogs, dem es seit 1121 zu Tribut und Kriegsfolge verpflichtet ist. Von diesem Lande besucht Otto einen Teil nur 1124; in ihm sind Hauptpunkte Cammin, Wartislaws gewöhnliche Residenz, von dessen Distrikt die Witwe seines Sohnes ein ganzes Burgward an ein Kloster vergabt; Colberg, dessen Gebiet sein Urenkel Barnim (im Gegensatze gegen Stargard) sein wahres Eigentum von den Vätern her nannte, und Belgard, 1107 urbs regia, d. h. Residenzstadt, auch offenbar Ratibors bei Wartislaws Lebzeit. In diesem Teile hält Otto 1128 seine Tätigkeit für unnötig, 1124 wird eines Landtages, Beschlusses, einer Mitwirkung anderer nicht gedacht, also der dem Christentum geneigte Herzog treibt und fördert die Sache selbstständig und ungebunden. In die Gebiete jedoch von Schlawe und Stolp kommt Otto gar nicht. Im zweiten Teil wirkt Otto 1124 und, da er wieder abgefallen. 1128, jedoch erst nach Verständigung mit dem Polenherzog. Wartislaw hat zwar Häuser als religiöse Asyle in den Hauptcastra und gilt als Oberherr, kann aber gar nichts für das Christentum tun, sondern alles geht in Pyritz wie in Stettin und Wollin von den Bewohnern selber aus: er lässt sich so 1124 als 1128 gar nicht darin sehen, außer bei der ersten Begrüßung an der Grenze, wonach er sofort den Bischof verlässt, Geschäfte vorschützend, da doch nichts nötiger war, als die Förderung der Bekehrungsarbeit; dagegen findet er sich sogleich ein, als Otto nach Cammin kommt, bereist 1128 mit ihm die Städte von Liutizien.
Karte von vor 1945: Stettin
Stettin gilt als die edelste und älteste Stadt Pommerns, als mater oivitatum, die einen Principatus hat; sie fällt vom Christentum ab, tritt zugleich mit dem Herzog in ein gespanntes Verhältnis, verbindet sich schon vorher ohne ihn mit den Ruanen, unterhandelt ohne ihn mit den Polen, hat zu diesen so 1124 als 1128 ein anderes Verhältnis. Der Polenherzog übermacht 1124 den Vertrag genti Pomeranorum et populo Stetinensi, die Ruanen befehden 1128 die Pommern und die Stettiner. Auch 1133 dachte sich der Erzbischof von Magdeburg Stettin und Pomerana als zwei Diözesen (C. P. 26 (vgl. 982): westlich der Oder Stettin und Lubus, östlich Pomerana, Posen, Gnesen, Krakau, Breslau, Krußwitz, Masovien und Lolilaensis. Darnach verstand er wohl unter diesem den pommerschen, unter Kruschwitz den kujawischen Teil der Wladislawschen Diözese.); die Unterscheidung geht durch das ganze Mittelalter (Land zu Pommern im Unterschied vom Lande zu Stettin heißen 1820—1522 die Cast. Cammin und Wollin, teils mit, teils ohne das Stargardische nördlich der Ihna.). Wollin, obwohl mächtige Stadt, ordnet sich 1124 der Autorität Stettins unter und erklärt sich von ihm abhängig; Lebbin steht 1124, 1128 unmittelbar unter Stettin, (Von 1124 ist‘s berichtet, von 1128 ein Schluss daraus, dass die Ruanen im Stettinischen verheeren.). Die Polen rücken 1128 auf die Grenze der Stettiner, und zwar um Dramburg, wonach der Stargarder (also auch der Pyritzer) Tempelgau zum Stettiner Landesteile gehört, wie denn auch in der christlich-wendischen Zeit die Stettiner Burgbeamteten die fürstlichen Rechte in ihnen wahrzunehmen haben; so erklärt sich auch der Name Ina = altera, nämlich von Stettin aus, Plona (d. i. Fluss, fem., ist die erste.
Der Herzog steht demnach 1124, 1128 zu den Landesteilen in einem dreifachen Verhältnis. In dem unter die Mark und das Herzogtum Sachsen gehörigen Liutizischen ist er Landesherr, doch von den Baronen eingeschränkt. Im Stettinischen hat er nur oberherrliche Rechte, priesterlicher, auch wohl richterliche Art, daher die Höfe in den Tempelfesten als Asyle; Knes, auch in Pommern der Titel der Herzoge (1173 knezegraniza, Fürstengrenze. C. P. 91 (mit n. 11), gnezota 112 (mit 991).), polnisch ksiondz, bedeutet zugleich Fürst und Priester, ist wohl 995 durch judex ausgedrückt, kam nach dem Polen Boguphal nur dem Geschlechtshaupt zu, den abgeteilten Landesherrn der Titel pan, Herr (Bog. p. 19: pan in Slavonia est ... major dominus, xandz ... autem major est pan veluti princeps et superior rex.). Im dritten Landesteil, der teilweise noch 1248 als unmittelbares Eigen des Herzogs galt, waltet derselbe unbeschränkt; ihn bilden die Castellaneien Cammin, Colberg, Belgard, Schlawe, Stolp (Die zwei letzten, weil das Herzogtum bis zur Leba § 4. Dass Otto sie nicht besuchte, lässt sich erklären (s. § 21).
12. In diesem Teile — wir gehen nun zu den Fürsten über — beherrschen Ratibor I und seine Nachkommen, wie ich mit (ich denke) unwiderleglichen Gründen dagetan habe (Baltische Studien 16, 2, 54 ff. Jetzt habe ich hinzuzufügen, dass Barnims U. von 1229 (C. P. 496) angibt, viele seiner antecessores hätten die Johanniter begabt; das ist nur richtig, wenn Ratibor und Boleslaw, die das getan, dazu gehörten.), Belgard, Schlawe und Stolp, Wartislaws I Nachkommen Cammin und Colberg. Aber zu Colberg gehörte das Land Poditzol, dessen Name abgetrenntes bedeuten kann, dessen Lage einstige Zugehörung zu Belgard fordert; es ist klar: Wartislaw hat die zwei westlichen, der Bruder die zwei östlichen Castellaneien erhalten, die mittlere, das Gebiet der bisherigen Hauptburg, ist gleich geteilt. Diese Teilung, die Gruppierung der Gaue 1124 und die abweichende Dotation des Bistums im Lande hinter Colberg von 1140 bestätigen sich gegenseitig. Wartislaw zuerst unter den Herzogen Pommerns bekehrte sich zum Christentum nach Helmold, er hatte also heidnische Vorgänger. Seines Sohnes Boguslaws I freie Herzogswürde war nach Saxo paterna et avita. Dessen avus ist denn der (1102) 1107, 1108 von Boleslaw III bekriegte ungenannte Herzog; denn er war der einzige, — Martinus, der 1113 schrieb, kennt wohl mehre principes (Pane) aber nur den einen dux (Knes), auch dominus paganorum, der ein regnum hat, wären mehre duces gewesen, musste er sich anders ausdrücken, — seine Residenz, urbs regia 1102, war das bedeutende Belgard, er hatte auch Colberg, mit seiner Unterwerfung war fast das ganze regnum bezwungen ohne Gefecht (Mart. 1. cc. Dass das unterworfene eben das Gebiet des dux, geht hervor aus quinque enim etc. p, 217.), viele andere Festen, auch Cammin (Bog. p. 32 (Cosom ist Kaszam p. 24 und da Usedom, Uznaim, Osna, Fuznon; es ist die Wurzel znaim — renommé mit den Präpos. u, o. w. k oder ko). Stettin und Demmin fehlen, also ist die Notiz nicht willkürliche Individualisierung des von Kadlübek (A. 8) gegebenen, und nicht Übertragung aus dem Feldzuge von 1120 — 1121 in den von 1108, vielmehr geflossen aus einer kalendarischen Aufzeichnung, wie solche im sog. Archid. Gnesn. zusammengestellt sind.); es muss also der große Teil Pommerns, in dem sie lagen, weil Belgard davon Residenz und Mittelpunkt war (AIba war in meditullio, des Landes, quasi centrum terremedium reputatur.), der sein, den Wartislaw und Ratibor teilten.
Die vom Lobredner gemeldete Unterwerfung des Herzogs ohne Gefecht wird sich auf die Kriegsfolge beschränken, die er zusagte. Er wird sie 1109 geleistet haben in dem Kriege, den Boleslaw gegen Kaiser Heinrich um Beuthen, Glogau und Breslau führte. Denn damit zeigt sich eine Gelegenheit, die einzige, wo Wartislaw in pueritia nach Obersachsen entführt und zu Merseburg getauft werden konnte (Die liutizischen Streifzüge nach Obersachsen in 1113, 1115 sind zu spät für die pueritia, von anderen Einfälle der Wenden verlautet nichts. Man hat W. für einen Liutizen erklärt, aber dagegen ist alles hier ausgeführte, auch die damalige Zersplissenheit und Unmacht der Lintizen.), — die Stadt war ein gewöhnlicher Ausgangs- und Rückzugspunkt der Deutschen in den Polenkriegen, auch diesmal nach der ganzen Anlage des Feldzugs, — und zugleich erklärt sich [als Missverstand] die Entstehung der Fabel, der Kaiser sei in diesem Kriege gefangen und nach Colberg gebracht worden. — Wartislaw wäre dann etliche Jahre vor 1100 geboren; ehe er 1121 polnischer Zinsvasall ward, hatte er schon mehre Jahre mit Polen gekriegt; 1124 erscheint er als junger Mann, sein ältester Sohn hat den christlichen Namen Boguslaw, ist durch S. Otto getauft, starb 1187 mit Hinterlassung von Söhnen, die nach 1180 geboren. Ratibor „hatte den christlichen Glauben angenommen aus der Predigt des Bischofs Otto von Bamberg“, kommt aber 1124, 1128 gar nicht vor, war offenbar um mehre Jahre jünger als Wartislaw, 1124 noch nicht volljährig, 1128 wohl in den hintern Landen, wohin Otto nicht kam.
Wartislaw herrschte 1124 über das liutizische Peneland und über Tribsees. Das kann er nicht nach 1120, das gesamte nicht vor dem Tode des darüber herrschenden Wendenkönigs Heinrich († 22. März 1119) erlangt haben; namentlich ist zu den duces der Slawen, die diesem zur Kriegsfolge pflichtig waren und sie 1113 in dem Feldzuge nach der Insel Rügen von Wolgast aus leisteten, auch der 1128 unter Wartislaw stehende dux und princeps Mistislaw, Burgherr zu Gützkow [und Groswin] oder sein Vater zu rechnen. Da nun aber dem Heinrich auch die Pomeranen zinspflichtig waren, und das nur von liutizischem westswinischem Lande stattgefunden haben kann, so folgt, dass ihre Herzoge schon vor 1119 von solchem etwas unter sich hatten, dann das östlich von Gützkow gelegene, die Castellaneien Usedom und Wolgast, wohl seitdem sie 1103 von der dänischen Oberherrschaft frei wurden. Das bestätigt eine unverwerfliche polnische Angabe, welche die 1108 unterworfenen Festen des Belgarder Herzogs spezifiziert als Colberg, Cammin, Wollin, Usedom ((Bog. p. 32 (Cosom ist Kaszam p. 24 und da Usedom, Uznaim, Osna, Fuznon; es ist die Wurzel znaim — renommé mit den Präpos. u, o. w. k oder ko). Stettin und Demmin fehlen, also ist die Notiz nicht willkürliche Individualisierung des von Kadlübek (A. 8) gegebenen, und nicht Übertragung aus dem Feldzuge von 1120 — 1121 in den von 1108, vielmehr geflossen aus einer kalendarischen Aufzeichnung, wie solche im sog. Archid. Gnesn. zusammengestellt sind.). Dies letzte steht 1159 unter Wartislaws Söhnen, dann insonderheit unter Boguslaw l. als dessen Hauptsitz. Wolgast dagegen „lag 1162 zwar in Slawien, war jedoch von dessen gemeinsamem Gebiete gesondert und ward von eigenen (erschließlich nicht anwesenden) duces regiert; beim Angriff des Dänenkönigs riefen damals die Einwohner den Boguslaw zu Hilfe, der aber, mehr auf Frieden als auf Krieg bedacht, einen Vertrag für sie vermittelte, dass sie dem Könige sich unterwerfen, der Seeräuberei entsagen, Geiseln stellen“. Da Wolgast 1128 unter Wartislaw stand, von einem praefectus (vom Fürsten gesetzten Burgvogt) verwaltet ward, also weder eigene Fürsten hatte, noch dem Gützkowschen gehorchte, so ist nicht abzusehen, wer anders die bis 1162 dort herrschenden Fürsten sein konnten als Ratibors Söhne. Dann war nicht nur der unmittelbare pommersche, sondern auch der liutizische Besitz gleich geteilt, dieser schon dem Belgarder Anonymus untertan, ihn wenigstens haben seine Söhne erst nach 1128 geteilt, — das pomoranische nach 1124, — und Ratibors Söhne haben nach 1162 geteilt.
13. Im Sommer 1135 unternahm der Wendenkönig Retibur mit seinem Schwestersohne Dunimits und dem Häuptlinge Unibor einen Plünderzug nach Norwegen. Im zweiten Namen darf man den Punkt des ersten i streichen, dann bekommt man den Dommizl (Domysl), 1159 Bruder des Castellans Ostrobod von Usedom. Zu diesem und Ratibors Wolgast wird Wollin als der dritte Hauptsitz der durch die Dänen eingebürgerten Piraterie als der Sitz des Unibor anzusehen sein (Unibor im 14., Unnenbur im 15. Jahrh. ist das Dorf Tonnenbuhr bei Gülzow, aber der Häuptling saß jedenfalls an der Küste. Vgl. § 27.).
Man hat gefolgert, dass Wartislaw damals schon tot gewesen, aber das ist nicht notwendig, da aus seinem und dem eigenen Gebiete Ratibor die Raubflotte gesammelt haben kann. Wartislaw ward getötet und begraben zu Stolp an der Pene, wo zu seinem Gedächtnis eine Kirche erbaut ward, bei welcher Bischof Adalbert den Benedictinerconvent errichtete unter Ratibors Mitwirkung und ihm 1153 die erste Urkunde erteilte. Unsere Chroniken verstehen interfectus von Meuchelmord, vielmehr ist eine Kriegsfehde gemeint, dann der erste Heerzug, den Markgraf Albert, seit 1133 Herr der Mark, 1136 ins tiefere Slawenland unternahm, da er im August 1136, wo er mit dem Kaiser nach Italien zog, bereits die Tribute von Groswin und von Medziretsch, worin Stolp der Marktort, bezog (ib. 32. Ann. Hildesh. 1136. Man könnte an den Kreuzzug von 1147 denken, allein der ging ersichtlich nicht über Demmin hinaus, auch würde dann Ratibor schwerlich die volle Regierung erhalten haben — seine Neffen nennen ihn predecessor — da Boguslaw von S. Otto getauft war. C. P. 196, 61, 105.). — Helmold setzt die Stiftung längere Zeit (olim) vor 1164 und schreibt sie Wartislaws Söhnen zu; das Kloster lag in ihrem Erbteil und war aus ihm dotiert, wenn auch Ratibor sie vollzog; die Zeitbestimmung ist auf die Kirche zu beziehen.
Dass man aus dem tuno nostro principe jener U. von 1153 fälschlich auf vorher erfolgten Tod Ratibors geschlossen hat, habe ich anderswo gezeigt. Von ihm und der Gemahlin Pribislawa ist das Usedomsche Kloster nach mehreren U. desselben gestiftet, nach alten Versen 1155, ganz annehmlich (Zietlow in der Gesch. des Klosters S. 6, 340 (wozu vgl. die Druckfehler) verwirft 1155, auch weil eine U. von 1421 die Stiftung circa annos domini MCL setzt, aber das ist ja nur ungefähre Bestimmung — um die fünfziger Jahre des 12. Jahrhunderts.); die erste Verbriefung ist unter seinen Neffen geschehen am 8. Juni 1159, wo sie noch nicht geteilt hatten. Das Ukerland ist zwischen 1140 und 1162 an Pommern gekommen (S. § 4. zu U. 7; die erste Bergabung daraus ist von Boguslaw I und Kas. 1 gemeinschaftlich (C. P. 246) also vor der Teilung, die 1160 bis 1162.), gewiss nach Ratibors Tode, weil er sonst wohl (wie Wolgast) einen Teil bekommen hätte; dann bietet sich als passender Zeitpunkt allein dar 1157, wo Kaiser Friedrich den Feldzug nach Polen tat, und sächsische Fürsten den Jaxe, Fürsten im Spreegau, Eidam des polnischen Grafen Piotrek, bekriegten. Etwas vorher träfe dann Ratibors Tod, um dieselbe Zeit die Vermählung seiner Tochter mit dem Grafen von Ratzeburg.
In dem Stammbaum der Ratiboritzen (Blt. St. 16, 2, 64 f. Retiburitzen heißt eine Mecklenburgische Familie um 1220. — Beiläufig: warum doch gräcisierend Ratiboriden etc.? Man hat ja als patronymische Endungen slawisch itzen oder witzen, deutsch ingen.) habe ich angenommen Swentepolk, Ratibors Sohn, als Herrn von Belgard in Cassubien (1175 Zeuge), als seinen Sohn den Wartislaus Slavinie (Cassubie), Zeuge 1186 mit Madislaw (Laskonogi) von Polen, des Oberherzogs Meficos Sohne, als dessen Sohn Ratibor II., Herzog der Slawen 1261, ungenannter Fürst von Cassubien 1260. Aber nach neuester Mitteilung des Dr. Hasselbach hat die Originalmatrikel, der die betreffende U. entstammt, bei dem zweiten zlavinic, das ist = de Slawua, wie sich 1200 Boguslaw, der Urenkel Ratibors, betitelt (Das verhält sich wie im M. A. in Oberdeutschland, z. B. der Törringer und von Törringen.). Darnach ist jener Wartislaw dessen Oheim, jüngerer Bruder des 1178 als Herzog von Nieder-Pommern anerkannten Boguslaw (III.), der mit einer Schwester jenes Wladislaw, wie dieser mit Boguslaws I. Tochter vermählt war. Dadurch gewinnen wir eine Erklärung des Umstandes, dass doch einmal zwischen Ratibors I. Tod und 1265 ein Walten der Hauptlinie in Belgard vorkommt, indem eine Vergabung Ratibors an das Usedomsche Kloster bloß 1185 in die Herzogliche Confirmation ausgenommen ist; nämlich: Swentopolk ist soeben verstorben ohne Söhne, — Damroka bleibt seine Tochter, — Boguslaw I. hat dessen Land in Besitz genommen, es aber hernach dessen Neffen eingeräumt, vermutlich 1186 durch Wladislaws Vermittlung, und zwar dem Wartislaw, der allein für Ratibors II. Vater übrig bleibt. Swinislawa wird dieses Wartislaws Schwester sein wegen des Namens zweier ihrer Söhne, Wartislaw und Ratibor. — Noch nicht 1235, aber schon 1253, betrachten sich Barnim I. und Wartislaw III. als die berechtigten Erben des Landes, in dem Kloster Bukow lag (ib. 966. Zu Ost-Colberg konnten sie es nicht rechnen, das stand seit 1248 unter dem Bischofe.), d. h. Schlawe; dazwischen hat ihnen erschließlich der erblose Ratibor II. seine Ansprüche überlassen (In der in Bezug genommenen Abhandlung habe ich die 1248 von Swantopolk vorgeschlagenen Schiedsrichter „Johannes und Nicolaus, Herrn von Cassubien, Brüder von Sambors II Gemahlin Mahtild“ für die beiden ältesten der damaligen Fürsten von Mecklenburg erklärt. Dr. Kosegarten hat dazu (I. c. 72) angemerkt: dass in einer pommerschen an der Weichsel gegebenen U. mit dem Ausdruck Cassubia gemeint sein könne Mecklenburg, scheint mir bedenklich. Aber die Frage ist nicht genau gestellt, musste lauten: ob man dort den Namen Cassubia als Synonymon von Slavia habe ausdehnen können über den Slavia, Wenden genannten Teil von Mecklenburg. Da nun die Möglichkeit nicht zu bestreiten, so entscheiden die von mir angeführten Umstände für die Bejahung. Auch das rasche Verfahren des Legaten erklärt sich leichter; durch Nomination so entfernter Herren erscheinen der Herzog mala fide handelnd.).
14. Das ursprünglich nur über Oberpommern, den Danziger Tempelgau regierende, 1295 ausgestorbene Fürstenhaus habe ich in einem früheren Aufsatze dargestellt. Sein Ahn ist Swatobor, 1107 noch Fürst, dagegen 1109 schon sein Sohn Swatopolk (I.). Dieser hat 1111 mehre Söhne, von denen er den ältesten als Geisel stellt; es ist Subislaw I., gestorben 1178, also geboren bald nach 1100; darnach ist der Vater geboren und Swatobor zur Regierung gekommen um 1070. Schon er war mit Polen verbunden, abhängig, der Sohn ward c. 1115 polnischer Zinsvasall (Grimislaws U. vom 11. Nov. 1198 sind vielleicht testamentarische mit Hinblick auf den nahen Tod, Herr Dirsek und Bartholomeus von Stettin vielleicht Eidame. Der erste ist neuerlichst als der Demminer Castellan angesehen, unzulässig, der starb c. 1180 (vgl. Register zu in C. P. die Stellen über ihn und seinen Sohn) und der Name, das einzige Fundament, ist = Besitzer = Otho.).
Als Boleslaw III. 1109 Nakel angriff, schlossen die oppidani, von ihren principes Hilfe erwartend, Vertrag, sich und das oppidum zu ergeben, wenn binnen eines festgesetzten Tages von den Ihrigen keine Hilfe käme; die Pommern kommen, lauter Fußvolk, werden am 16. August geschlagen, die Stadt und die sechs Castelle des Gebiets übergeben, jedoch dem obigen Swatopolk als Zinslehn überlassen. Principes der Kaiser, Könige, Polenherzoge sind bei dem Berichterstatter die Vornehmsten des Reichs, z. B. die Herzoge und Grafen des deutschen; principes eines Volks kommen sonst bei ihm nicht vor. Hier können sie nicht die Castellane, Edlen der Burg sein, welche vielmehr belagert, die Kapitulierenden sind, also nur die Landesherren, nicht Swatopolk, nicht der Belgarder, der stets dux heißt und damals nicht feindlich war, mithin die Fürsten des Nakler Gebiets; die 40.000, lauter gemeines Volk, sind ja nur ungefähre Schätzung und zwar des prahlenden Siegers. Diese Fürsten waren die bittersten Feinde Polens schon 1092, sind wohl die praesides oder principes, mit denen vornehmlich Sbignew im Bunde stand, denen er die Pläne des Bruders Boleslaw verriet, wohl auch die Führer der Partei, welche 1107 den Swatobor gefangen setzte. Sie hielten sich noch feindlich, als schon der Belgarder sich gefügt, gingen so unter. Swatopolk erhielt das Nakler Gebiet, sogleich, aus Rücksicht auf den heranbrechenden Heereszug des Kaisers; c. 1115 ward es ihm genommen, unmittelbar polnisch, zur Gnesener Diözese gelegt.
Gnewomir, der 1108 hingerichtete Gebieter in Czarnikow und Filehne, war sicherlich nicht Beamteter, sondern Pan, Fürst der Czarnken. Die ihm von Martinus zugeschriebenen traditiones multimodae gegen Polen zeigen, dass er längere Zeit regiert hat, durch seine Schwäche zu wechselnder Politik genötigt war; Kadlubeks Bericht macht ihn für 1108 zum Vasallen des Belgarder Herzogs.
15. Im Stettiner Landesteil hatte Wartislaw I. 1124. 1128 nur oberherrliche, priesterliche Rechte, das ist durch das über die vom Vater ererbten, mit dem Bruder geweilten Gebiete bemerkte bestätigt. Als Republik kann derselbe nicht gefasst werden, (Genti Pomeranorum et populo Stetinensi. Hat jene einen Herzog, so wird dieser Fürsten haben.) schon deshalb nicht, weil sich darin eine fürstliche Nebenlinie findet, deren zusammenhängender Besitz sich durch alle drei Tempelgaue erstreckt, die bis in die angegebene Zeit hinaufreicht, keine Landeshoheit, aber große, bis zum Aussterben c. 1280 immer mehr geschmälerte Rechte hat, also die Stellung repräsentiert, die Stettin 1124 in dem entsprechend höherer Freiheit hat. Das erste urkundlich bekannte Glied ist Wartislaw von Stettin Swantiboritz (So heißt er in dem erst später aufgefundenen Original der U. vom 18. März 1187 (nicht 1188) s. C. P. 160, 852, 992. Dadurch ist die Identität des W. von Stettin und des W. Swant, die bisher nur aus der Stellung zu folgern war, zweifellos.) (herkömmlich W. II.), der 1163 (?) das Kloster Colbatz stiftete. 1174 ward er, in Stettin gebietend, durch die Dänen angegriffen, laut Vertrag deren unmittelbarer Vasall, das Gebiet dadurch vom übrigen Lande getrennt, jedoch nur für kurze Zeit; Nov. 1175 steht er als Zeuge unmittelbar hinter den Herzogen, wie sie und nur er mit dem Titel Herr, zwar als Castellan von Stettin, doch vor den anderen Castelanen wie er denn stets die erste Stelle hat, auch vor Panten (dem Sohn des dux et princeps Mistislaw von Gützkows er hat auch wie Fürsten „seinen Capellan“. Nach dem Tode Boguslaws I. (18. März 1187) ward er Landesregent, vicedominus tene bis 1189, wo er o. Z. gestorben ist. (Denn durch dänischen Feldzug ward 1189 Jaromar von Rügen Vormund (Barthold 2, 307 n. 3), und der ist 1189 Zeuge über Broda (C. P. 162) mit allen denen, die p. 145 mit Wart, dem viced., nur ist als letzter auch Rosswar hinzugetreten, und der ist 1208 Cast. von Stettin.) Nur jenes eine Mal (1175) heißt er Castellan, — um das Aufhören jener unmittelbaren Stellung anzudeuten, — sonst 1176. 1187 von Stettin, und so dass die vom Herzog gesetzten Castellane von Usedom etc. folgen, einmal die erblichen Castellane — Burgherren, Pane dazwischen stehen. Zu solchen gehört auch er; 1174 hat er nur den Oberherrn gewechselt. Seine Gaben an Colbatz nimmt 1173 Boguslaw I., mit dessen Rat und Zustimmung das Kloster gestiftet sei, in seinen Schutz und Bestätigung, ohne sie zu verleihen (Conferre = das Besitzrecht übertragen.), — was sonst immer nötig, — gibt Zollbefreiung im Herzogtum, aber nicht die sonstigen Befreiungen, verbietet nur den Richtern, des Klosters Bauern zu Diensten zu nötigen. Auch Wartislaws ältester Sohn Bartolomeus heißt 1198 noch von Stettin, zum letzten Male steht 1208 mit dem Bruder Kasemar voran, zugleich unter den letzten Zeugen Roszwar als Castellan von Stettin; c. 1205 bestätigen die Herzoge Colbatz nur die Güter, die nicht von der Familie herrühren, und diese verleiht 1212 selber mit herzoglicher Erlaubnis, was sie an Colbatz verkauft. Kasemar, der 1191 (oder 1194) das Augustiner-Eremiten-Kloster zu Stargard stiftete und mit zehn dortigen Hufen dotierte, ist 1193 und bis an seinen Tod (1220) Castellan zu Colberg, er stand als solcher, wie ich vermute, der Anastasia in der Regentschaft zur Seite, da diese 1193 und nicht mehr Jaromar die Regentschaft hatte, ihr Witwensitz die Burg Treptow a. R. war, Kasemar 1187 mit dem Vater, als dieser vicedominus war, genannt ist und 1193 sein Sitz in Colberg nur als zeitweilig gilt. — Im Kriege von 1211. 1212 hat Markgraf Albert die Gegend (von der Ucker bis zur Plöne (Denn daher doch wohl 1240 die vielen seit langer Zeit verödeten Dörfer in den Ländern Prenzlau, Penkun, Stettin, Pyritz und Zehden. C. P. 618.)) schrecklich verheert, Pasewalk und Stettin erobert, und sind ihm diese 1214 mit dänischer Hilfe abgewonnen. Seitdem sind Stettins Verhältnisse anders. Bartolomeus hat von da an das Burgward Gützkow, — seine Nachkommen als Grafen, schon 1228. 1249, — Stettin aber ist Residenz des Herzogs (Boguslaw II starb dort, Barnim wird bekanntlich davon betitelt.), früher nicht, Stadt und Umgegend stehen unmittelbar unter ihm, früher nur einzelne Rechte und Güter, die sich von der weiland oberpriesterlichen Stellung herleiten lassen; der Castellan, zunächst wieder Roszwar, hat nun die erste Stelle, und neben ihm erscheinen immer Camerar, Tribun und andere Edle, früher aber nie, wie doch von Cammin, Demmin, Usedom, benannte und unbenannte, und diese nehmen auch, bis deutsche Verwaltung eintritt, die herzoglichen Rechte wahr in den Tempelgauen von Pyritz und Stargard, wo bis eben dahin nur Pane, keine Beamten, Vorkommen. Bartolomeus hat offenbar seinen Besitz an den Herzog vertauscht, seine Brüder und deren Söhne haben geschlossene Burgwarde; Swantibor Kasemari vergabt 1220 noch selbstständig, nur „in Gegenwart Barnims“ wie des Bischofs, aber seit 1235 bestätigt Barnim die Colbatzschen Güter und anerkennt seit 1212 ausdrücklich keinen Besitz und kein Recht, wofern nicht seine Verleihung und Verbriefung hinzugekommen. Seitdem, also seit Einführung deutscher Verwaltung, hat die Familie etwa die Stellung der nachmaligen Schlossgesessenen.
Wartislaws Enkel vom ältesten Sohn ist spätestens 1177, er selber also vor 1127 geboren (Joh. v. Gutzkow hat 17. Mai 1249 einen fünfjährigen Sohn (C. P. 858), ist Tochtersohn der Dobroslawa, die 24. April 1200 noch mit ihrem Bruder zu Schlawe eine U. ausstellt, also erst hernach den Wartislaw Bartholomei geheiratet hat, und, da der Vater 1181 sich vermählte, mit dem Bruder frühestens 1182 und 1184 geboren ist. Daraus ergeben sich 1202 und 1220 als notwendige Geburtsjahre für die Tochter und Johann, 1177 als spätestes für Wartislaw. Dass Männer des Hauses nicht vor dem Alter von 24 Jahren heirateten, zeigt seine Genealogie.), sein Vater also Zeitgenosse von Wartislaw I. Wartislaw wird in der ersten ihn erwähnenden U. (von 1173), welche auch die erste von Boguslaw I., die erste von einem Herzoge in Pommern ausgestellte ist (Nur die U. Kasimirs I C. P. 71 ist früher, aber zu Havelberg gegeben.), und abermals 1183 als cognatus Boguslaws I. bezeichnet, und so oder consanguineus bezeichnet Barnim zwei Enkel und den Urenkel desselben, den letzten der Nachkommen († 1277/81). Dass die Ausdrücke hier nicht, wenn auch sonst, Affinität anzeigen können, ergibt der stets beiläufige durch vier Generationen und, so lange Urkunden ihn haben können, konstante Gebrauch, folgt auch daraus, dass andrerseits Swantibor 1220 den Barnim (den etwa zwölfjährigen, aber seinen Oberherrn) patruus nennt, denn dies durch Halbbrüderschaft zu erklären, erlauben die Verhältnisse nicht. — Wegen des cognatus halten nun unsere Chroniken den Wartislaw für einen Sohn Ratibors, und das ist noch in einer neuesten Publikation festgehalten. Dafür ist gar nichts, dagegen Alles. Erstlich Wartislaws Alter; er ist vor 1127 geboren, müsste jedenfalls jünger sein als Boleslaw, wohl auch als Swentepolk, aber 1127 war Ratibor noch nicht oder eben erst volljährig. Zweitens sein Verhältnis; er würde Landeshoheit haben wie die genannten. Drittens die Bezeichnung als bloß cognatus; Swentepolk kommt nur einmal vor und heißt da Sohn des Herzogs Ratibor, und das Verhältnis des patruelis drücken damals unsere Herzoge durch frater aus. Viertens das Patronymikon, das ihn entweder als Sohn oder als Nachkommen eines Swantibor anzeigt; im ersten Falle müsste er Enkel Ratibors sein, was unmöglich ist, im zweiten wären die Herzoge selber Swantiboritzen. Die drei ersten Gründe sprechen auch gegen meine frühere Ansicht, Swantibor als Wartislaws Vater sei Bruder Ratibors; er müsste noch jünger sein als dieser. Vielmehr ist der gemeinschaftliche Stammvater höher hinauf zu rücken, in die heidnische Zeit; der Vater Wartislaws muss gewesen sein, was er war, Herr von Stettin, in freierer Stellung des pan zum knez, dem priesterlichen Geschlechtshaupt, er muss als Zeitgenosse Wartislaws I. Stettins Verhältnis zu diesem repräsentieren.
16. Das geschieht nun 1124 durch Domislaw. Er war „der vorragendste unter den Stettinern an Leib und Geist, an Reichtum und Adel des Geschlechts, von allen so hochgeehrt, — tanto honore et reverentia colebatur, man denke an Saxos Bericht über die Verehrung, welche die slawischen Fürsten, Jaromar von Rügen und Niklot der Obodrite erhielten, selbst von Feinden, — dass auch der Herzog sich nicht herausnahm, ohne seinen Rat und Beifall in Stettin etwas zu tun, sondern nach seinem Willen alle öffentlichen und privaten Sachen geordnet wurden, seine Hausgenossenschaft zählte 500, der größte Teil Stettins war mit seinen Angehörigen und Verwandten erfüllt, [die minderfreien Einwohner also ihm hörig,] er hatte deren auch in der Umgegend so viele, dass niemand ihm leicht widerstehen konnte (Andreas V. Ott. 2, 9 Jasch. Ebbo 51. Der früher gemachte Einwand Andreas habe die erhaltenen Nachrichten corrumpiert, ist abgewiesen durch Klempins Nachweis, dass er wörtlich abschrieb.). Offenbar war er also weder Privatmann noch Beamteter; er war der dem knez untergeordnete pan, Haupt einer vielgliedrigen Familie; es musste für einen Deutschen schwer sein, die Stellung, eines solchen im Slawenlande, wo das Lehnwesen mit seinen Funktionen und Titeln nicht existierte, wo die Grenzen im Verhältnis zum oberpriesterlichen Geschlechtshaupt, zu den Verwandten, dem Adel und den Freien nicht scharf bestimmt waren, an einen modernen Begriff von Fürstlichkeit nicht zu denken ist, zu erfassen, und sie konnte kaum deutlicher bezeichnet werden, als geschehen ist. Domislaw war nun 1124 im frischesten Mannesalter, seine Gattin eine geraubte Christin aus Sachsen, beider zwei Söhne als blühende Knaben (von 7 bis 10 Jahren) durch Ottos Liebe gewonnen die am 25. Oktober 1124 getauften Erstlinge der Stettiner Christen. Wartislaw, vor 1127 geboren, ist unfraglich Domislaws Erbe, entweder einer der beiden Erstlinge, dann Swantibor dieses Vorfahr, oder, wenn die Knaben jung verstorben, Domislaws Neffe, Swantibor dessen Bruder. Die einzige Regierungshandlung nun in Wartislaws Regentschaft, von der Kunde auf uns gekommen, ist zu S. Ottos Ehren geschehen, von dessen Verehrung sein Colbatz nächst Stettin die meisten Spuren zeigt; er selber, „obwohl ein Slawe, war doch nicht von barbarischer Sitte und ganz unähnlich seinen Bürgern, sehr eifrig für Vermehrung und Zierung der Religion, daher er ein Kloster stiftete, um sein dem Aberglauben ergebenes Vaterland vom Dienst des Irrtums zurückzuführen“; zwei von seinen vier Söhnen haben christliche Namen, welche doch im Herzogshause sehr selten und erst im 15. und 16. Jahrhundert vorkommen (Joachim im 15., Johann Friedrich und drei Georg später.); das Alles weist auf die erste Alternative, die schon an sich vorzuziehen wäre.
Domislaw, 1124 in so ausgezeichneter Stellung, kommt 1128 gar nicht vor, ist unstreitig inzwischen gestorben. Daraus erklärt sich einerseits der dazwischen liegende Abfall der Stettiner, andrerseits die abhängigere Stellung der minorenn Hinterbliebenen Söhne, als deren Vormund der 1128 hervortretende Wirtschach (Wrtczech = Siegsfroh vgl. §. 20 A 39.) gelten mag. Wartislaws Nachkommen haben den größeren Teil der Stettiner Castellanei, die Pane der übrigen Burgwarde Garz und Fiddichow können vom Bruder stammen.
17. Wartislaw I. hatte heidnische Herzoge zu Vorfahren. Der Vater des Stettiner Wartislaw ist sein patruelis, entweder im ersten oder auch im zweiten Grade. Der gemeinschaftliche, über beide Landesteile, den Belgarder und den Stettiner, herrschende Großvater oder Urgroßvater ist, da Wartislaw I. um 1095, nicht nach 1045 oder resp. 1020, geboren. Aber 1046 ist Smysl Herzog von Pommern.
Boleslaw I. von Polen unterwarf 993 und behauptete bis an seinen Tod (1025) ganz Pommern; sowohl Danzig als S'chinske (Stettin) und Jomsburg standen unter ihm; er stiftete im Jahre 1000 ein Bistum zu Colberg, zweifellos für das ganze Land, in dessen Mitte die Stadt lag, wie das 1124 als Grund für die Erwählung von Wollin ausgesprochen ward. Unter seinem Sohne Mesko I. sank seit 1031 die polnische Macht durch Bruderkrieg, — schon vorher (nach 1025) hatte der Dänenkönig Knud die Pommern zinsbar gemacht, sie blieben es bis an seinen Tod (1035), — mit Meskos Tode (1034) und seines Sohnes Kasemirs I. Vertreibung (1035) brach schreckliche Anarchie ein, sogar das Heidentum erhob sich wieder, die Böhmen und die Pommern machten Eroberungen, nur Masovien blieb in Frieden, weil dort Meczslaw, Meskos Beamteter und Mundschenk, nach dessenTode sich zum Fürsten aufgeworfen hatte. 1041 kehrte Kasemir zurück, entriss den Nachbarn die gemachten Eroberungen, unterwarf dann c. 1044 die Masovier, wobei Meczslaw fiel, ehe die ihm verbündeten und zu Hülfe kommenden Pommern zur Stelle waren, erfocht dann auch über diese einen großen Sieg. So der älteste polnische Bericht. (3) Und ein deutscher: Im Sommer 1046 erschienen vor dem Kaiser zu Merseburg die Herzoge Kasemir von Polen und Zemitzlo (Polnisch zmysl, (das z ist weiches, das s scharfes s) bedeutet Sinn, Klugheit, = Hug, Hugo.) von Pommern mit Tribut und Geschenken, er schlichtete auf dem Fürstentage zu Meißen ihre Streitigkeiten (Wechsel von j und w findet sich auch sonst in Pommern, Venzidol, Yenzidul, Rwaneu. Ru-, Roianen. Übriges kommt jam (Höhle) nicht selten in pommerschen Namen vor, vgl. Jamene (Jamund), Jament, ehemaliges Dorf bei Schmolsin, Jamno, jetzt Jamen bei Bütow, Jam Holzung bei Järshöfd, „Jemme d. i. Fuchsgrube“ c. 1400 bei Bütow.). Er stiftete Frieden, ließ auch den Pommer, da er von ihm Tribut annahm, selbständig, so war Polen nicht zu schwach, nicht zu stark, wie es das Interesse des Reichs forderte. — Die Streitigkeiten des Herzogs mit Polen im deutschen Bericht sind die Kriege der Pommern im polnischen. In ihnen stehen beide in gleicher Macht gegenüber, im Frieden in gleicher Stellung. Folglich hat Smysl ganz Pommern gehabt, namentlich als helfender Bundesgenosse des auch über Witland herrschenden Masoviers Ostpommern mit Nakel, von wo aus die Pommern um 1100 den Sbignew, Herren von Masovien, unterstützten; er hatte 1014 auch Dänen in seinem Heer, (Wo Mart. 1. c. Pomorani hat, da haben Chr. Johannis und (das sonst dem Mart. folgende) Chr. priuc. Pol. (Sommersb. l, 5, 22), Dani, Maritimi (d. i. Pomorani). Vgl. § 18 zu U. 10) das sind die Jomsburger. Wie Kolberg wegen der Lage in des Landes Milte Bischofssitz sein sollte, so war Belgard 1102 urbs regia und Zentrum des Landes, gewiss auch Smysls Sitz, da isländische Sagas das ganze Land Bialagard-Sida nennen.
Smysl ist denn o.hne Z.weifel Ahn des 1102. 1107 zu Belgard residierenden, die Küste von der Pene bis zur Leba beherrschenden Herzogs, des Vaters von Wartislaw I. und Ratibor I. Den Boleslaw nun, Ratibors Sohn, mithin das gesamte herzogliche Haus, erklären Boguphal und spätere polnische Chronisten für Abkömmlinge der vornehmen Familie im Krakauer Herzogtum, die den Greif im Wappen führte; (Bog. p. 46, de stirpe Griffonum. p. 57, de cognatione Griffonum Cracum Boleslaum nomine (s. Blt. St. 16, 2, 56). Cracum halte ich für eine vom Abschreiber nicht aufgelöste Abbreviatur von Cracouensiam aus Grund der (auch aus Bog. schöpfenden) späteren Berichte über diese Abstammung.) zu ihr gehörten Graf Jaxa (nebst Swantoslaw um 1160 primi principum in Klein - Polen»)), der sehr vorragende Bischof Getko von Krakau (1165— 1182), der Woiwode Theodor von Krakau, von denen der erste 1162 die Abtei zu Miechow, der zweite die zu Wonchoz, der dritte 1234 die zu Ciricz gründete. Solche polnische Abstammung ist dem Geschichtszusammenhange gemäß; denn dass Smysl aus einem von Boleslaw I. gesetzten Woiewoden bei der Zerrüttung Polens selbstständiger Herzog geworden, — der Titel ist gleich, woiewoda die Übersetzung von Herzog, der spätere ist dann knez, — ist an sich das zunächst liegende, und es wird solch Verhältnis von dem in gleicher Lage befindlichen, ihm verbündeten und benachbarten Meczslaw berichtet durch den Chronisten, der von Smysl nichts weiß. Diesen unterscheidet so von jenem nur das Glück und die günstigere Lage, die ihm gestattete, aus einem Statthalter durch die dänische Zinsvasallenschaft hindurch zum Fürsten zu erstarken und ihm die Hilfe der kampfberühmten Abenteurer und Insassen der Jomsburg zu Wege brachte. In kleinerem Maßstabe gelang dasselbe dem Woiewoden Swenzo von Stolp bei den Verwirrungen in Ostpommern und Polen seit 1296. Die bloße Möglichkeit, jene Angabe über die Verwandtschaft möge ein Schluss aus dem gleichen Wappen sein, kann gegen den bestimmten, durch die Verhältnisse bestätigten Bericht nicht aufkommen, da ja zu Boguphals († 1253), also in jenes Woiewoden Theodors Zeit die Grafen von Miechow die ehrende Verwandtschaft noch ganz wohl im Andenken haben konnten, und der Greif ein unter den Slawen weit verbreitetes Symbol ist.
18. Ob nun Smysl selber aus Statthalter Fürst geworden ist, oder Sohn eines solchen, ist nun zu ermitteln. Dazu müssen wir eingehen auf den schon mehrfach erwähnten berühmten Handelsplatz Slawiens, der seine besondere Geschichte hat, den Adam v. Br. Jumne, Helmold Jumneta, nordische Skalden Jom, isländische Sagas Jomsborg, Saxo und S. Ottos Biographen Julin, die ältesten U. Wilin, Wulin, Wolin, eine Julia nennen, an der Stelle des heutigen Wollin. (Die Identität der Orte setze ich als erwiesen voraus, ebenso, dass Vineta falsche Lesung für Jumneta.)
Nach Saxo hat der Dänenkönig Harald Gormson Slawien erobert und (um 950) bei Julin, dem edelsten oppidum jener Provinz, hinreichende Besatzung gelegt, deren herrliche Vikingsfahrten und wilde Tapferkeit sie im ganzen Norden berühmt und furchtbar machte, nämlich die Jomsvikinger, zu denen die edelsten und mutigsten jungen Männer aus Dänemark traten. Die slawische Stadt bestand demnach schon vorher; zu 985 werden die Einwohner von Saxo und Adam v. Br. Slawen, ein wenig später in Strophen mehrerer Skalden Wenden genannt; also wird Jomsborg die dänische Feste sein bei der wendischen Stadt Jumne, Wulin, Julin) ähnlich wie im 9. Jahrhundert bei Duurstede in Friesland.
Die ersten Jomsvikinger zogen 980 in Haralds Dienst gegen Jarl Hakon von Norwegen; sie fielen teils in und nach der Schlacht an den Hjörungar, teils kehrten sie nicht nach Jom zurück. Dann vertraute Harald die Burg dem schwedischen Prinzen Styr-Björn, der 984 bei einem Einfall in Schweden umkam. Er selber floh 985, als sich sein Sohn Sveinn gegen ihn empörte, in das mit dänischen Waffen gefüllte Julin, oder zu der Wendenstadt Jumne und starb dort an seinen Wunden. Auch nach seinem Tode setzten die Jomsborger den Krieg fort gegen Sveinn und nahmen ihn dreimal gefangen, wodurch er so in Verachtung kam, dass er aus dem Reiche weichen musste. Die ihn gefangen nahmen, waren Norweger, also Olaf Trygveson, der um jene Zeit drei Jahre ldar- nach 984 — 987) im Wendenlande hauste, dann sich wieder nach Russland wandte. Dann erst nahm die Jomsborg Palna Toke aus Fünen, Haralds bitterer Feind, der ihm die tödliche Wunde gab und daher Sveinns Blutrache zu fürchten hatte, — er war dort Herr 990, — und scharte dort Vikinger auf eigene Hand mit Einrichtungen, wie sie Freibeutern eignen und in neuern Zeiten die Bucaniers in Westindien hatten; er erhielt das Land Jom von den, Wendenkönige Burizlaf mit der Verpflichtung, die Küste gegen alle Feinde (Nordländer und Liutizen) zu verteidigen, (Jonisvikinger Saga nach Giesebrechts Übersetzung in N. Pomm. Prov. Bl. 1, 202 ff. Die von ihr erzählten Tatsachen sind dem Kerne, nicht der Ausführung nach anders woher beglaubigt. Nach ihr hat Palna Toke die Jomsborg gegründet unter König Sweinn [der nach 985], aber vor dem Heerzuge gegen Hakon Jarl (980), das widerspricht sich; mithin ist die Sage von ihm unrichtig verbunden mit der von den ersten Joinsvikingern. Wohin Toke gehört, zeigt die Eyrbyggia-S., nach welcher der Isländer Björn auf drei Jahre verbannt ward und so zu Toke nach der Jomsborg kam 13—14 Winter vor der Einführung des Christentums in Island. Die war nach ihr 27 Winter vor dem Tode Olafs des Heiligen [† 1030] nach etlichen HS. aber 997 (Giesebrecht W. G. 1, 222). Dieser zweiten Angabe folgt Giesebrecht, ich der ersten, (also Björn 989, 990 verbannt, [also Toke nach Olaf in der Jomsb.], denn nach ihr braucht man nicht den Burizlaf als ganz ungeschichtlich zu verwerfen [wie Gieseb. 1. c. 245], vielmehr ist, da Sweinns Gattin nach Thietm. 7, 28 Boleslaws von Polen Schwester, nach Joinsvik. S. Burizlafs Tochter, die Identität und der geringe Irrtum ersichtlich. (Burislaus heißt bei Flodoard ad a 955 ff. der Böhme Boleslaw. Burisleif in der Knytlinga Saga der Pommer Boguslaw I). So kann auch mit der Saga Sigvaldi als Tokes mit Burizlafs Zustimmung gesetzter Nachfolger festgehalten werden. Daraus folgen die Abweichungen von Giesebrechts Darstellung.) d. h. er ward Dienstmann und Vasall Boleslaws von Polen, als dieser 993 ganz Pommern unterwarf, mit dem Schwedenkönige Erik, dem Verjager Sveinns, in Schwägerschaft und Verbindung trat, (diese konnte nur durch Tokes Schiffe unterhalten werden, da die Wenden sonst noch nicht seemächtig waren, es erst durch die Vikinger wurden) und nach dessen Tode (995) mit dem hergestellten Sveinn selber, dem er seine Schwester Gunhild gab. Tokes Leute sind die Dänen, welche Boleslaw nach polnischen Nachrichten unterworfen hat. Durch diesen und Toke ward bei dessen Tode Jarl der Jomsburg der Edle Sigvaldi, den Sveinn als seinen Gegner (995) vertrieben hatte; er gewann dessen Gunst, als er den Olaf Trygveson, jetzt König von Norwegen durch Jarl Hakons Tod 994, hinterlistig in Boleslaws Land lockte, ihn dann mit 60 Wendenschiffen auf der Heerfahrt wider die Könige der Schweden und der Dänen und Hakons Söhne begleitete, aber in der Seeschlacht am Svöldr ihn verräterisch verließ und so seinen Untergang herbei führte im Jahre 1000; die Rückkehr nach Seeland war der Preis des Verrates, dort war er später, kam also nicht nach der Jomsburg zurück.
Gunhild ward bald von Sveinn verstoßen; bei dessen Tode 1014 holten sie beider Söhne Knud und Harald von der wendischen Küste zurück. Bald darauf hat Knud nach angelsächsischen Annalen in seinen Kriegen in England zum Hilfsgenossen seinen Schwestermann Vortigern (Wirtgeorn), König der Winiden. Vermutlich hat also Gunhild ihm die Tochter verlobt, den Sitz in Pommern vom Bruder erhalten, und dieser hat 1015 mit ihr auch Jomsburg dem Knud wieder übergeben. Im Jahre 1030 rief dieser seinen natürlichen Sohn Sveinn, den er zum Jarl der Jomsburg gemacht hatte, von da ab nach Norwegen. Er hatte auch die Ruanen und die Pommern (diese o. Z. nach Boleslaws Tode) in Abhängigkeit und Zinsbarkeit gebracht. — Nach seinem Tode (1035) verheerten die Wenden in Dänemark. Magnus, seit 1042 dort König, setzte alle Wenden in Schrecken, belagerte Jumne, tötete viele Piraten in der weiten Feste, eroberte sie aber nicht, denn der Verlust war auf beiden Seiten gleich. 1050 eroberten Liutizen Wulin, natürlich die östlichen, die von Wanzlowe, das stets die Insel Usedom, 1124 noch dazu Lassan, Ziethen und Gützkow begriff, zu welchem letzten damals auch Groswin gehörte. Eben diese müssen sein „die zahlreiche heidnische Nation in Leutecia mit ihrem Könige, die zur See (NB.) und zu Lande kriegskundig“ zugleich mit Polen (Pommern) dem Könige Sveinn Estridson 1069 nach England Hilfsschaaren sandte, darunter Verehrer von Wodan, Thor, Freia, den nordischen Gottheiten; — in dem inneren Kriege, welcher 1057 die Macht der Liutizen brach, war auch dieser Dänenkönig unter den von den Rederen und Tolensern gegen die Czirspanier zu Hilfe gerufenen, (Ad. Br. 3, 21, 22. Helm. 1, 22. Das Nähere und über die Zeit ein anderes Mal.) dadurch sind die an der See unter ihn gekommen;— sie müssen sein „die Herrschaft, die unter König Sveinn stand (o. Z. bis zu seinem Tode 1074), welcher sein Sohn Erik Ejegod waltete, indem er Erbrecht ansprechend, alles Volk zum Gehorsam zwang,“ (Giesebr. 2, 157 —160 aus einem Skaldenliede.) denn unter ihm ward (das seit 1050 mit jenen Liutizen verbundene) Julin (um 1100) gezwungen, Geld zu zahlen und die Piraten auszuliefern, und 1121 griffen die Dänen nur Jumne und Usedom (Osna) cm; die Herrschaft ging so 1074 als 1103 bei den Thronstreitigkeiten nach Sveinns und Eriks Tode verloren.
Die Vikinger zu Jom waren von den verschiedenen Völkern des Nordens. Tokes Satzung, dass kein Weib in der Feste sich aufhalten, kein Viking länger als drei Nächte außer ihr zubringen durfte, sowie ihre teilweise Aushebung durch Sigvaldi, mussten ein sehr gemischtes Geschlecht in der Stadt zur Folge haben mit wendischem Hauptstock. So schildert denn auch Adam v. Br. Jumne als bewohnt von Slawen und Leuten aus allen Nationen, auch Sachsen, die aber ihr Christentum verbergen oder verleugnen mussten (Ad. Br. 2, 19; 4, 20; 1, 62. Die zweimaligen Graeci et barbari sind gewiss die neutestamentliche Phrase = alle Nationen.). Wie daher dort 1124 die Julsäule war, so darf 1069 der Kultus nordischer Gottheiten nicht auffallen, auch nicht bei jenen Liutizen, o. Z. denen des Vortigern (Dadurch erklärt sich die Meldung des Mönchs der Normandie (A. 17) genügsam. Zum Beweise, dass noch damals Germanen unter den Wenden selbstständig sich erhalten, wovon Thietmar, Adam — also auch sein Hauptgewährsmann König Sveinn selber — schweigen, die Begleiter Ottos 55 Jahre später nichts wahrnahmen, die bald daraus beginnenden U. nichts ahnen lassen, genügt sie offenbar nicht.).
19. Die Lücken, welche diese nordischen Nachrichten über Jumne für 1000 ff. 1035 — 1050 lassen, fülle ich aus durch das, was ein Mönch von Pegau im Leben des Stifters seines Klosters, des Grafen Wigbert von Groitzsch, über dessen Vorfahren mitteilt (Vita Viperti comitis Groicensis in Hoffmann SS. rer. Lusaticarum I p. 6 ff. Die Excerpte (fast vollständig) bei Barthold 1, 362 ff. Giesebrecht 2, 7, 8, 64, 65; v. Raumer Reg. Brand. 346. 361.). Er beginnt: Emelricus, König Teutoniens, hatte zu Brüdern Ditmar den Verduner und Herlibo den Brandenburger. Herlibo zeugte drei, Hartungen genannte Söhne, nämlich Emelricus, Vridelo und Herlibo. Von diesen heiratete Herlibo eine Königstochter aus (de) Norwege und bekam von ihr zwei Söhne, Svetibor und Wolf. Jener hatte zu Söhnen den Scambor und seine Brüder. Wolf erlangte Pomeranorum primatum, dann aus der Provinz vertrieben nahm er seine Zuflucht zu einem Könige der Dänen, der den jugendkräftigen und schon vorher durch den Ruf bekannten Mann gern aufnahm, auch nach oftmaliger Erprobung unter die vornehmsten familiäres, und ihm seine Tochter gab. Nach kurzem Verlauf stellen deren Brüder sich feindlich, um ihn von sich und ihren Grenzen zu vertreiben, Gleiches von ihm nach des Vaters Tode fürchtend. Er weicht vor ihrem Neide, aber bald nachher, als er den Tod des Schwiegervaters erfuhr, überfällt und tötet er sie, und erhält, da Alle ihm günstig, das regnum als Eidam. Glücklich fortan in seinen Unternehmungen, erhielt er von gedachter Gattin drei Söhne, Otho, Hermann und Wigbert. Überdies gewann er durch Kriegszug die Herrschaft des Balsamerlandes. Als Wolf endlich durch Alter oder die häufigen Kriege aufgerieben war, nahm ihn das Volk doch als Glückbringer mit, band ihn zuletzt, als er wegen Schwäche nicht mehr reiten konnte, auf dem Pferde fest. Als er starb, bestatteten ihn die barbari ehrenvoll mit Waffentanz in einem Göttertempel. Nach seinem Tode übte der avunculus derer, die er in Danorum provincia getötet, Rache; seinen Einbruch auszuhalten, misstrauten die Söhne und entwichen aus dem väterlichen Gebiet, Otho nach Griechenland, Hermann nach Russia, (Bekanntlich bestand die Leibwache zu Constantinopel damals aus Vordländern, die auch häufig in Russland) Wigbert aber hatte sich ins Balsamerland begeben, das ihm aus der väterlichen Erbschaft zugefallen war. Als wackerer Krieger sich auszeichnend, heiratete er Sigena, Tochter des älteren Grafen Goswin von Leige, von der er den Sohn Wigbert und zwei Töchter bekam. Im Besitz des Balsamerlandes, eingedenk so der väterlichen Tapferkeit, als der durch seine und seiner Brüder Vertreibung erlittenen Unbill, befehdete und beraubte er oft barbarorum provinciam et praecipue urbem quae Posduwlc-i. e. urbs Wolfi barbarica lingua dicitur. Noch juvenis starb er frühzeitigen Todes, da sein Sohn noch puerulus. Sigena, die den Grafen Friedrich von Lengenfeld (bei Regensburg) heiratete, erzog ihn treulich, gab den Heranwachsenden in den Dienst des Stadischen Markgrafen Udo, bei dem er aufwuchs, der ihm den Rittergürtel und Tangermünde zu Lehn gab, dem durch Kriegstaten ausgezeichneten juvenis dann, für die eigenen Söhne fürchtend, für das Balsamerland Groitzsch, für Tangermünde andere Lehne der Nordmark, in Tausch gab.
Der Bericht präsentiert sich apokryphisch genug, ist daher von neueren Forschern als unglaubwürdig aufgegeben, Wolfs Herkunft schon längst. Suhm fand diesen in dem 1027 ermordeten Jarl Ulf, bei Adam v. Br. Wolf, Schwestermann des Königs Knud und Vater des Königs Sveinn Estridson, dessen sehr vornehmes Geschlecht nach Saxo in der vierten Generation vor ihm aus Schweden stammte; ihn griff der Mönch auf, um seinen Helden von ihm abzuleiten. Barthold (28): Der vor dem Ende des 13. Jahrhunderts schreibende Mönch meint den Jarl Ulf, der mag eine Zeitlang die dänische Herrschaft an Pommerns Küste hergestellt und irgendein Gebiet dort besessen haben; die Erwähnung des Namens Pasewalk in seiner ältesten Form lässt zu Knuds Zeit eine Herrschaft der Dänen und Slawen aus Jumne in einem liutizischen Landstrich (über Haff und Wildnis hinaus?) erraten; Jarl Ulf mag ein kleiner Dynast des liutizischen Bundes gewesen sein, (also seine Herleitung bei Saxo ist zu verwerfen,) der als König Svein Haraldson sein Ansehen im Wendenlande verlor, (er hat nie Ansehen oder Herrschaft darin gehabt,) ihm nach Dänemark und England folgte; Suantibor und Scambor sind zu beseitigen als Erdichtung; Pase- walk war zur Zeit des Mönchs bekannt genug, und er mochte wegen der Deutung des Namens es gewählt haben, um die ehemalige pommersche Herrschaft seines Grafen bestimmen zu können. — Man sieht, das sind drei verschiedene Conjecturen, vom Ganzen bleibt nichts als: Wolf hieß der Großvater Markgraf Wigberts, stammte aus dem Wendenlande.
Giesebrecht: Von absichtlicher Verfälschung war der Mönch ohne Zweifel sehr fern; er schrieb auf die Aussage von Augenzeugen, deren die meisten noch lebten, also nicht nach 1150; annehmliche Überlieferung vom Vater und Großvater des Helden, sagenhafte zwei Glieder höher hinauf in der Ahnentafel sind auf gleiche Weise in gutem Glauben ausgenommen; die Erzählung ist wahr und unwahr. Demgemäß wird aus den Nachrichten über die Vorfahren nur die Abstammung aus Brandenburg beibehalten; Wilk ist ein slawischer Edler, dessen Namen ins Deutsche Wolf übersetzt ward, geht abenteuernd nach Pommern, erlangt fürstliche Ehre, wird vertrieben, geht zu dem Jarl der Dänen im Wendenlande, vielleicht dem Sigvaldi, wird dessen Eidam, entweicht, kehrt bei dessen Tode zurück, erweitert sein Fürstentum landeinwärts, — Posduwlc ist vielleicht Pasewalk, — gewinnt nach Ottos III. Tode 1002 das Balsamerland, das er sogleich oder später dem Wigbert überlässt; seine Herrschaft an der Küste scheint umgestürzt zu sein, als Knud um 1025, die Küstenländer unterwarf, er vielleicht der Bluträcher, der avunculus, als Sohn der Gunhild, wenn die Jomsvikingersage Recht hat, die ihre Schwester Astrid zu Sygvaldis Gattin macht. — Die vermutete Verknüpfung mit den nordischen Berichten ist abzulehnen. Da Sigvaldi im Jahre 1000 nicht nach Jumne zurückkehrte, später in Seeland lebte, Astrid, wenn je, erst 996 heiratete, so kann der vor 1025 gestorbene, seit um 1000 an der Küste herrschende nicht sein Eidam, sein Nachfolger beim Tode durch Tötung seiner Söhne sein. Die so stark markierte nichtslawische Herkunft der Familie ist festzuhalten, oder der ganze Bericht zu verwerfen; ob der eigentliche Name Wolf oder Wtlk sei, kann nicht zweifelhaft sein, der Bericht hat das erste und alle drei im Slawenlande geborenen Söhne haben deutsche Namen. Wie ein Abenteurer in Pommern fürstliche Ehre erlangen konnte, darüber wird der eine Vermutung wagen müssen, der den Bericht in diesem Teil stehen lässt. Eine Scheidung in ihm zwischen einer verwerflichen ersten und annehmlichen zweiten Hälfte ist unstatthaft, da beide gleiche Würde haben; man muss ihn ganz annehmen oder ganz verwerfen.
20. Die Verwerfung ist nur gestattet, wenn er in die anderweitig beglaubigte Kunde sich gar nicht einflechten lässt. Denn der Autor schrieb, und zwar bald nach 1155 (Die jüngsten als nicht gestorben erwähnten Personen sind die Brüder Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und Gras Friedrich (von Lengenfeld), Nachkommen von Sigena ans der zweiten Ehe, deren Vater Otto als tot angegeben wird. Er nun starb (nach Hops) 1155, der Autor schrieb bald nachher wegen der Augenzeugen, jedenfalls bevor Otto 1183 Herzog von Bayern, Friedrich 1179 Mönch ward.), „nach wahrhafter Erzählung solcher, die das Berichtete teils von anderen gehört, teils gesehen haben und dabei gewesen sind, von denen er die Mehrzahl selber gesehen habe; was vor der Übersiedelung Markgraf Wigberts nach Groitzsch liegt, also was uns beschäftigt, beruht notwendig auf seinen Mitteilungen, und dass er geflunkert habe, darf nicht vorausgesetzt werden. Pasewalk heißt in den ältesten Urkunden Posduwolc oder ähnlich, das bedeutet Ansiedlung, Stiftung (posada polnisch) eines Wlk in böhmischer, Wolk in pommerscher Aussprache, (29) d. i. eines Wolf. Es ist bei der ersten Erwähnung 1175 eine Burg im Ukerlande (also der liutizischen Ukrani) neben Prenzlau, jünger als dieses, weil dieses die Tempelfeste des Landes hat; (30) doch ist auch dies als den Personennamen Premislaw tragend (vgl. Ratibor etc.) nicht in hohes Altertum zu setzen. Dem ist also die zwar nicht ausdrücklich berichtete, aber doch deutlich genug angezeigte Stiftung Pasewalks durch Wolf und seine Herrschaft darüber ganz angemessen.
Das regnum, welches Wolf erwarb, ist eine provincia Danorum, kann nur Erwerbung (prov.) im Wendenlande sein, da sie provincia barbarorum, von Heiden ist, und die lingua barbarica darin die slawische; sie ist nach dem Kontext, wo Pasewalk und die Pomerani, man hat also mit Recht Jumne verstanden. Da die dänische Herrschaft darüber 1071 aufgehört, die über Rügen erst 1168 begonnen hat, so konnte der Pegauer Mönch von einer solchen nur wissen durch sichere Tradition von Wigbert her.
Er hat geschrieben zu einer Zeit, wo Pommern und Liutizien noch genau unterschieden wurden, seine Nachrichten stammen aus der Zeit, wo beide noch ganz getrennt waren. Mithin sind die Pomerani, wo Wolf einen primalus erlangte, die eigentlichen. Unter deren Fürsten allein finden sich die Namen seines Bruders und seines Neffen, und zwar in der ältesten Zeit und gerade da in der entsprechenden Form; zu Danzig sind zwei Sambor; der ältere heißt bei der ersten Erwähnung 1178 in der dort ältesten Urkunde Schambor, sein Urgroßvater Swatobor (1108), ohne das später stets eingetönten (Dies ist polnisch, fehlt in den betr. böhmischen und russischen Namen, wo Swato, Swjäto. Sweti in der in Sirbia geschriebenen Vita ist dann sorbisch.). Und gerade in dem Landesteil, dem Pasewalk anliegt, zu dem Jumne gehört, lebt vor 1100 jener Swantibor, Swentebor, der Ahn Wartislaws II.
Alles das gestattet keine direkte oder indirekte Verwerfung des Berichts, fordert die Untersuchung, ob er sich ins anderweitig Bekannte einfüge, zunächst in Ansehung der Zeit.
Markgraf Wigbert starb 1124 unter Umständen, die ihn als noch nicht entkräftet zeigen (Er zog sich die tödliche Krankheit zu, als er selber ein bei ihm in der Nacht entstandenes Feuer unbekleidet löschte, durch die Verletzungen und die Erkältung. Vita 12.), war 1115 ff. noch ein rüstiger Kämpe, heiratete erst Ende 1084, und zwar eine Tochter Wartislaws von Böhmen (33). Der Markgraf, in dessen Pflege er überging, der ihn wehrhaft machte, belehnte, ihm Groitzsch vertauschte, ist also nicht Udo I. (1056—57), sondern Udo II. (1057—82); der Tausch geschah, weil Udo aufmerksam gemacht ward, er habe für sich, die seinen und seine Nachkommen von dem juvonis zu fürchten; das konnte nur der Fall sein, als mit den anderen sächsischen Fürsten er sich und als einer der Tätigsten gegen König Heinrich IV. empörte, 1073—75; er geschah wohl 1075, weil da Udo in Gefahr war, und dahin die vita weist; denn kaum hatte Wigbert Groitzsch in Besitz genommen, so befehdeten ihn die Nachbarn und vertrieben ihn bald, er ging, und zwar 1076, zu Wratislaw (Die Vita hat hier eine verworrene Chronologie. Fixpunkt ist die Rückkehr aus Italien 1084 und die gleich daraus folgende Vermählung mit Judith, deren Zeit durch die Heirat ihrer Mutter, ihres Sohnes (1110) und die Verhältnisse ihrer Brüder bestätigt ist. Der Autor setzt gleich nach Wigb. Ankunft bei Wrat. dieses Erhebung zum Könige (2, 3), die in 1086 gehört, darauf folgt der Kriegszug nach Italien, der bis kurz vor dem Ausbruch von da 7 Jahre gedauert habe (4, 8, 22), nach ihm ist also Wigb. 1076 zu Wrat. gekommen. Wigberts Belehnung mit Niseni und Budissin setzt Giesebr. (2, 137) in 1076, die Vita gleich nach der Verheiratung als Mitgift; das ist festzuhalten, denn er baute sofort die Feste Swortz (4, 28), „unbekannter Lage“, nicht doch, sie lag nahe Zeitz (4, 31), ist also (schon nach Büsching) Schwerzau zwischen Zeitz und Groitzsch und bis 1813 in dieses Amt Pegau; er hatte also Gr. wieder, erhielt es nach König Rudolfs Tod (5, 6, 7), Winter 1080—81.), der in dem Jahr vom Kaiser mit der Mark Meißen belehnt ward; damit aber beginnen die Taten, die der Biograph von seinem Helden berichtet. Dieser ist nach alledem etwa 1053 geboren, nicht eher, da seine Mutter frühestens 58 Jahre hernach starb (Wigb. erbt 1110 die Herrschaft Vitzenburg, übergibt das Nonnenkloster darin seiner Mutter zum Ruhesitz, die stirbt dort „nach etlicher Zeit“ 6 Kal. Mart (Vita 9) also frühestens 1111.). Der Vater starb „frühzeitig, als juvenis, da der Sohn noch puerulus war“, und erst einige Jahre später, als Knabe nach der Sitte, und vor der Wehrhaftmachung, an Udos Hof kam. Der Vater ist also gegen 1030 geboren, nicht nach 1060 gefallen; die Einbrüche in Liutizien gehören nach 1050, der gegen Pasewalk, so weit ins Land hinein, also nur unter ganz besonderen Umständen möglich, in 1057, wo die Liutizen den gewaltigen inneren Krieg um die obere Pene führten.
„Das Balsamerland (zwischen Werben und Stendal) war deutsch die ganze Zeit der Ottonen hindurch, hernach wendisch (Wigb. erbt 1110 die Herrschaft Vitzenburg, übergibt das Nonnenkloster darin seiner Mutter zum Ruhesitz, die stirbt dort „nach etlicher Zeit“ 6 Kal. Mart (Vita 9) also frühestens 1111.)“, dies also erst nach dem Frieden von 997, folglich auch nach dem Friedensstande unter Heinrich, wo es auch Chroniken und Urkunden als deutsch zeigen, mithin erst unter Konrad; Heinrich ist mit unter die Ottonen gerechnet. Unter Konrad endete der Friedenszustand; er war 1032 zu Werben, um dem Reiche gegen die wortbrüchigen Liutizen Sicherheit zu gewähren, weil dort etliche Jahre viele Niederlagen und Überfälle geschahen; dort fiel 1033 ein Graf mit vielen, gab es 1034 plura et insolita bella, griffen die Liutizen die Grenzen der Sachsen an, eroberten 1035 die Reichsfeste Werben, bis der Kaiser sie 1035. 36. durch Heerzüge zum Frieden zwang. Wolfs Kriegsfahrten, die ihm das Balsamerland (schwerlich ganz) einbrachten, gehören daher zwischen 1030 und 1035, — er war deutschen Geschlechts, nur Kriegsgenosse der Liutizen, konnte also leicht seine Interessen von den ihrigen trennen, zum Kaiser tretend das Erworbene behalten; — wohin in Wolfs Leben sie gehörten, sagt der Bericht nicht, ersichtlich in die Zeit seiner Vertreibung aus Jumne.
Der rex Danorum, zu dem Wolf ging und dessen Tochter bekam, bei dessen Tode er das Land gewann, kann kein dänischer Jarl von Jumne (Nicht Sveinn, Knuds Sohn, der ist zu jung dazu, nicht sein unerwähnter Nachfolger, der ist zu spät, nicht Toke, dem folgte Sigvaldi, nicht dieser, der kam nicht nach Jumne zurück.), kann, da man dann den Titel nehmen muss, wie er lautet, nur Knud sein, gestorben 1035, und gleich darauf heerten die Wenden von da in Dänemark und hatten 1012 den Angriff des Königs Magnus zu bestehen. Die Erwerbung war „bald nach der Vertreibung“ Wolfs, und dazwischen fallen jene Kriegsfahrten über die Elbe. Sein Sohn fehdet nach 1050, natürlich nicht nach der Insel Wollin, sondern gegen die Liutizen, und bis um Pasewalk, um für die Vertreibung seiner Brüder aus Jumne Rache zu nehmen, folglich fällt die Vertreibung zusammen mit der Eroberung Wulins 1050 durch die Liutizen von der Unter-Pene, und wird diese Nachricht gleichfalls von Wigbert herrühren (Denn sie steht (A. 16), was auffallen muss, in der Chronik des späteren Klosters Alt-Zelle bei Nossen, das lag in dem Gau Niseni, den Wigbert 1084 erhielt (A. 33).); sie nahmen gewiss auch Pasewalk, und da dessen Umgegend hernach und ursprünglich den Ukrern gehörte, so erklärt sich, dass sie dem Wigbert den Durchzug verstatteten. Dieser ist vorher ins Balsamerland, das ihm bestimmte Erbteil, gegangen, wohl gleich 1035 darin geblieben. Wolfs Tod fällt denn Anfangs 1050. Die ihn vertreibenden Schwäger sind der 1030 von Jumne abgerufene Sveinn, Knuds natürlicher Sohn (Die dänischen Könige hatten damals viele uneheliche Söhne, waren mehrenteils selber solche. Auch der Obdrite Godschalk war in Knuds und Sveinn Estridsons Gefolge und erhielt des zweiten Tochter, deren uneheliche Geburt Helmold gar nicht anmerkt.), und ein auch als Nachfolger zu postulierender Bruder, den Wolf 1035 tötete. Jene Liutizen von 1050 sind die an der See wohnenden, welche um 1020 König Wortigern (Wortigern ist zwar bekanntlich ein britischer Name, doch auch slawisch; wrt (umwenden, vertere, speziell Feinde zur Flucht bringen), auch in Marti-, Wrati-, Wort-slaw, Wirt-czech; jar (leuchtend, — peraht, brecht deutsch), in Jaro-mar, -staw, -polk, -gnew, auch ger geschrieben (Germar, Gero-vit, Cesi-gor). Ein n ist auch zugesetzt in Rathebernus (C. P. 95) für Ratibor.) beherrschte; der war Knuds Schwestermann, also avunculus seiner Söhne, ist der avunculus des Berichts, noch 1050 regierend. Sein Sohn ist der König, der 1069 Leutecier, Polen (d. i. Pommern) und Jomsburger in Heerfolgepflichtigkeit dem Könige Sweinn nach England schickte; beide hatten sich den Dänen angeschlossen, von den übrigen Liutizen gesondert. — Die Tochter Knuds, o. Z. eine uneheliche (Die dänischen Könige hatten damals viele uneheliche Söhne, waren mehrenteils selber solche. Auch der Obdrite Godschalk war in Knuds und Sveinn Estridsons Gefolge und erhielt des zweiten Tochter, deren uneheliche Geburt Helmold gar nicht anmerkt.), muss Wolf um 1026 geheiratet haben, da Knud 995 (Nach Snorre, später nach Knytlingo S., was zu seinen Verhältnissen nicht passt.), Wolfs dritter Sohn um 1030 geboren ist.
Die Nachrichten über Wolf fügen sich demnach vollkommen und ergänzend in die anderweitigen Meldungen, sind von Wigbert her treu, obwohl nicht vollständig, zu seinem Biographen gelangt. Das ist denn auch von denen über die Vorfahren zu präsumieren. Der an der Spitze stehende Emelrik (gth. Amalareiks) heißt rex Teutoniae, über (nicht in Teut.), also kann Kuning nicht nach seiner etymologischen Bedeutung (= Etheling) wie es z. B. um 880 der Angelsachse Wulfstan braucht, gefasst, Teutonia nicht, wie schon von Brotulf im 16. Jahrh., als Ditmarsen verstanden werden. Ich schließe: er war einer der vielen Näskonungar (Vorgebirgs- oder Seekönige), deren Herrschaft Gorm der alte († 936) vernichtete, als er Jütland bis zur Schley eroberte (Langebek SS. rer. Dan. II 80. Anon. Roskild. und Gunlaug Olaf-Trygvesons 8. bei Dahlmann Forschungen 1, 431 ff.), seine Teutonia ist der Westteil der Insel nördlich des Liimfjord, das jetzige Thyland, Insel Thud bei Adam v. Br., Thythe - Sysscl im dänischen Reichslagerbuch von 1231, auch Thiut in U (Ad. Br. 4, 16. Langebek 1. c. VII 518; iu = eu, vgl. nur Lin-, Leutizien.). Seine Brüder, deren Namen in der oberdeutschen Form (durch Umsetzung aus der nordischen) gegeben sind, flüchteten zunächst nach der Diözese Verden, wo Ditmar blieb, Herlib nach Brandenburg zu den Liutizen, wie nachmals dorthin Kizo und andere, damals zu diesen Graf Wichman aus der Verdener Diözese, er vielleicht als dieses Begleiter. Herlibs drei Söhne heißen dort Hartungen, entweder weil sie durch Größe und wilden Mut sich so auszeichneten, dass man den Namen der sagenberühmten Harilingen (Hérulen) auf sie übertrug, oder weil sie sich von solchen herleiteten. Bekannt ist seit Alters der Harlungerberg bei Brandenburg; vielleicht will der Autor sie damit in Verbindung setzen, da er die zwei älteren wohl als dort verblieben andeutet.
Die Namen der Familienglieder sind deutsch, nur Wolf, Sohn einer norwegischen Königstochter, hat einen nordischen (Als (späterer) deutscher ist er Verkürzung aus Wolf-gang, -ram, -hard, hier wolf aus Huolf — Hülfe entstanden. — 45) Vgl, §. 18 Anfang.), sein Bruder und dessen Sohn slawische und zwar solche, die in keinem Fürstenhause als dem pommerschen Vorkommen und dort der eine bis ins 15. Jahrhundert (Swantibor, Sohn Wartislaws X. † 1464); Wolf aber hat einen primatus in Pommern erlangt einige Zeit vor der um 1026 zu setzenden Verheiratung, also in der Jugend. Offenbar war Swetibor Fürst in Pommern und nach ihm seine Söhne; wie er und Wolf als Herlibs Söhne zu der Stellung kommen konnten, wie Wolf nach dem ihm zugeschriebenen Charakter sich später die unrechtmäßige Ausschließung gefallen lassen konnte, ist nicht abzusehen; Pommern stand seit 993 unter einem Wojewoden Boleslaws von Polen, und Herlib ist als solcher nicht zu fassen, weil sonst der primatus ihm zuzuschreiben war, nicht dem jungen Sohn. Der Bericht bedarf einer Modifikation: die slawisch benannten sind von der Familie auszuschließen, Wigbert hat erzählt, Swetibor und Wolf seien Brüder nur durch die Mutter, die Einschränkung ist hernach in Vergessenheit gekommen.
Skambor ist als Wolfs Neffe noch Zeitgenosse von dessen Enkel Wigbert, regierte also, dann auch Swetibor, später als Smysl, der 1046 Reichfürst unter Kaiser Heinrich III., mit Kasemir von Polen gleichberechtigt, Herr über ganz Pommern, von polnischer Herkunft war. Demnach ist er, zufolge polnischen Berichts Stammvater des pommerschen Fürstenhauses, Vater Swetibors, Stiefvater Wolfs; dann ist er bald nach 1046 gestorben, und er ist es, der aus polnischen Wojewoden erst dänischer Vasall, dann unabhängiger Fürst ward. Er ward Zinsvasall Knuds, als Wolf zu diesem ging, ward unabhängig, als Wolf die Herrschaft in Jumne erlangte; die Dänen, welche ihm 1044 im Kampfe gegen Polen beistanden, sind Wolf und seine Jomsburger. Die vorragende Stellung (den primatus) in Pommern konnte dieser nur erlangen, wenn Smysl zweiter Gatte seiner Mutter war, nicht umgekehrt, die Ordnung der Namen im Bericht, „Swetibor und Wolf“, ist nicht zu urgieren. Als Wolf in Pommern unbequem ward, hat er mit des Stiefvaters Hilfe einen Teil des angrenzenden Ukerlandes erworben, darin Pasewalk gegründet, c. 1020.
Wolf ist 1050 gestorben, nach allem einige Jahre vor 1000 geboren (Von den beiden Angaben, er sei alt geworden oder durch die Kriegszüge früh aufgerieben, harmoniert nur die zweite mit den übrigen Daten.), Swetibor also wohl nicht nach 1010. Dann kann die Mutter als Königstochter aus Norwegen nur sein eine Tochter des Hakon, der 962 dänischer Jarl über West-Norwegen, 975 darin unabhängig ward, 994 gegen Olaf Trygveson fiel. Seine Kinder irrten umher, bis der älteste Sohn Erik im Jahre 1000 durch den Verrat der Jomsvikinger den Sieg am Svöldr und damit Norwegen als König gewann. Für die Zeit des Umherirrens passt die Verheiratung seiner Schwester (der in der Jomsvikingersaga genannten Ingeborg?) mit einem fahrenden Ritter edler Herkunft ganz wohl; Herlib wäre denn von Brandenburg nach der Jomsburg, wo auch Sachsen waren, und von da zu Erik gegangen, vermutlich als dieser 996 Gotland auf kurze Zeit eroberte. Lässt man ihn die 60 wendischen Schiffe vom Svöldr nach der Jomsburg führen, dann dort 1000 ff. als Jarl walten, so hat man eine Stellung, welche die Heirat seiner Wittwe mit Smysl, seines Sohnes Anspruch auf und Herrschaft über Jumne und dessen Vertreibung von dort erklärt.
Der Bericht des Pegauer Mönchs ist glaubhaft, mit allem in Einklang, willkommen, fordert nur die Annahme eines leicht erklärlichen Missverständnisses und als sehr kurz gefasst Supplierungen, wie sie die Geschichtsforschung überall nötig hat, wo sie musivisch arbeiten muss.
21. Sinysl war 1016 Herr von ganz Pommern, Swetibor (pommersch nun Swantibor (I) ist Wolfs einziger Bruder. Bis zu seinen Söhnen Skambor I. und Brüdern hat Wigbert die Genealogie berichtet; man darf annehmen, dass sie um 1075 regierten, wo er aus der Nachbarschaft der Liutizen ins Meißnische, gleich darauf nach Böhmen ging, also die pommerschen Verhältnisse aus den Augen verlor. Von Skambor und seinen Brüdern sind die hernach heraustretenden Linien der Fürsten Pommerns abzuleiten (Freilich könnte Smysl auch von einer zweiten Gattin Söhne gehabt haben, aber man kommt aus mit dem, was berichtet ist.).
Subislaw I., Fürst zu Danzig, starb 1178, war Geisel 1111, also geboren 1100 oder bald nachher. Sein Großvater Svatobor (Swantibor 2) † 1108 ist also nicht nach 1050 geboren, mithin Sohn Swetibors, und dieser war, da jener consanguineus Boleslaws III (Blt. St. 16, 2, 71 habe ich ihn deshalb für vermählt mit Boleslaws II Tochter vermutet, das geht nicht, da dieser 1066, er jedenfalls vor 1078 vermählt ist.), vermählt mit einer Schwester Kasemirs I. von Polen, vermutlich als zweiter Gattin, weil nicht wohl vor dem Vertrag von 1046. Svatobor stand mit Polen in Verbindung als Vasall, und sein Land wird um 1075 zu Polen gerechnet ((Nämlich Ad. Br. 4, 13 setzt die Polen hinter den Pommern als Anwohner des Baltischen Busens.). Nun hinterließ Kasemir 1057 seinem Sohne Boleslaw II. auch die Oberherrschaft über die (1056 unabhängigen) Pommern, — sie ist gewiss erst 1056 erworben, wo das deutsche Reichsszepter aus der starken Hand Heinrichs HI. in die seines Sohnes, eines Knaben, überging, und zugleich die Liutizen einen großen Sieg über die Deutschen erfochten, — der verlor sie jedoch 1071 in Folge eines unglücklichen Feldzuges in Böhmen, doch nicht über die Danziger Linie. Also war schon geteilt, Swetibor tot.
Subislaw I. ist geboren v. 1100, Wartislaw I. von der Belgarder Linie o. 109,5, Domislaw zu Stettin, der 1121 einen 8—10 Jahr alten Sohn hatte, nicht nach 1088. Dann ist er Enkel des etwa um 1035 geborenen Skambor, Swantibor III das Zwischenglied, Wartislaw I. Enkel des nächsten Bruders. Dafür ist noch, das Jumne, o. Z. Pommersch seit 1074, wo es die Dänen verloren, neben dem Belgarder Landesteil liegt, doch 1124 zum Stettiner gehört, und dass Wigbert den Bruder genannt haben wird, der es besaß, ihm der nächste war.
Rakel hatten bis zur Niederlage am 10. August 1109 mehrere Fürsten, deren Vater ein anderer Bruder Skambors sein muss; es kam damals zunächst an Swantopolk I. als polnisches Zinslehn, c. 1115 an Polen (6). Ich lege ihnen noch Schlawe (mit Stolp) zu, nehme an, dass sie in der Niederlage mit den ihres Heeres gefallen, dies Gebiet an den Belgarder als damaligen Verbündeten Boleslaws, wohl auch als Zinslehn, gekommen. Denn a) so werden die vier Landesteile ungefähr gleich; b) die Fürsten sind 1109 in Rakel nicht anwesend, c) können einen Heerbann von 40.000 zum Entsatz führen, d) können wohl nur die sein, die den Swatobor wegen der Anhänglichkeiten an Polen verdrängten, einkerkerten, durch Boleslaw geschreckt losließen; e) 1108 werden in des Belgarders Gebiet nur die Burgen genannt, die westlich von Belgard liegen, aber f) 1113 wird dies als Zentrum desselben bezeichnet. g) Schlawe c. p. gehört der Belgarder Linie 1140, vor der Teilung zwischen Wartislaw und Ratibor c. 1128, o. Z. auch 1121, aber h) S. Otto kommt nie dahin, offenbar weil er die Eifersucht des Gnesener Erzbischofs nicht wecken will (Blt. St. 16, 2, 69 ff. — 7) 8. 12 A. 9. — » 8) So respektiert er ängstlich die faktisch nicht bestehenden Rechte des Magdeburgers über Muritz, den leeren Anspruch des Roeskilders aus Rügen. Vgl. §. 11 zu A. 11.), der i) um 1280 es vorübergehend zu seiner Diözese zog, als Zubehör mithin des ihm 1136 confirmierten Rakel.
Den 1108 hingerichteten Pan Gnewomir von Czarnkow bezeichnet Matthäus von Cholewa als Belgarder, dann war er Bruder des Belgarder Herzogs, und wird man die Teilung in dem Landesteil so formieren müssen, dass (analog der in Polen von 1138) der älteste Bruder die Hauptburg voraus erhielt und zu ihr Colberg, Gnewomir Czarnkow, ein ungenannter Cammin, das 1108 wieder den, Belgarder gehörte. Auch Skambor muss mehre Söhne hinterlassen haben, da neben den Swantiboritzen in der Umgegend Stettins andere Panenfamilien sich im Stargardischen, Pyritzischen und Wollinischen zeigen, wenngleich sie nie als Verwandte bezeichnet werden.
22. Darauf wirft Licht eine polnische Nachricht, wenn sie richtig gefasst wird. „Wladislaw Herzog der Polen erlangte über die zu Hilfe kommenden Pomoranen, als er ein Schloss derselben (Rzececz) belagerte, auf Marien Himmelfahrt (15. August 1091) einen großen Sieg (am Flusse Rzeczen, Neize), nahm nach dem Siege ihre Städte binnen Landes und um die Küste ein, und ordnete seine Gastalden (vuslaldiones) und Grafen in den Haupt- und festeren Orten, und ließ, um den Heiden das Vertrauen auf einen Aufstand zu benehmen, alle Festen im Mittelpunkt (meditullio) des Landes in derselben Stunde durch seine Befehlshaber verbrennen. Doch konnte auch so das rebellische Volk nicht gezähmt werden. Denn die Sethegus, der damalige Kronfeldherr, ihnen vorgesetzt hatte, die töteten sie teils für ihre Missetaten, die edleren Standes aber, bescheidener und ehrenhafter sich haltenden verjagten sie kaum unter Zustimmung der Freunde. Dieses den seinen angetanen Unrechts gedenkend rückte Wladislaw beim Eintritt der Fasten (9. Februar 1099) ins Land, überrumpelte gegen Ende derselben eine volkreichere und vermöglichere Stadt und zog mit großer Beute und zahllosen Gefangenen von da zurück. Als er sicher schon den Grenzen seines Reiches nahe war, überfielen ihn die folgenden Pommern am Flusse Natzka und lieferten am Tage vor Palmarum (20. März) im Felde Drzu eine lange blutige Schlacht; wer den größten Verlust erlitten, ist zweifelhaft, doch die Polen beschlossen heimzukehren, Gott strafte die Entweihung der Fasten, sie hatten lange kein Glück (Mart. 2, 1,2 p. 133 ff. Kadl. 2, 23: prefectis ibi conatitutis . . omnes Polonorum prefectos Los excutiunt illos interimunt; also die nach Mart. vom Herzoge ordinati, und die quos Sethegus eis prefecerat sind identifiziert, wohl weil Setheg damals des Herzogs Factotum. Die eingeklammerten Namen geben erst Dlngosz und die späteren (aus ihnen Kanzow), aus einer vollständigem HS. des sog. Martinus (aus welcher auch chr. princ. Pol. den Namen Nackam hat) oder aus Klosteranzeichnungen vgl. §. 12 A. 17.). Unglücklich war auch der Angriff auf Nakel um Michaelis, obwohl drei Haufen Böhmen in Sold genommen waren. So sind allmählig die Pommern gegen Polen in Übermut erhoben — Das Berichtete ist im Ausgange und durch die Zeitbestimmungen zu sehr beglaubigt, als dass es verworfen werden dürfte, andrerseits ist der Anfang mit der Schwäche der ganzen Regierung Wladislaws so sehr im Widerspruch, dass der Bericht wie er lautet, nicht annehmbar ist, dass man durch Umdeutung modifizieren muss. Zunächst betrafen die Heerzüge nur den Stettiner Landesteil, denn auf ihn weist das Schlachtfeld bei Driesen (Über Drzu und die Nacka (sprich Natzka = kleine Netze) s. B. St. 15, 1, 166.), und demgemäß Rececz als Reetz, 1269 castrum Retz, 1296 öder Burgwall, und den Belgarder und Stettiner Landesteil zugleich anzugreifen wagt der viel kräftigere Boleslaw III. erst, als er das übrige Pommern unterworfen hatte und auch sonst sehr erstarkt war. Jene genannten Orte sind im Stargarder Gau; Stargard selber ist wegen der Richtung auf Posen oder Gnesen über Driesen die 1092 überrumpelte größere Stadt. Wurden auch o. Z. Beute und Gefangene den Polen bei Driesen wieder abgenommen, so hat der Ort doch sehr gelitten, da S. Otto ihn von Pyritz nach Cammin notwendig passiert haben muss und er doch bei Beschreibung der Reise nicht genannt wird. Die Umgegend ist auch das meditullium des betreffenden Westteils von Pommern, und gerade dort finden sich urkundlich benamte Burgwälle ohne Orte, fast die einzigen im Lande, Carbe östlich von Werben, Peszik zwischen Stargard und Massow, Camenz östlich von Golnow, welche also wohl die 1091 verbrannten sind. Die loca principalia kann man auch fürstliche Orte, Sitze übersetzen, die darin vom Polenherzog ordinati bekommen teils vom deutschen Lohnwesen hergenommene Titel (Gastalden finden sich vornehmlich in der Lombardei, entsprechen den sonstigen Vizegrafen.), teils den der praefecti, den aber brauchen die polnischen Chronisten von den pommerschen Fürsten bis auf Swantipolk († 1266); sie sind die nobiliores, sie haben Gefreundte d. i. Verwandte unter den Pommern, welche zu ihrer Landesverweisung die Zustimmung geben und solche statt des Todes kaum erwirken; die Auffassung fordert das „kaum“ im Bericht. Sie sind offenbar keine eingesetzten polnischen Beamten, was dem gesamten Geschichtsverlaufe widersprechen würde, sondern Pane des pommerschen Fürstenhauses, die wieder polnische Oberhoheit anerkannten; sie sind als prefecti auch die prelati, welche jene Festen verbrannten. Es hat eine innere Entzweiung stattgefunden; ein Teil hat sich der polnischen Hoheit unterworfen und zu dessen Unterstützung ist der Feldzug unternommen, worauf auch eine chronistische Meldung Weist (Boguph. 2, 29 Summ. hat seine Vorgänger so verstanden, dass die Setzung und Versagung der prefecti dem ganzen Feldzuge vorangegangen.); nach dem Siege ist er und zugleich die besiegten förmlich investiert, so ins polnische Reich eingeordnet worden. Die nicht vom Polenherzog sondern vom Kronfeldherrn eingesetzten sind andere, geringeren Standes, werden gemäß ihrer Schuld getötet, sind die polnische Besatzung im o. Z. eroberten Reetz, die, als sich die Pommern nach dem Abzuge des Heers wieder erhoben, besonders feindlich verfuhr (Flüchteten sich die damals polnisch gesinnten Panen dahin, so erklärt sich die Verbindung im Bericht.). Antipolnisch war augenscheinlich der Stargarder Pan, für Polen denn seine Nachbarn, welche die Festen in seinem Lande verbrannten, im Binnenlande der Pyritzer, um die Küste der Wolliner, im Stettiner Landesteil der einzige dort, und der postulierte Caminer, dessen Verschwinden sich so erklärt. Denn der Belgarder allein bietet sich dar als der Helfer, den die antipolnische Partei gegen die polnische und die Polen nötig hatte, und für ihn in diesen Ereignissen allein die Gelegenheit, wo er die Senioratsrechte, die er 20 Jahre später im Stettiner Landesteil, aber nicht im Danziger hat, und den Besitz um Pyritz, in dem wir seine Nachkommen finden, erworben haben kann. Und wenn dem Gnewomir „vielartige Verrätereien“ zugeschrieben werden, die er nach seiner Taufe (Sommer 1108) verübt habe, dazu aber die Zeit bis zu seiner Hinrichtung bei der Eroberung von Filehne (Ende 1108) (Mart. 2, 44, 47—49. p. 227, 229 ff. über den Tod auch Kadi. 3, 5, 7; Bog. p. 33. 12) nicht ausreicht, so werden die Verrätereien auch früher verübt, wird dem postea ein et beizudenken sein, dann bietet sich dafür nichts dar als jene Heerzüge Wladislaws; er war denn 1091 für diesen, 1092 in der Schlacht bei Driesen an der Grenze seiner Herrschaft unter dessen Feinden.
Demnach wird man sich den Gang der Begebenheiten so vorzustellen haben: Skambor, Fürst über den Stettiner Landesteil, unabhängig seit 1071, ist 1091 gestorben; sein ältester Sohn Swantibor 3 erbte die Castellanei Stettin, andere Söhne Pyritz, Stargard und Wollin; es entstand Streit über die Teilung, über das Vorrecht des ältesten; der Pyitzer und Wolliner wollten lieber die Oberhoheit des Polenherzogs wieder anerkennen als die seinige; ebenso stellten sich Gnewomir und der Camminer gegen ihren Bruder zu Belgard; dieser aber gewann den ersten, verjagte den anderen, half die beiden übrigen vertreiben, die Polen besiegen; nun erlangte der Belgarder das Seniorat, die ober- priesterlichen Rechte in beiden Landesteilen; hernach werden der Pyritzer und der Wolliner restituiert, aber jener muss Pyritz mit einem Bezirk dem Belgarder, der andre Lebbin dem Stettiner abtreten, auch diesem sich unterordnen.
23. Sehen wir nun, was sich über die Pane des Stettiner Landesteils ermitteln lässt.
Den Stargarder Gau trat Barnim 1210 an den Bischof ab, vertauschte ihm aber dafür 1218 das östliche Land Colberg „als sein wahres Eigentum von den Vätern her.“ Solches war also das Stargardische nicht. Nie erscheint vor der deutschen Verwaltung ein Beamter, aber 1220 mit Swantiboritzen in einer diese angehenden Sache neben Burgbeamten und Burgherren „Woislaw in Stargard und sein Bruder Unimka.“ Ferner Woislaw c. 1225 als Zeuge in der U., worin der Swantiboritz Wartislaw Bartholomei alle seine Güter im Lande Colbatz der Abtei überlässt (ib. 460. Worzlaus ist Schreibfehler wegen Pauli filius vgl. U. 57. — 4) ib. 281 wo pribtua, unzulässig.), er und sein Bruder Pribinka 1229 in der U. für die Johanniter zu Stargard (s. u.), die Brüder Pribina und Laurentinus 1220 (20) (Ende Januar an Boguslaws II. Sterbelager, wo die versammelten ein berufener Landesausschuss sind] in diesen drei U. als Söhne des Paulus, der in der letzten, frühesten den Titel Herr bekommt zu einer Zeit, wo von Laien er Männer des hohen Adels bezeichnet, Übersetzung von Pan als Besitzer fürstlichen Paragiums ist. Auch Herr Svantebor, von dem für seine Seele und von seinen Erben (um 1203) Klein Küssow an Colbatz conferiert ward (ib. 343. Die Vergabung geschah mit Zustimmung Boguslaws II. also nach 1200, einige Zeit vor der Eroberung Stettins durch Deutsche (die Märker, 1212); der Ort steht wschl. corrumpiert in der Bestätigung von c. 1206; s. C. P. 994 zu 81.), gehört zur Familie nach der Lage des Orts. Durch die mehreren Herren erklärt sich der Ausdruck Woislaw in Stargard.
Die Verhältnisse der Herren ergeben folgende Urkunden, a) 1212 conferiert Boguslaw II. an Colbatz das Landgut Clebow (Es ist der Westteil des Orts mit Wietstock (und Retzowsfelde). E. P. 543. 1017.) unter Mitwirkung des Tessimer Pribo‘s Sohnes, erlaubt den Erben Wartislaws (II.), die verkaufte Besitzung Woltin selber zu conferieren, vergönnt in gleicher Weise (similiter indulsimus) Strewelow (im Stargardischen) mit Holzungsfreiheit in den Stargardischen Wäldern und conferiert in bleibender Schenkung Quetzin im Colbergschen (ib. 327. 1084. 999 f. Das Jahr 1222 muss 1212 sein s. 1. c. Jetzt füge ich hinzu: Cammin als Ort der Verhandlung weist die U. vor die Landesteilung von 1214, die Verödung des Gebiets nach den märkischen Einbrüchen von 1211-12, so dass die U. von Ende 1212.). Dies allein also, gelegen „im Eigen von den Vätern her“, schenkt er selber. Clebow conferiert er (= überträgt das Besitzrecht) cooperante dilectissimo nostro Tessimero; dieser ist also der eigentliche Geber (Eben so ist Panten Mistislaws S. 1153 cooperator bei der Stiftung des Klosters Stolp. Über die Familie künftig.), wegen des Ausdrucks und der ehrenden Bezeichnung Sohn des einzigen in der betreffenden Zeit vorkommenden Pribo, welcher Burgherr von Gützkow, Sohn des „Herrn“ Bork, (Enkel des Fürsten Mistislaw) war (Eben so ist Panten Mistislaws S. 1153 cooperator bei der Stiftung des Klosters Stolp. Über die Familie künftig.). Von den andern Güter gibt der Herzog nur die Verbriefung und die Erlaubnis zur Besitzübertragung, diese, ein fürstliches Recht, geschieht durch die Besitzer selbst, die also noch höher stehen als Tessimer, und müssen die unter den Zeugen erwartet werden (Sie sind: Thomas de Lokenitz. Soitin. Onnimen. Wartizlauus. Wocech. Kasimerus. Pribizlaus. Den letzten hatte ich für den 1215—40 zu Cammin, wo die Verhandlung, gesessenen, für Bruder des Tessimer (A. 8); über die anderen s. §. 25. 28. 29.). Wie nun
188
wirklich mehre der Erben Wartislaws II. darunter sind, so auch der Vergaber des Guts im Stargardschen, der zugleich über die Wälder im ganzen Lande disponieren kann, nämlich Onnimen als jener Unimka. (Sicher hat das Or. der U. Onnimen gehabt; entweder ist en = e die Diminutivendung (die im polnischen aber mit bei Sachen bräuchlich) = ka, oder men ist germanisiert aus ma, vergl. Unemans (später Nomis-, Nunns-) hagen bei Massow also im Stargardischen.) b) Auch Herr Slawebor hat selber conferiert, der Herzog nur zugestimmt. c) 1229 bestätigt Barnim dem unter seinem Großvater (also vor 1187) entstandenen (Erste Erwähnung 1186: Gerardus de Stargard E. P. 187.), auch vom Vater begabten Johanniterordenshause zu Stargard alles, nämlich die Orte Sallentin, Collin, Wittichow, Zarzig, Wulkow, Cocolichino, Kitzerow, Zadlow, Clempin, und spricht dieselben frei von allen Leistungen an seinen Hof und an seine beneficiarii; Zeugen sind der Castellan, Camerar, Tribun und mehrere Edle von Stettin, Ratmir (von Garz), Milówic, die Söhne des Paulus Woislaw und Pribinka, Jacobus, Laurentius (ib. 406. 568. 1006. Die drei letzten Orte Gumence, Lecnieea, Gogolovo sind außerhalb des Stargardischen, denn es bieten sich dafür passend und allein dar Gogolowe (1. e. 1003, von Ratmir gegeben?) Löknitz (vor 1268 des Bischofs, der es als 1240—48 Herr des Stargardischen für Zachan, das 1269 Ordensgut erlauscht hatte) und Gumnitz, (dann Gabe der Pane von Ükermünde; die Pertinenzien des 1216 an Grobe vergaben Eggesin reichen zwischen Uccra und Locniza an jener abwärts [nicht bis an diese sondern] bis zum Fließe Cemuniza [bedeutet Kaltbach] E. P. 246, schließen also die FM. Gumnitz aus, aus deren Scheide der Hof Schafbrück ein ehemaliges Wasser anzeigt.) Alle drei sind wohl die unter Boguslaw II. erhaltenen Güter.). Darnach hatten jetzt die Stettinschen Beamten die herzoglichen Gerechtsame über das Stargardische wahrzunehmen. Die speziell ausgeführten Leistungen sind die, welche sonst im eigentlichen Pommern z. B. im Camminschen die Herzoge erhielten, hier ausnahmsweise auch die Vasallen, welche also als Pane bezeichnet werden, die Leistungen, mithin auch die Orte an die Johanniter (successive wie bei Colbatz) vergabt haben.
Die zwei unter den Zeugen genannten Söhne des Herrn Paulus gehören denn zur Familie der Vergaber; ihre Brüder Unimfa und Laurentius waren Wohl gestorben und sind die zwei folgenden Zeugen Jacob und Laurentius Söhne von ihnen oder eines von ihnen. Der vorhergehende Milówic wird sein Sohn des Slawebor, der ja Erben hatte, und Vater des Slawbor, der 1259 Zeuge eines Colbatz betreffenden Vertrages. Auch Thomas von Primus (so heißt Priemhausen 1295, Premuze 1269) und Johann von Rogow (Roggow), beide 1291 Johanniter zu Schöneck, rechne ich zur Familie, — sie wären in den Stargarder Convent getreten, bei dessen Auflösung durch Barnim nach Schöneck versetzt, — so wie den Unema, von dem Unemanshagen den Namen hat. — 1229 erscheinen die Pane gleich den Swantiboritzen mehr heruntergedrückt. Als Barnim dem Bischofe das Land „mit der Vogtei“ 1240 abtrat und es eben so, doch ohne das Massowsche 1248 zurücknahm, mussten sie den gewöhnlichen Vasallen gleich werden. Keine der von wendischen Orten des Landes benannten Familien scheint von ihnen abzustammen, da dieselben durch die deutschen Namen ihrer ersten Glieder oder sonst als deutsche erkennbar sind, es seien denn die v. Küssow (Die ersten mir vorgekommenen Michael und Heinrich im 14. Jahrh.), die dann Nachkommen der Slawbor sein würden, die c. 1202 Klein Küssow an Colbatz gaben.
Der Ostteil des Landes war sehr öde, weil ihn vornehmlich die polnischen Verheerungen 1091 f. 1118 ff. trafen. Doch ist darin die große Erbbesitzung, Cürtow, zu der auch Reetz gehörte, welche 1237 der Herzog Wladislaw Odonicz von Großpolen den (Stargarder) Johannitern verlieh, wie sie sein Oheim Wladislaw († 1229) besessen hatte; er conferierte auch 1233 an Colbatz die angrenzende Erbbesitzung Trebene mit Doberpol, sowie 1296 das Dorf Warsin. Aber Barnim hat alle in die alten Grenzen des Stargarder Landes (Tempelgaus) eingeschlossen, als er dies dem Bischofe 1240 überließ, hat das an Colbatz vergabte 1235. 1237 ff. confirmiert, dagegen Cürtow mit dem Schlosse Rez (nach 1248) an deutsche Ritter verlehnt, weswegen er 1269 mit denselben in den Bann kam. Er hat also den polnischen Besitz nicht als rechtmäßig anerkannt, wenn auch bei Trebene „die in Wladislaws Privilegium angegebenen Grenzen“ bestätigt. Reez war 1091 ein bedeutendes castrum. Wladislaw d. ä. war Gemahl einer Tochter Boguslaws I. erster Ehe und 1186 bei ihm, 1220 in freundlichen Verhältnissen mit Ingardis und den Swantiboritzen; der Odonicz († 1239) war seit 1233 machtlos, zuletzt auf die 3 Castellaneien Exin, Rakel und Uscz beschränkt: Zur letzten gehörte laut U. die ehemalige Herrschaft Gnewomirs, ist denn auch gerechnet das angrenzende westlich der Drage. Er conferiert nur, schenkt nicht, in jenen U., das conferierte ist ein Dorf und zwei große hereditates, allodiale Besitzungen von Erbherrn; die begabten sind ein Pommersches Ritterordenshaus und Kloster. Aus alledem folgere ich: Zu Reetz und Cürtow saß ein Zweig der Stargarder Pane, kam irgendwie, vielleicht 1220, wo Barnim als Knabe succedierte, unter zweifelhafte polnische Oberhoheit, vermachte beim Aussterben den Besitz an die Stiftungen seines Hauses und der verwandten Swantiboritzen; die U. des Polenherzogs sind nur Eigentumsübertragung.
24. Kasemir I vergabte 1176 an Colbatz die Feldmark Prilep (im Stargardischen, auf welcher die Dörfer Gr. Schönfeld vor 1179, Alt Prilipp vor 1206 entstanden), und befreite die dort Anzusiedelnden. Daraus habe ich früher geschlossen, das ganze Land Stargard habe 1160—81 zu seinem Landesteile gehört. Indessen gehörte es bei der folgenden, 1214—1264 bestehenden Landesteilung zum Anteil des älteren Bruders, sie aber wiederholt sonst überall die von 1160, auch würde mit dem Stargardischen der Anteil des jüngeren Bruders größer und einträglicher sein als der des älteren. Sonach ist der ganze Tempelgau dem Lande Boguslaws beizulegen, wie sein den Swantiboritzen gehörender Teil unter ihm stand, und Kasemir I besaß nur eine Enklave. Und wenn er nun freit ab omni exactione que mei juris est (er also nicht alle Gerechtsame hatte), nämlich dass die Colonen keinen Burgdienst leisten und kein weltlicher Richter ihnen beschwerlich sei, der Bischof aber etwas später bei der feierlichen Übergabe bezeugt, Kasemir habe jene Befreiungen bewilligt und auch, dass sie dem Landesfürsten nicht den Zins (Tribut) entrichteten mit dem übrigen Volke, so wird folgen: Nur Burgdienst und Gerichtsbarkeit war dort seines Rechts, die Münte seines Bruders als dort Landesfürsten, mit dem er sich indessen darüber verständigt hat. Die Grenzen der Besitzung hat er ringsum selbst bestimmt, mithin besaß er auch das angrenzende, also Broda (Passmühle), welches Boguslaw (als sein Erbe, nach 1181) dem Edlen Walter auf Lebenszeit schenkte, dann 1186 mit den von ihm bestimmten Grenzen an Colbatz zu verkaufen erlaubte, und die Feldmark Garzica (Neu Prilipp und Sabes), welche seine Söhne c. 1205 an Colbatz gaben (ib. 194. 1083. 994. Die Erwerbung der dort bestätigten Güter durch Colbatz ist von allen andern bekannt außer von Garzica, dies ist also das von den Ausstellern der U geschenkte.), dann wohl auch die östlichere Gegend bis an Sallentin und die Erbschaft Trebene, im 14. Jahrhundert Bezirk des Schlosses Lübtow der von Schöning als Colbatzisch Lehn. Auch Grindiz (Werben) und Damnitz, das älteste urkundliche Besitztum des Bischofs dort, wird Kasemir ihm vergabt haben, da sie an Prilep grenzten und der Bischof den Anspruch an einen Teil der Feldmark Broda (die nur ein schmaler Streifen war) gegen Geld 1189 aufgibt. Rinskow, das Anastasia 1224 ans Treptowsche Nonnenkloster schenkte, das jedoch 1227 nicht übergeben (weil durch anderes ersetzt) ward, und das (Renzk) 1240 der Bischof besaß, wird gleichfalls von Kasemir herrühren, zu Carbe gehört haben. Zu diesem castrum, das auf der 1176 festgestellten Scheide von Prilep gegen Broda lag, waren denn die Orte burgdienstpflichtig, nicht nach Stargard. Die Nutzungsfreiheit aller Wälder in der Stargardschen Provinz zu Bauholz, Heuwerbung, Weide und sonstigem Gebrauch des Klosters Colbatz und seiner Colonen, die Boguslaw 1185 mit der Bestätigung von Prilep gewährte, betrachte ich gleichfalls als Zubehör von Carbe vgl. oben Strewelow), nicht als landesherrlich.
Kasemir besaß den Bezirk als Enklave, solche kommen in den Landesteilungen vor 1582 nicht vor, sind speziell gegen das Prinzip derer von 1160 und 1214 welche die Hauptteile des Landes nach Burgwarden teilen, so dass jedes Fürsten Gesamtgebiet aus zwei Stücken besteht, — er besaß ihn nur zu Panenrecht unter Landeshoheit des Bruders, er hat ihn also von Stargarder Panen erworben, ich meine ertauscht von „Unima von Camin, einem Sarnoslawitz“, Zeugen über die Vergabung von Prilep. Dieser ist 1176 unter den Caminer Edlen,1181— 1208 Castellan daselbst, dies ist 1220 Zetislaw Unimiz, — wonach der als Caminer Edle 1176—94 erscheinende Cetzlaw Unimas Bruder ist, — 1229 Zetslaw mit seinem Sohne Stoislaw, der ist schon 1220 Zeuge, 1228 Tribun, 1232—1244 Castellan daselbst; 1269 erscheint dort Ritter Ceslaw, wohl sein Sohn; vielleicht ist das letzte Glied Teslawa, Frau von Riebitz, deren Güter, bei ihrem Tode an Herzog Wartislaw IV verfallen, von ihm 1323 seiner Schwester, der Äbtissin Jutta, auf Lebenszeit überlassen wurden (Oelrichs U. B. 59. Rypeze ist Riebitz, 1621 Riepze, die Güter also wohl die später von Brochusischen.). Laut U. von c. 1240 haben die ztrzlauici, Erbbesitzer der Kirche S. Aegldien zu Camin, dieselbe den Dominicanern übergeben, und fügt der Herzog einen Platz hinzu; unter den Laienzeugen ist der erste jener Stoislaw, „Erbbesitzer der gedachten Kirche“; die übrigen 11 sind wohl die sämtlichen dortigen Edlen und unter ihnen noch andere Glieder der Familie, dann nur Woycech, der erste nach den Beamten, und Sulislaw (C. P. 597. S. über die Zeugen m. Zusammenstellung im Register des C. P.) jener wird 1291 als weiland Besitzer von Kl. Stepenitz und Ganserin, Vater des Ritters Woyko des jüngeren bezeichnet. — Dass die Familie zu den barones, principes x. gehört, zeigt die erste Erwähnung: Unima (noch nicht Castellan von Camin Sarnoslawitz, ganz wie nur noch Wartislaw von Stettin Swantiboritz und Odolan von Liulizien Sohn Kasemars (des 1182 gefallenen „Herrn“). Sie für Zweig der Stargarder Pane zu halten, der sein Erbgut Carbe an Kasemir I gegen Sitz und Besitz im Caminschen vertauschte, bewegt mich, dass Unima das erste Glied Zeuge ist bei jener Vergabung von Prilep, sein Sohn 1220 bei Swantibor von Colbatz, dass den sonst nicht vorkommenden Namen Unima gerade zwei der Stargarder tragen, und zwar der 1215, 1220 erscheinende in der Diminutivform, also doch wohl im Gegensatz gegen den 1208 noch lebenden Camminer, endlich dass das Caminsche, welches zuletzt (c. 1274) deutsche Verwaltung erhalten hat, gleich Colberg zum ursprünglichen Eigen der Herzoge gehörte, daher keinen eingeborenen höheren Adel (Zupane, barones, principes) haben konnte, auch gleich dem Colbergschen nicht hatte, wie die Vergabung des ganzen Landes Treptow mit mehreren Familien niederen Adels dartut; die dort vor 1274 erscheinenden vornehmen Familien sind teils durch fürstliche Bedienstung emporgestiegen (die Nantkowitz, Verchewitz, Kleisten), teils von auswärts dahin verpflanzt; so die Witten als Zweig der Wolliner Pane (s. d.), die Borken, Bartuswitz, Sabesitz, Dobescitz, von einzelnen Nacimer, Swirzo, Rochlo, deren aller liutizischer Ursprung sich Nachweisen lässt; so denn gleich den ersten auch die Sarnoslawitzen als Zweig der Stargarder (Stoislaw führt 1240 im Siegel ein Agnus dei. Die Borken, Barluswitz, Kleisle und von Woedtke haben 2 Tiere übereinander, die aus den ältesten Siegeln nicht zu unterscheiden, später bei den beiden ersten gekrönt, bei den ersten Wölfe, bei den übrigen Füchse sind. Das weist auf Gemeinsamkeit, nicht der Abstammung, die nicht stattfindet, dann der Burgmannschaft zu Cammin. Dann hat es mit den Sarnoslawitzen eine andere Bewandnis.). Sarnoslaw als Unimas Vater zu nehmen, ist nicht notwendig, er kann ganz wohl Stammvater der Stargarder Linie sein, wie Swantibor an die Spitze der speziellen Stettiner zu stellen war.
25. Im Pyritzer Gau zeigen sich zuerst als Herren von Zehden Slawtech und Gozi-, Gotislaw. Jener ist 1183 Zeuge bei der Bestätigung von Prilep an Colbatz und am 18. März 1187 bei Boguslaws I Tode unter den „Edlen des Landes“, so dass vor ihm stehen Wartislaw (II) und Odolan von Liutizien, nach ihm Stephan von Ucra (-münde, Enkel des Fürsten Mistislaw), die Castellane der beiden Hauptburgen Demmin und Usedom, die von Gützkow und Wollin. Gotislaw ist wenige Wochen später in der Versammlung der optimales terre, — der barones et suppani, der principes Pomeranicae gentis, — hinter Wartislaw, der nun Landesregent, den (Castellanen) von Demmin, Ukera, Prenzlau, Pasewalk, Colberg, Camin, vor Heinrich (Ranniwitz, Herrn in Tolense, aus „erlauchter“ Familie der Liuticier dem Wolliner und Usedomer und 1189 bei dem Vertrage des Bischofs mit Colbatz mit fast denselben Zeugen unter den letzten (ib. 162 (s. zu A. 27). Hier stehen sie meist mit dem bloßen Namen ohne Angabe der Orte. Statt Wartislaw stehen Fürst Zaromar als jetzt Vormund und Roszwar als (vermutlich schon) Castellan von Stettin. Hinzugekommen ist der Camerar (aus p. 160) und Sovithin der letzte.). Aus der Zusammenstellung erhellt, dass sie zu den Supanen, den Panen gehören, keine herzoglichen Beamten (laut der zweiten U.), Vater und Sohn sind. Als Sohn des zweiten ist anzusehen Heinrich von Chinez — Herr der Burg und des Landes Kienitz, weil in Pommern damals nur erst solche von Orten benannt wurden — 1224 Zeuge bei der Stiftung des Treptowschen Nonnenklosters, das 1227 auch ein Dorf im Lande Stölpchen hatte, (C. P. 352. 380 (mit n. 20) 1001. Vgl. überhaupt B. St. 15, 1, 180—183. Slawen des Namens Heinrich sind schon der Raunivitz 1193 und 1173 H. Plochimeriz.) wohl von ihm, da beide Distrikte später zu einem Archidiakonate vereinigt waren, mithin als das Land Kienitz der U. über die Diözesanverhältnisse anzusehen sind.
Eine verwandte Linie der genannten Pane ergeben folgende Daten, (a.) 1234 beim Vergleich zwischen Swantibor und seinem Kloster Colbatz über die Grenzen zwischen Madüe und Thu sind Zeugen Barnizlaus filius Suotini. Suotinus fraler suns. Vinozlaus et Jacobus et Simon (ib. 474. 1086. (VmozI. ist zu präferieren, VinozI. zu lesen).). (b.) Im selben Jahr zu Stargard sind Z. der U., worin Barnim den Templern das Dorf Darmietzel im Lande Kienitz am Flusse Mietzel mit 200 Hufen verleiht und schenkt, dieselben fünf (B. Svytin. J. S. Wensclaus) und: Gustisclaus. Mirosclaus; und (c) im selben Jahre am 28. Dezember zu Zpandow verleiht Barnim den Tempelrittern das ganze Land Bahn mit aller Gerichtsbarkeit und es lassen alles Recht an dasselbe und die Dörfer darin gänzlich nach die heredes beider, nämlich die 6 ersten Zeugen von b (B. S. Svytin. J. Wenezl. Gvtizl.) und (ein anderer) Symon, Nicolaus, Lenardus, Jargoneus (ib. 483. 1005. In derselben U. lässt Barnim alles etwaige Recht und Gericht am Lande Cüstrin nach (das hatte der Polenherzog 1232 dem Orden geschenkt). Zeugen sind derselbe Chalo (U. 47) und 4 Stettiner Edle. Das Jahr 1235 hat, wie gewöhnlich auf Weihnachten angefangen, ist also 1234 zu übersetzen (vgl. U. 531. Da der Besitz bei Cüstrin mit dem Haupthause Quartschen als der älteste überodrische des Ordens anzusehen ist, da Barnim erst am 4. März 1236 gleichfalls zu Zpandow (unbekannter Lage, Greifenhagen?) den Templern Zollfreiheit für sie und ihre Leute, die von nun an zu seinem Gebiete übergehen würden, erteilt (C. P. 513. 1005), mithin Bahn und Rörchen nicht vor Ende 1234 den Templern verliehen sind und doch die U. deutsche Namen der Grenzmale hat (Zickleinsbrücke, Buchwald, Silbermösse, Lotstieg, Steinwehr, vgl. N B U. 58): so muss die vorhandene U. eine (nur) um die Grenzbezeichnung vermehrte spätere Ausfertigung der ursprünglichen unter deren Datum sein, wie damals C. P. 682 (vgl. die U. dort und 1013) davon ein Beispiel gibt, die spätere Zeit nicht ganz selten.). (d.) 1223 auf dem Landtage des Herzogs unter den principes et barones terre nostre ist letzter (jüngster) Barnislau filius Suiotiui, (e) 1242 Barnislaus erster Zeuge bei Swantibors Vergabung aller seiner Güter im Lande Calbatz an das Kloster; (f) 1237 in der Bestätigung von Trebene an Colbatz sind Zeugen Panten Stephaniwiz (ein Mistislawitz) et Jacobus Szotinuwitz. Vinsclaus et plures alii (ib. 535 (auch hier ist in Vniscl. der Punkt des i zu verschieben.), wo das Patronymikon und die Verbindung die Identität mit den obigen dartun. (g) 1185 bestätigt Boguslaw T. Prilep an Colbatz, hatte auch von ihm etwas ertauscht für das Dorf Gorna mediante Svoitino, (den der auch bei einer ähnlichen Abtretung von Wartistaw II. gebrauchte Ausdruck als bisherigen Besitzer und in höherer Stellung zeigt,) Zeugen Barnizlaus ... Suotin (ib. 136. 991. Die zwischenstehenden Zeugen sind Prizesk. Wogard. Wozesk.). Dieser ist unfraglich der medians, der Vater von Barnislaw d. a. b. c. e. und Swoitin a. b. c., — für Gorna ist nichts vergleichbar als Gornow im Lande Bahn, seitdem dies den Templern gehört, fehlt es in den Colbatzschen Confirmationen (Es fehlt schon 1235 (ib. 490) — die nächst vorhergehende ib. 193 hat es — folglich ist c von 1234 s. U. 48.), — ist der 1189 mit und nach optimates aufgeführte Sovithin, der 1212 zwischen Burgherrn als (interessierter) Zeuge über Woltin und Clebow stehende Soitin. Wegen der Namen seiner Söhne ist der 1185 (in g) mit ihm genannte Barnislaw sein älterer Bruder. Seine Söhne sind denn Jacob und Simon, da sie nicht Swoitins Söhne sind (nach a) und doch mit denselben in engster Verbindung stehen (a. b. c.); das ihm (in f) gegebene Patronymikon ergibt denn einen Swoitin (diese in g sich findende Form ist die eigentliche nach der Etymologie und wegen der böhmischen Form Swogtin, als Großvater oder Ahn (Auch der mitgenannte Panten kann nur Enkel des Stephanus sein. Vgl. in Rügen Nicolaus filius Pribizlai 1233 (C. P. 198) = Prib. Wolcowicz et filius suus Nic. 1232 (440) = Nic. Wolcowiz i 240 (600).). Jacob wird auch sein der J., 1224 Tribun von Stettin, (h) 1235 Z. für Colbatz, sein Bruder der 1235 als Stettinscher Edler vorkommende Simon nach der Stellung, welche die Glieder der Familie in c haben, werden Simon und sein Vetter Barnislaw, die Erbbesitzer des Landes Bahn, die übrigen 3 erbberechtigte sein. Von Simons Vater wird das Dorf Barnislaw, das 1243 den Zehnten an S. Marien in Stettin entrichtete, den Namen haben (ib. 680. Es heißt erst seit dem 18 Jahrh. Barnimslow, noch im 16. 17. Barneslaff, Barenslow.) Wenslaw mit dessen Söhnen eng verbunden, erbberechtigt doch kein Swoitinowitz (f. abc), ist zu achten als ihr Schwager, als Winzlaus Polonus in der die Swantiboritzen betreffenden U. von 1220, als Großvater des 1300 erscheinenden Polonus de Clebow (58), somit Ahn der 1679 ausgestorbenen Palen, v. Pahlen, welche zu Clebow den Hauptsitz (worüber 1356 Vergleich,) davon und von Brünnken, Klütz, Schöningen Anteile als Lehne von Colbatz besaßen. Als Zwischenglied ist anzusehen (i) Mesico, polnischen in Pommern sonst nicht vorkommenden Namens, 1272 in der Bestätigung der Colbatzschen Güter und Grenzen Zeuge nur mit einem Deutschen (der 1254 Zeuge über Falkenberg) und mit Barnislaw, der nach dem Totale Sohn des jüngsten Swoitin.
Dass die Swoitinowitzen zu den Panen gehörten, zeigt die Stellung, in der sie in den ältesten U. vorkommen (g. d.), zeigt auch die U. über Bahn (c.). Denn da Swoitin 1185 Besitzer im Lande war (g), so kann sie mit den Worten „die Erbbesitzer entsagten mit gutem Willen dem Recht an das Land und seine Dörfer, guod addixerant vel attriburant sibi“ nicht das Besitzrecht überhaupt sondern nur seine Ausdehnung in Frage stellen; sie besaßen es und behaupteten ihr altes Recht als Pane, das aber gestand Barnim auch den Swantiboritzen nicht mehr zu, seitdem sich deutsches Wesen einbürgerte; hier aber überließ er es den Templern (Wenn Barthold aus den U. b. c. folgert, die heredes (s. darüber U. 19) seien mit Gewalt depossediert, so fehlt dazu jeder Anhalt; die Entsagung in c. ist die gewöhnliche, jeder Besitzveränderung vorhergehende „Resignation, Aussagung“.) wie denn die Comthure bis ins 17. Jahrh. zu den „Herren“ (im Gegensatz der „Mann“) zählten, das Recht der Burggesessenen, die Vogtei hatten.
Die in o angegebenen Grenzen des Landes Bahn sind die späteren der Comthurei Wildenbruch, überall sicher, schließen aber mit Anfang und Ende nicht zusammen. Die dortigen Ordensgüter Röriken, Steinwehr und die Feldmark Königsberg waren es also schon, sind dadurch von Barnim als solche anerkannt, hatten ihre nicht erhaltene U. Sie sind die 200 Hufen am Fließ Rurka im Gebiet der Burg Sden (Zehden), von denen der Lebuser Bischof den Templern 1235 die Zehnten verlieh und zugleich (den Besitz von) 200 Hufen unbebauten Landes neben der Mietzel im Gebiet der Burg Kienitz, d. h. von Darmietzel c. pert. (b). Dass er in den beiden Burgwarden Besitz- und Diözesanrechte wirklich hatte, folgt daraus nicht, wohl aber, dass er sie beanspruchte, wogegen die Templer sich sicher stellten; auch das folgt, dass die Veste Kienitz selber mit ihrem Oderwerder nicht mehr pommersch, in seinem Besitze war. — Für den Vergaber jener Güter im Zehdenschen an der Rörike und für jüngeren Sohn des Gozi-, Goti-slaw von Zehden halte ich den Gusti-, Gutislaw, den sechsten Zeugen über Darmietzel (b), sechsten heres im Lande Bahn (c), wegen dieses Besitzes, wegen der Namen und weil er nicht unter den Nachbarn Swantibors und des Klosters Colbatz (a). 1240 stand das Land Ceden unmittelbar unter Barnim und hatte seit langer Zeit (den märkischen Verheerungszügen 1211, 1212) verödete Dörfer. Das Land Kienitz wird nicht genannt, war wohl noch Panenbesitz.
Denn 1241 verglich sich der Lebuser Bischof mit den Templern über den Zehnten des (neben Darmietzel nordwärts gelegenen Dorfs) Nabern (c. pert.), welches ihnen der polnische Graf Wlosto geschenkt hatte. Er kann es nur durch Heirat oder Kauf erworben haben, war vielleicht auch der Vergaber von Mezilbori (Umgegend von Soldin im Lande Pyritz), welches Wladislaw von Polen 1238 den Templern verlieh; dieser nämlich war gar nicht in der Lage, um dorthin ins pommersche übergreifen zu können, da er damals nur noch die Castellaneien Usz, Nakel und Exin hatte, dagegen die Gegend um Landsberg und Berlinchen um 1236 Herzog Heinrich von Schlesien, dann Barnim, wenn also der Orden sich von Wladislaw eine U. ausstellen ließ, so ist das wohl nur geschehen, weil er Landesherr des Vergabers war. Und wenn die 6 ersten heredes, die dem Lande Bahn entsagen, an einem andern Orte und in naher doch nicht ganz gleicher Zeit die Vergabung von Darmietzel bezeugen und hier ebenso, doch genau nach der Verwandtschaft aufgeführt werden, so wird man sie als daran erbberechtigt ansehen müssen, was denn unsere Auffassung des letzten als Bruders des Heinrich von Kienitz bestätigt, den darauf folgenden Miroslaw als dieses Sohn, als den eigentlichen Vergaber ansehen dürfen.
Die vier letzten heredes im Lande Bahn (c) sind: ein zweiter Simon, wohl der einzige um die Gegend und Zeit, nämlich 1242—43 als Schultheiß von Woltin vorkommende (etwa als Besitzer von Hohenbrück); der Deutsche Leonhard, etwa als Vater des Walter v. Kunow, der 1255 über Wartenberg Zeuge war und dessen Familie bis 1705 einen Teil des Dorfes Kunow vor Bahn besaß, weil von dessen Feldmark ein Teil in die durch c bestimmte Grenze des Landes Bahn fallen muss (Sie geht einen Weg entlang von der Hohen Brücke zum Ende des Buchwaldes, (des am Buchsee,) war also im ganzen gerade, schloss ein das Ordensgut Gäbersdorf und 2/3 der Feldmark Rohrsdorf (1296 und stets zu Wildenbruch, aber 1/3 vom Herzoge 1346 ans Ottenstift und dazu seit dem,) folglich auch einen Teil der Feldmark Kunow, wohl die 16 Hufen dort, über welche der Orden 1296 Vertrag schloss.); Nicolaus als der, welcher 1237 Zeuge über die Stettinschen Kirchenverhältnisse ist, vor Natimar (von Garz s. 28) steht, und als der Nicolaus Pretboroviz oder Priborits von Rischow 1220, 1225 Bürge und Zeuge für die Swantiboritzen, nach Wartislaw Bartholomei, vor Zetislaw Unimiz (24), Roszwar (Castellan von Stettin), Woislaw Paulus Sohn (von Stargard) (C. P. 552. 574. 575; 298 (mit Zetislaw durch et verbunden, so dass die folgenden Zeugen geringeren Standes, wie das auch die Namen Nade, Vismast zeigen, und Petrus von Rissow also nicht zur Familie gehört) 458. 460; gegen Hasselbachs Bemerkung 1086: beide U. gehören zusammen, also ist der Nic. in beiden derselbe, Priboziis und Bissow also Schreibfehler der Matr. (z und r, B und R oft sehr ähnlich) ebenso Worzlaus in Woizl. zu ändern (U. 3), dann auch Kotimerus dazwischen, hier nie, auch in der Zeit nirgend vorkommend, in Ratimerus, der auch 552. 574. 575 aus Nic. folgt.) also gleich diesen vom Panengeschlecht, wofür auch das Patronymikon zeugt, — die zwei Dörfer des Pribor, 1240 nahe Pyritz belegen (also Gr. und Kl. Rischow) und nach dem Context herzoglich, zeigen wohl nicht den Namen eines Sohnes, sondern des Vaters; — endlich Jarognew weist auf Verwandtschaft mit Tessimer, den, Vergaber von Clebow 1212 (23), als dem Sohne des Pribo (der 1183 Mitzeuge über Prilep) und Neffen des Jarognew von Gützkow, da der Name in Pommern sonst nicht vorkommt; vielleicht ist der Bahner nach Ostpommern gegangen, ist Jarognew Castellan von Schwetz 1238—1206.
Die Grenze des Landes Bahn ist gegen das Pyritzische und dort allein durch zwei Wege bestimmt, deren größerer deutschen Namen hat (Jetzt Lothweg, damals östlich auch 1264 Grenze der Templer gegen Beiersdorf und Hausfelde — Krauseeiche Dreger 473, wo fälschlich Fodstich; als Grenze des Lotding? — Gerichtsbezirk.), das Land ist also wohl erst durch die Abtretung an die Templer entstanden, abgezweigt. Ferner erscheinen die Swoitinowitzen so vorher als nachher in den Colbatzschen Urkunden, namentlich über die Grenzen g, d, a, e, f, h, i) Swoitin 1212 als interessierter Zeuge über Woltin (g). Sie sind also o. Z. Besitzer der Gegend zwischen Pyritz, den Ländern Bahn und Colbatz. Als Woltin angrenzend wird nun in der damaligen und in den späteren Grenzbeschreibungen Crapove (Alt-Grape, bis ins 17. Jahrhundert Grapow angegeben, mithin als ein die vorliegenden Orte (darunter Schwochow befassendes Gebiet, also erschließlich Sitz; so mögen die v. Grapow (von denen mir zuerst Otto 1232 vorgekommen) (Wohl zu unterscheiden von den Grapen, deren erster Nic. Grope c. 1280, stets ohne de, von.) und von Schwochow (Ebel d. i. Apollonius 1350 dgl.), welche 1337 auch in der Neumark begütert waren, von der Familie stammen, Otto als Sohn des Barnislaw von 1272; beide sind ein Geschlecht, denn die im 16. Jahrhundert ausgestorbenen von Schwochow saßen zu Neuen-Grape und nach einem Verzeichnis aus der Zeit die v. Grapow zu Schwochow.
26. Die Burg Pyritz gehörte sicherlich zu dem Leibgedinge , das Boguslaw I nebst dem Lande Treptow a. d. R. (dies erst nach dem Tode Kasemirs I, der es hatte) seiner Gemahlin Anastasia aussetzte (Nach ib. 351 (zu n. 30: oboy war nicht zu vergleichen, bedeutet: beide scil. Männer, aber oboy, woboy = Umhereinschlagung z. B. von Pfählen um einen Teich) 381. — Das Wobinsche Feld der Stadt Pyritz ist nach Brügg. vom Stadtfelde unterschieden, also das eines gelegten Dorfes. Auch Megow und Brietzig besaß Belbuck 1268 nicht mehr, auch nicht mehr das (dafür erhaltene) 1253 besessene Gr. Mellen (Dreger 337 550.)), denn sie datierte hier 1235 die Urkunde, wodurch sie die Kirche zu Treptow an ihr dortiges Kloster gab, (also doch wohl nicht aus einer Reise,) und dotierte dasselbe 1224 auch mit den Dörfern Strosewo (Strohsdorf) und Oboy (Wobinsches Feld), für welches zweite und Rinskow 1227 Megow und Brietzig gegeben wurden, Rinskow im Lande (und in der Feldmark) Stargard, die andern in Pyritz. So nur erklärt es sich, dass bei ihren Lebzeiten kein fürstlicher Beamter oder Burgherr von Pyritz vorkommt. Leibgedinge wurden gleich bei der Verheiratung ausgesetzt. Nach Saxo war der Dänenkönig Kanut 1185 verwand mit Boguslaws l. Söhnen, also mit Anastasia, und zwar, da deren Name nach Polen oder Russland weist, durch seine Mutter Sophia, Tochter Wladimirs von Nowgorod und der Rixa, Tochter Boleslaws lll. von Polen; dieses zweiter Sohn Boleslaw IV. († 1164) heiratete 1151 Anastasia, Tochter des Fürsten Wladimerko von Halitsch, wäre ohnedies allein als Schwiegervater vergleichbar. Boguslaw II. hat 1193 schon ein Reitersiegel, — sein die Urkunde mit ausstellender Bruder noch nicht, — wird 1187 als mitvergabend angegeben, (der Bruder nicht), ist also, wenngleich beide damals als parvuli bezeichnet werden vor 1180 geboren; dagegen am 18. April 1177 war Anastasia noch nicht mit Boguslaw vermählt (Er bestätigt an dem Tage eine (vor Herbst 1175) für die Seele seiner geliebten Gemahlin Walburgis gemachte Schenkung.), sie starb 1240 (Sie lebte 31. Mai 1240 (C. P. 622) wird nicht mehr erwähnt (als tot) 24. Juli 1242 (ib. 668); bereits am 24. April 1240 ließ sich Barnim vom Bischof den Zehnten der Feldmark Pyritz und der öden Dörfer im Gebiet abtreten (ib. 617) wohl weil der Tod Anastasiens zu erwarten war.) Boguslaw hatte demnach Pyritz vor dem Tode seines Bruders.
Auch dieser besaß dort etwas. Er hatte den Schlossbezirk von Lebbin (auf Wollin) der dortigen Kirche geschenkt, diese aber vereigne nach seinem Tode Boguslaw der Dompropstei mit allen Zubehörungen, darunter Vitense in (Kasemirs Lande) Gutzkow, und der Hälfte des Dorfs Brietzig in Pyritz; sie wird abgezweigt sein als das angrenzende Filialdorf Lettnin, denn dies gehörte nachmals dem Caminer Vicedominus, dessen Amt von der Dompropstei abgezweigt ist. Das Dorf gehörte zum Lande Lippene, das der Bischof 1233 und bis 1276 besaß; er wird es von Kasemir I. erhalten haben, der ja auch die Domkirche zu Camin gestiftet und zuerst begabt hat.
Die Herzoge hatten demnach den Burgbezirk von Pyritz geteilt, nicht in Ansehung der landesfürstlichen Hoheit, das wäre gegen das Prinzcip ihrer und aller folgenden Teilungen bis 1500, sondern beschränkteren Rechts; mit andern Worten: Kasimir hatte diese Enklave nur mit dem Recht der Pane, Boguslaw besaß zu seinem Anteil mit solchem noch die landesfürstliche Hoheit über den ganzen Tempelgau, unter Barnim hatten die dazu gehörigen, jetzt vermehrten Rechte die Stettiner Beamten wahrzunehmen. Wartislaw hatte zu Pyritz nicht nur den Asylhof in der Tempelfeste, wie zu Stettin und Wollin, sondern es erscheint auch seine Autorität bedeutender als sonst im Stettinschen und keine Abhängigkeit von Stettin, also hatte er mutatis mutandis das Recht, was seine Söhne. Vom Gebiet haben den größeren Teil die verwandten Swoitinowitzen und Zehdener. Im Schlosse scheint auch den Swantiboritzen irgendein Recht zugestanden zu haben. Aus alle dem ziehe ich den Schluss: Zu Pyritz saß ein Sohn Skambors (Swoitin?) als Pan, Ahn jener Familien, ward 1091 vertrieben (22), bald hergestellt, doch so, dass er Pyritz mit der nächsten Umgebung dem Belgarder abtreten musste.
27. Wollin stand 1108 unter Oberhoheit des Belgarder Herzogs, bekannte sich 1124 von Stettin abhängig und hatte Wartislaw nur den Asylhof und oberpriesterliche Rechte. Damals war dort Redamir der vornehmste Mann, der mit seinem (erwachsenen) Sohne den Bischof Otto nach Stettin geleitete. Der mit Ratibor 1135 auf einen Raubeinfall in Norwegen ausgezogene Häuptling Unibor gehört hierher. In den J. 1175, 1185 war Wenceslaw hier Castellan; 1193 erscheinen „Subislaw und Dobislaw von Wolyn“ unter Castellanen und Burgherren, die hier alle ohne Amtsbezeichnung, der zweite 1187 mit dem bloßen Namen unter eben solchen (ib. 224. 146. 160. In der ersten U. ist noch ein Dob., der wird der Cast. von Colberg sein, dessen Vorgänger noch 1187 in der anderen.). Mit solchen stehen 1220 „Usemarus, Ubizlaus in Wollin cives“ mit Swantiboritzen, Panen von Stargard und lauter Vornehmen, 1227 Wsemarus (so, nicht Us. ist der Name zu sprechen, vgl. die mehreren Wsewolod im russischen Fürstenhause) mit den Castellanen und Tribunen von Colberg und Camin, gleichzeitig Wizlaus Cast, in Wollin, und ein paar Jahre später, in den Zollbefreiungen der Lübecker von 1234, Pribislaw albus und sein Bruder Slawke von Wollin mit den Beamten derjenigen Burgen, wohin lübische Schiffe kommen konnten. Pribislaws Söhne sind Teszlaw albus und sein Bruder Dobeslaw, die Ritter T. und D., Brüder der Gattin Dobeslaws, Sohnes des sehr vornehmen Rochill von Demmin, der erste zuletzt 1277, der zweite 1279, = Teslaw Primislawitz (für Prib., da der Name Primislaw nur einmal und in Ostpommern vorkommt), Dobeszlaw 1262, jener 1276 mit und nach dem Swantiboritz Kasemir und Bork (Dreger p. 529. 457. Kratz Gesch. der v. Kleist I. 29. 27. Lisch Meckl. U. 1, p. 143. Gleichzeitig sind Tetzlaw v. Cummerow = Dobescitz und Tetzlaw Junker von Klötikow = Sabeszitz, vgl. Tetzlafshagen.), den Edelsten des Landes. Seine Söhne sind ohne Zweifel Pribislaw albus 1279 und Ratslaw albus, 1288 Besitzer von Plötzin bei Wollin. Zweifellos haben wir hier die Familie Witten (1348 Teslaw Witte) welche Wittenfelde (vor 1320 angelegt und) teilweise noch in unserem Jahrh. besessen hat, ebenso Güter im Ksp. Triebzow, diese wohl als zum Teil Erben der v. Grambow nach 1280. Der erste Pribislaw ist nach dem Namen seines zweiten Sohnes ein Sohn des Dobeslaw von 1193. Pom Bruder Slawke leite ich ab die von Mockerwytze, Mukerirz, die 1575, als Burg- gesessene auf Torgelow und Vogelsang (hier saß 1295, der als Töter Barnims II. bekannte Vidant v. M.) ausstarben, weil dieselben 1321 Nachbarn der Stadt Wollin (Die deutsche Stadtgemeine existierte 1288, die Burg war 1284 fürstlich und vor 1276 an den Mecklenburgischen Prinzen Pribeko überlassen.) sind, noch Gr. Mokratz etc. besitzen, und 1380 Slawomir, 1428 Schire (= Siro, Siroslaus) und Slaweke (Verkürzung aus Slawomir) vorkommen. Indem 1193 zwei Castellane, 1220—1234 vier oder fünf als Castellane oder cives Vorkommen, ist offenbar, dass sie nicht fürstliche Beamte sondern, stets mit den vornehmsten genannt, Burgherren, Pane sind. Wir dürfen darnach sämtliche hier genannte als Geschlechtslinie fassen. Ubislaw und Wsemar sind denn die Vettern von Pribislaw albus, Söhne des Subislaw von 1193. Des ersten Enkel wird sein der unter Boguslaw IV. oft genannte Ritter Obesco, Ubesco (Dimin. von Ubislaw) (Der Name ist von obiiam, das bedeutet (wie ckobiiam, wovon Dobislaw) ganz zu Boden schlagen.), weil dieser 1299 Conow bei Wollin ans Wolliner Kloster verkaufte, Stammvater der (im 17. Jahrh. ausgestorbenen) Ubeske; das Zwischenglied wird Wizlaw sein. Von Wsemar möchten stammen die v. Parlow (Ratzlaf 1429) und die von Paulsdorf, insofern einer der ersten vorkommenden Paul heißt, das Dorf also von einem gleichnamigen Ahn angelegt sein wird. Jedoch was nach 1270, muss ich dem zu entscheiden überlassen, der die U. sämtliche einsehen kann.
Auch die Glieder von Weneeslaw aufwärts passen zu einer Geschlechtsreihe, Unibor als der ungenannte Sohn von 1124. Nedamir hat denn solches Alter, dass er sehr wohl Skambors jüngster Sohn sein kann. Da von dem nicht großen Gau der Westteil, der Schlossbezirk von Lebbin schon 1124 abgenommen war, unmittelbar unter Stettin gehörte, so es schwerlich ursprünglich gewesen sein kann, so habe ich angenommen, Nedamir sei der 1091 aus die polnische Seite getretene, vertriebene Pan von Wollin, hernach restituiert so, dass Lebbin an Swantibor, er selber in Abhängigkeit von demselben und dem Belgarder kam.
28. Wartislaw II., der Swantiboritz, besaß erstlich das Land Colbatz (Als Land C. P 460, 658; das castrum lag nach der U. Dreger 120 wohl südlich des Dorfes.), das von ihm und seinen Nachkommen in einzelnen Vergabungen an die dortige von ihm gestiftete Abtei gelangte. Grenzen waren: der Dammsche See nordwärts bis zur Ihna, diese hinauf bis zum Benzidul = Wurmgraben (dem bei Hinzendorf, Bienenfurt,) zum Fließ Smogerwitz (bei Neuhaus), die Mitte der Madüe bis zur Wostrowitz, diese bis in die Mitte des Bangatz, dann die Feldmarken (einschließlich) Cabow = Falkenberg, Belitz, Zibberose — Woltersdorf, Borin, Garden zum Teil, Sinzlow, Binow, Colow, Buchholz, d. h. es begriff alle die damaligen Orte, deren Zehnten der Bischof 1179 der Abtei verlieh. Davon hatte Wartislaws ältester Sohn Bartolemeus mit seinem Sohne Martislaw: Glin, Kublank, Hof-Damm, Bruchowe, der jüngste Wartislaw und sein Sohn Bartolemeus Sinzlow mit (Kortenhagen) und den Teil von Garden, alles übrige der zweite Sohn Kasemar und dessen Sohn Swantibor, der erschließlich zu Selow den Sitz hatte (S. Blt. St. 11, 2, 133 ff. Vgl. u. a. die U. C. P. 83. 129. 131. 298. 300. 457. 459. 474. 487. 612. 658. 676. 719. B. St. 1, 137. — Damm und Tribus bestätigt Boguslaw II c. 1205 nur mit Gütern, welche nicht von Wartidlaw herrührten und bemerkt vom zweiten, es sei ex utraque parte Plone porrectum a genitore nostro condonatum (C. P. 195); der vertauscht an Colbatz 1182 das predium Damm mit allen Zubehörungen aus beiden Seiten der Plöne, aber mediante Wartislauo (129) d. h. dieser hat e ihm zu dem Behuf abgetreten, daher condonatum. Damm bestätigte er schon 1173 mit allen Grenzen, die Wart. bestimmte (84), daher 1182: perpetna donatione confirmantes. Da er nun 1173 auch etwas geschenkt zu haben angibt, und das nur Damm sein kann, so hat er schon damals den Ort selbst dazu von W. ertauscht, wie 1182 den Rest der Zubehör mit Tribus. Condonamus sagt Kas. II. (C. P. 208) von den Orten, die nach Erbrecht ihm gehörten, aber Jaromar von Rügen an Eldena vergabt hatte.). Er wird auch Cedelin (das Zedlinsche Feld, der Teil der Feldmark Damm westlich des Bachs aus dem Culpinsee mit Äyowsthal und Hökendorf) besessen haben, da sonst die Angabe in seiner U. von 1220: die Colpina sei die Grenze zwischen Cedelin und Damm, ganz müßig, ja ungehörig wäre. Der Ahn besaß zweitens die Erbbesitzung Woltin mit allen Zubehörungen, den Feldmarken Woltin, Damerow, Wirow, Kl. Schönfeld, Kl. Mellen, Bartikow, Teilen von Stecklin und Garden, den an Greifenhagen hernach abgetretenen Waldungen und Brüchen zwischen der Thu, der Screniz (dem Bach bei den Stecklinschen Mühlen und Buddenbrok und dem Kränig), welche von seinen Erben 1212 an Colbatz verkauft ward (C. P. 327. 999 f. vgl. §. 23. A. 7. 9. Woltin ist nur locus, die Zubehörungen sind unbebaut, offenbar durch die Märker 1211. 12 verödet. Die angegebenen Grenzen sind nur die von Woltin, die von Clebow sind vorher erwähnt. Zu C. P. 1084: es bleibt bei lacum (nicht locum) secundum, der lacus primus ist der Stikelin.). Vor 1255 ward Woltin Marktflecken, vor 1280 Burg der Abtei, wohl mit denselben Orten.
Swantibor trat 1242 „alle Güter, die er in der Colbatzschen Provinz hatte“, an die Abtei ab; er hatte also noch anderwärts Besitzungen, zumal er noch 1244 lebte, gewiss im Lande Golnow. Denn davon heißt die Wildnis zwischen Ihna und Plöne, die er 1220 vergabte; das Land verbindet das Colbatzische und das der Familie gehörende Pölitzische (s. u.), die Grenze desselben gegen das dem Bischöfe überlassene Massowische bestimmt Barnim 1248 nicht, wohl aber 1269, offenbar, weil nun das Land unmittelbar unter ihm stand, — er erteilte dem 1220 existierenden Orte 1266 deutsches Stadtrecht, — aber 1248 noch nicht, noch unter Kasemir, Swantibors Sohne, wie denn dieser auch 1269 Zeuge ist über die Grenzbestimmung und alle andern Zeugen erweislich beteiligt waren; auch heißt ein Grenzmal Crisanskelanke d. h. Crisans Wiese, Crisan aber war Swantibors Vasall. Kasemir ist gewiss mit Gütern im Colbergschen und Belgardschen entschädigt, namentlich in diesem, das erst zwischen 1261 und 1265 an Barnim kam, besaß er Persanzig.
Die Verhältnisse des übrigen Stettiner Gebiets erhalten Licht durch drei Verträge Barnims mit den Bischöfen, unter andern auch über die Zehnten, a) 1240: in den Ländern Zehden, Pyritz, Prenzlau, Pinkun und Stettin bleiben die Z. der pia corpora und der Laien, die solche von den Bischöfen zu Lehn haben, unverändert; von den neu zu besiedelnden, seit langer Zeit (1211 f.) verödeten Dörfern erhalten Bischof und Herzog jedweder ein Maaß Weizen, ein Roggen und den halben kleinen Zehnten; mit dem übrigen Kornzehnten belehnt der Bischof die, denen der Herzog die Dörfer zu Lehn gibt; der Herzog erhält für Stargard den ganzen Z. von benannten ukermärkischen Orten, von villa samborii (Sommersdorf), vicus (Burgwiek) Pincun, Woldin (Wollin), Wonezk (Schwennenz), Storkow, Barnims Allodium (Neuhaus mit Polchow), Prezslaw (Pritzlow), zwei Dörfern Cristians (das eine Köstin), Celakow (Zülchow), Pargow, Wostow (Güstow), Crekow, vicus Stettin, benannten Orten im Pyritzschen (C. P. 617 ff. 1012. Von den dort gegebenen Vergleichungen andere ich die von allodium nostrum und villa Christiani. Dies kann slawisch krestino lauten, Kerstin, Karstin, Crostin hieß Köstin noch im 16. Jahrh. und war Bauerdorf. Fürstliches Gut war bis 1321 und vor 1278 (weil dazwischen Leibgedingshof der Witwe Barnims) das Gut Neuhaus und des Herzogs Namen trug ein See (jetzt Barm, Barn), der mit zwei anderen dazu gehörte; sie liegen bei Polchow (1276 Pollecove mit Pfarre), dies ist denn das zugehörige Dienstdorf auch wegen der 30 Hufen.) — b) 1264: über den zweifelhaften dritten Teil des Z. des Landes Vitekowe entscheiden vier benannte Ritter; den halben Z. des Dorfs Nisgriwe erhält Barnim, wenn er will, auf seinen Eid; die Z. der Dörfer Reyneckendorp und Nyenkerken hat ihm der Bischof für eine Anforderung zu Lehn gegeben (Dreger 314. Das J. 1249 ist falsch f. B. St. 10, 1, 169; die U. gehört 1254—65. Ich habe 1. c. 1259 angenommen, setze sie jetzt in 1264. Denn Barnim ist schon Landesherr im Demminschen, das zeigen der Ort der Verhandlung und dass Herzog und Bischof das Land Wstrosim erobern wollen, das kann nicht das ihnen seit 1246 gehörende Land Wusterhusen, muss denn Wustrose sein, d. i. der Demminsche Werder (Wotenick c. p.), der 1236 an den Herrn von Mecklenburg und Schweriner Bischof kam. Vgl. m. A. im C. P. 987 Z. 14 v. u.). — c) 1209 wurden mehrere seit längerer Zeit bestehende Streitigkeiten ausgeglichen, Barnim vom Bischofe belehnt mit den Z. vom ganzen Lande Pölitz, — doch der des opidum blieb der Pfarrkirche, — und von den Dörfern Lensin et Lenzin (Stolzenburg und Lenzen), Crekoue (Gorkow), Parpoth, Panpowe (Pampow, Rothen-) Clempenowe (Dreger 553. Da die zwei ersten Orte gleichnamig, und durch et verbunden, sie allein, wie das nicht selten ist bei solchen, die später durch Beiwörter unterschienen werden, so halte ich sie für die zwei Orte am Gr. Lenzen-See; zuerst 1280 Ulr. v. Stoltenburch. Crekoue ist nicht Krekow, das ja schon in a; Umstellung des r ist solenn. Da Boock und Böck nebeneinander liegen, jenes Name nach der Form der ältere ist, die von Böck eine Zeitlang Löcknitz c. p. besessen haben, so vermute ich, sie haben den Namen ihres Stammorts bei Loitz aus Parpoth übertragen.).
Dies ist nicht erste Verleihung, weil dafür das Aequivalent fehlt, also eine dem Barnim als dem neuen Besitzer nach längere Zeit dauernder Differenz erteilte Belehnung. Er waltet als Herr des Landes Pölitz seit März 1260, vorher besaß es Bartolomeus Martislawi, der oft davon betitelt wird, zuletzt 1259 erscheint (Die Familien v. Pölitz und v. Wussow stammen nicht von ihm s. Bagemihl 2, 118.). Er schenkte 1243 Golazin ans Stettiner Frauenkloster, ohne Zweifel Frauendorf (C. P. 680. 682. (1255 Golentin, 1281 Gollentzyn, vom Golow benannt?) Fr. ist laut des Namens alter und dort einziger Besitz der Nonnen.); im Lande lag Stolzenhagen (Dreger 461 wo fälschlich Holtesh. gedruckt für Stoltesh.); zum Lande gehörte die Parochie Pölitz, bis 1298 mit Lese und ohne Zweifel der neuen Pfarre Tanowe = Falkenwalde, und das 1277 genannte Wasser Pölitze d. h. das Papenwasser, und ohne Zweifel alles bis an die Grenze Liutiziens bis zum Barnimskreuz südwärts. Neuhaus und Polchow gehörten schon zur terra Stettin der Urkunde a, denn sie verteilt zwar die Orte nicht unter die Territorien, führt sie aber nach deren Lokalfolge auf, so dass die ersten bis mit Stoickow zu Penkun gehören, die folgenden zu Stettin, zu diesem ohne Zweifel auch die Dörfer, welche vor 1243 in Ansehung der Einpfarrung, des Besitztums, der Zehnten zu Stettinschen Kirchen pflichtig waren; deren äußerste sind im Norden Bollinken, Zülchow, Bredow, Nembuszowe (= Zabelsdorf, auf dessen Pertinenzen c. 1730 Buchholz angelegt ward), im Süden Muzili (halb Schöningen), Kolbitzow mit Kamnitz, Pomellen, Barnimslow, Ladentin, Mandelkow mit Warrimich (am Wernich See).
Die übrigen Orte in c, dort in gleichem Verhältnismit Pölitz, halte ich deshalb gleichfalls für Besitz des Bartolomeus; auch ist er Zeuge bei der Vergabung der Zopfenbeck zur Mühlenanlage, die aber entspringt im Gebiete der Orte, und er ist überall, wo er als Zeuge erscheint, als irgendwie beteiligt zu fassen. Die Orte, später zu Clempenow und Stoltenborch gehörig, die schon 1295 castra, deren Besitzer hernach als Burggesessene vom östlicheren Lande gesondert sind, gehörten nicht zu Pölitz, auch nicht zu Stettin und Penkun, weil auch nicht Neuenkirchen in b, — es kann nur das im Randowkreise sein, — da es zufolge des Namens neue deutsche Anlage ist, und der Bischof laut u den Zehnten nicht mehr hätte verleihen können (Auch nicht, wenn es möglicherweise wendisches Dorf mit neuem Namen.). Sie gehörten denn zu einem andern Bezirk, dem Burgward Löknitz. Dies war noch im 18. Jahrhundert eine Burg, bis gegen 1890 und seit vor 1268 bischöflich, ertauscht m. E. 1240-48 von den Stargarder Johannitern, denen es 1229 bestätigt ward. Aber 1212 zeigt sich Thomas von Lokenitz, ein Burgherr, Pan, weil damals erst solche von den Sitzen benannt wurden, nach der Lage zu den Stettinschen Panen gehörig; und zwar ist er erster der Zeugen in der Urkunde, worin den Erben Wartislaws die verkaufte Besitzung Woltin zu verleihen gestattet wird, und sind Wartislaws II. Söhne Wartislaw und Kasimer vierter und sechster, auch die übrigen beteiligt sind. Das wird den Schluss rechtfertigen: Thomas ist von Woltin der Haupterbe, ein Sohn Wartislaws II., der dritte nach der Zeitfolge, und der vierte, Wartislaw, Vater des Bartolomeus, sein Erbe, nur dass Löknitz an die Johanniter kam. Dass Thomas nicht weiter vorkommt, darf bei den so wenigen Urkunden zwischen 1189 und 1220 nicht auffallen.
Fiddichow, 1159 osstruin Viüuoboua, 1241. 46. 64. Land, das durch Nahausen excl., das Land Bahn und die Colbatz- schen Güter begrenzt ward, (C. P. 55. 720. 747. v. Naumer Landb. der Neumark 22.) gehörte zum Stettiner Gebiet, weil seine Ostgrenze die des Landes Colbatz arrondirend fortsetzt. Seine Zehnten sind nach b zu 1/3 geteilt, anders als in a, woraus zu folgern, dass es 1240 noch nicht unmittelbar unter Barnim stand. Auch war 1246 Besitzer des Landes Ritter Borchard von Vehlefanz ((C. P. 747. 1014 über die Feldmark Roderbeck c. p. im Lande.) (bei Cremmen, 1375 castrum), also ein deutscher Einzögling; solche aber wurden damals nur mit einzelnen Dörfern, Dorf- und Burganteilen, Hebungen oder mit Wüstungen beliehen, nicht aber mit ganzen Burgwarden im bebauten Lande, so dass er dies durch Kauf oder Heirat von einem Pan erworben hat. Von einem solchen kann auch Kloster Grobe den Anteil an Zoll und Fischerei erhalten haben, da das 1159 ff. nur in Confirmationen vorkommt.
Garz war 1124 eine unter Stettin stehende Burg Gardiz. Davon heißt 1236. 43 Retimar, Ratimar, er ist Ratmir, 1229 mit Panen Zeugen in der Urkunde für die Stargarder Johanniter, die wohl von ihm Gogolowe im Lande Stettin (halb Schöningen?) hatten, Ratimer 1225 bei Swantiboritzen, der Ratimar, welcher 1234 Zeuge ist in der den Lübeckern erteilten Zollbefreiung nur mit Castellanen (und zwar mit allen, von den Burgen, wohin lübische Fahrzeuge kommen konnten. Und als R. v. G. ist er nach Stettiner Beamten Zeuge der Urkunde, worin Barnim den Templern für ihre Kolonisten, die in sein Land überzugehen in Begriff sind, (also nach Bahn und Röriken,) Zollfreiheit bewilligt; er ist also Herr von Garz als einer notwendigen Übergangsstätte und Inhaber ihres Zolls. Aber in den letzten Erwähnungen von 1238. 1243 erscheint er zu Stettin als Zeuge über die Verhältnisse der dortigen Kirchen und des Nonnenklosters, und 1239 (nach 25. Dezember) erteilt Barnim deutsches Stadtrecht „unserer Stadt Gardiz“, wobei Ratimar nicht Zeuge ist, gibt derselben 1259 den Ort des Schlosses, in dem ehemals die Ritter saßen, mit der Stelle des suburdium und allen denselben einst gehörenden Äckern und Wiesen. Darnach hat R. etwa 1238 das Burgward an den Herzog abgetreten, sich nach Stettin begeben; die Ritter sind nicht er und seine Familie, sondern von Barnim dahin gesetzte deutsche, ohne Zweifel unter den vielen deutschen Zeugen der Handveste von 1239. Vom letzten, Reineke von Basedow, hat gewiss Hohen-Reinkendorf den Namen, und das ist das Reynekendorp in b, (Denn von Klein Reink. gehörte schon ein Teil mit Zehnten dem Stettiner Nonnenkloster.) das stand denn nicht unter dem Vertrage a, lag also weder in terra Stettin noch Penkun, wie man sich über den Zehnten von Garz auch vor Erteilung der Handveste verglichen haben muss; dies also ist ein besonderes Burgward mit unbestimmbaren Grenzen gegen Penkun. Für Nisgrive (verschrieben für — ne?) in b finde ich nichts als Mescherin, um 1600 auch Musgerin geschrieben (Im Anlaut vertauschen sich N. und M, vgl. nur Mikolay für Nikolaus.) es stand nicht unter dem Vertrage a, und da Barnim den halben Zehnten auf seinen Eid haben soll, hat er sich darüber mündlich und vor Bischof Hermanns Zeit verglichen.
Wartislaws II. drei jüngere Söhne hatten jeder ein castrum, ein „Land“, man wird auch dem ältesten Bartolomeus ein solches zuschreiben müssen, das, was er um 1212 an den Herzog gegen Gützkow vertauschte), — von den vier Dörfern bei Colbatz gab sein Sohn drei c. 1225 an die Abtei, — dafür ist Penkun vorhanden und allein.
29. So bilden die Territorien der Söhne Wartislaws nebst Garz und Fiddichow einen Rand um das Land Stettin im engsten Sinn (a) und einen anliegenden ostoderschen Bezirk. In jenem trägt das Dorf Barnislaw den Namen eines Swoitinowitzen und findet sich vor 1211 eine Vergabung des Herzogs, die von Teplinina (Bollinken) (C. P. 105 (990). Die des angrenzenden Zülchow findet sich nur in Confirmationen, kann von einem Pan sein.); in diesem besaß Beringer von Bamberg Clenskow und Gribna (beide = Ost-Clebow) „von der Gnade des Herzogs“ (als Lehn) und vermachte sie vor 1187 an S. Jacobi zu Stettin; West-Clebow c. p. besaß bis 1212 ein Gützkower, also nicht ursprünglich, woher? ist unbekannt, ebenso, wer die Feldmarken Podejuch, Klütz, Greifenhagen hatte. Die Vergabungen zeigen dort landesfürstliche Rechte, auch wenn die Güter Angefälle oder ehemaliges Tempelgut waren. 1124 sind zu Stettin und in der Umgegend viele (durch Affinität) Verwandte Domislaws. Wartislaw II. ist Herr in Stettin bis 1189, sein Sohn Bartomeus heißt auswärts davon 1198; aber Castellan ist wohl schon 1189 Roszwar, vielleicht nur Kasemars Stellvertreter, 1208 mit dem Titel neben und nach andern fürstlichen Castellanen, vielleicht nur über das Land im engsten Sinn, nicht über die Pane, aber nach der 1212—1214 geschehenen Veränderung 1216 als erster Zeuge, dann bis 1225, nach ihm Wartislaw, Wartislaws Sohn 1228. 1229, mit anderen Stettiner Beamten, die nun über den ganzen ehemaligen Stettiner Landesteil und seine Pane die herzoglichen Gerechtsame wahrzunehmen hatten, dann 1234 der letzte Johannes, vermutlich Bruder des Bartolomeus, der 1249 bei der Abtretung der Stettiner Burg an die Stadt erster Zeuge ist, gewiss, weil die Familie noch oder ehemals Rechte daran hatte. — Diese Daten scheinen mir zu ihrer Vereinigung zu fordern, dass bei den Teilungen unter den Stettiner Panen das Familienhaupt Stettin mit der nächsten Umgebung als Senioratsgut voraus erhielt, daher seine Gewalt darüber bloß obrigkeitlich, im eigentümlichen auch gutsherrlich war, jene daher, je mehr der Herzog als Geschlechtshaupt heraustrat, desto mehr an diesen gelangte. Bartolomeus d. j., das letzte im Stettiner Gebiet lebende Glied der Familie, erscheint oft als Zeuge in den das Familienstift Colbatz betreffenden Urkunden, außerdem nur bei Vergabung der Zopfenbeck und der Stettiner Burg, — als beteiligt s. o. — in den Gründungsprivilegien der Städte Garz und Stargard, wo sein Oheim das Augustinerkloster dotierte), bei der Vereignung einer Feldmark im Lande Fiddichow und bei der Vergabung der Kirche in (Altstadt) Pyritz, wodurch das dortige Nonnenkloster entstand. Ich meine, er ist als Repräsentant der Familie überall zugezogen, wo diese ehemals Seniorats- und andre Rechte hatte.
Garz und Lebbin waren 1124 den Stettinern untergebene (also relativ selbständige) Castelle. Presst man das, so werden ihre Pane von einem Bruder Domislaws, sonst von dessen jüngeren Sohne stammen; dem nämlich sind beide nebst Fiddichow zur Ausgleichung mit Wartislaw II. beizulegen. Lebbin, von dem kein Pan erscheint, hatte Kasemar I. und vergabte es an die dortige Kirche mit dem ganzen Burgward und anderen Orten; dann war es Angefäll oder passender Heiratsgut; er hatte 1175 eine sonst unbekannte Gattin. Von Edeln im Stettiner Landesteil kommen außer den bereits genannten, den Panen zugezählten bis 1212 nur noch vor; Wocech, 1212 unter den Zeugen über Woltin, (gleich den anderen dann beteiligt, wie Swoitin als Nachbar, dann als Pan von Fiddichow,) = Wozesk (Diminutivform) 1185 mit den Swoitinowitzen Zeuge über deren Vergabung von Gornow etc.; neben und vor ihm stehen hier Pricesk und Wogard, jener als Pricetsic 1183 Zeuge über Prilep mit Wartislaw II., Demminern, Slawtech von Zehden (C. P. >04. — 118) C. P. 137. 130 s. U. 39. 52. Der erste Name ist d. i. Kampffroh. Von cech ist das Dim. oeszk, esszek, voncek ceczek = cetsic vgl. Slawtech, -tek. Wogard ist aus wog böhm. = woy poln. = wig altdeutsch, Kampf; hardy poln. — stolz, trutzig.); er mag Vater Ratimars gewesen sein.
* * *