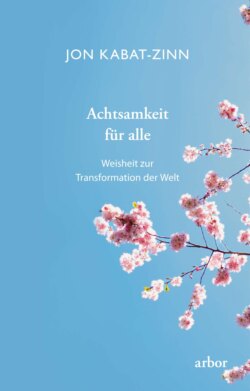Читать книгу Achtsamkeit für alle - Jon Kabat-Zinn - Страница 9
ОглавлениеDie Heilung des politischen Gemeinwesens
Alles, worüber wir in den ersten drei Bänden dieser Reihe, im Laufe unserer Erkundung der Achtsamkeit auf der persönlichen Ebene, gesprochen haben, trifft genauso gut auf unser Verhalten als Land und als Spezies in der Welt zu. Schauen Sie sich irgendein aktuelles Ereignis an. Wissen wir eigentlich, was wirklich vor sich geht? Oder bilden wir uns einfach eine Meinung, die auf unserem Ver- oder Misstrauen gegenüber bestimmten Nachrichtenkanälen beruht, auf reflexartigen Vorlieben und Abneigungen, die uns dazu bringen, uns bestimmte Narrative zu eigen zu machen und andere schnurstracks zurückzuweisen, was uns im Freund-Feind-Denken gefangenhält, in Vorlieben und Abneigungen, darin, dass wir uns gewisse Dinge wünschen und andere fürchten, gefangen in der oberflächlichen Erscheinung der Dinge oder darin, dass wir uns lediglich vorstellen, was unter der Oberfläche geschieht, ohne es, wenn man es genau nimmt, wirklich zu wissen?
Hier kommt die Herausforderung: Können wir die nichtduale Perspektive des achtsamen Gewahrseins auf das anwenden, was in der Welt vor sich geht, und darauf, wie wir als integrale Einheit (Zelle) des politischen Gemeinwesens, das unsere Gesellschaft und unser Land darstellt, mit der Welt interagieren (egal, in welchem Land wir wohnen oder mit welchem wir uns identifizieren)? Können wir zum Beispiel, wenn es um »die Nachrichten« geht, dem, was sich unseren Sinnen darbietet, mit Achtsamkeit begegnen und unser Unterscheidungsvermögen und Nicht-Wissen mobilisieren? Können wir uns jener großen oder kleinen Ereignisse bewusst sein, die sich früher oder später in unterschiedlichem Maße auf unser privates persönliches Leben auswirken werden, die aber meistens weit entfernt von unserer direkten Erfahrung und dem, was im täglichen Leben passiert, ablaufen (bis sie uns betreffen, natürlich)? Und wenn sie uns dann betreffen: Können wir den Momenten bewusst begegnen, in denen wir uns plötzlich direkt oder indirekt von Kräften überrollt und in Mitleidenschaft gezogen sehen, die wir nicht vollständig verstanden haben, ob sie nun in erster Linie ökonomischer, sozialer, politischer, militärischer, ökologischer oder medizinischer Natur sind, oder vielleicht eine komplexe Kombination von allem, wie zum Beispiel die Erderwärmung oder die sich ändernden Spielregeln im Bereich der Gender-Thematik, oder die überaus reale Herausforderung der Migration – dass ganze Völker vor Kriegsgräueln oder Hungersnot und Ähnlichem fliehen? Wir können nichts daran ändern, dass diese Kräfte viel größer sind als wir. Sie stören das Wohlbehagen unserer persönlichen Interessen, Traditionen und Kulturen. Das kann sehr schmerzhaft und besorgniserregend sein. Aber genau diese Kräfte haben auch das Potenzial – wenn wir uns nicht aus dem Angstimpuls heraus gegen sie sträuben –, uns in eine umfassendere Perspektive hineinzukatapultieren, weil es um ganz fundamentale menschliche Fragen geht.
Letzten Endes ist die Frage also: Können wir orthogonal denken?16 Ist es uns möglich, offenherziger zu sein, einladender, ohne dass es gleich unser Wohlbefinden und unsere Sicherheit bedroht? Ist es uns möglich, ein lebendes Beispiel für Mitgefühl zu sein? Können wir lebendige Weisheit verkörpern in der Art und Weise, wie wir auf Veränderungen und Unsicherheit und mögliche Bedrohungen unserer Identität als Individuen, als Land, als Spezies reagieren? Können wir klug sein? Dies sind heute die Herausforderungen, wenn es um die äußere Welt geht, genau wie bei der inneren Welt unseres Geistes und Herzens. Da innere und äußere Welt einander widerspiegeln, bieten sich uns zahllose Möglichkeiten, unser Verhältnis zu beiden zu gestalten und im Gegenzug von ihnen gestaltet zu werden. Vielleicht gibt es auch hier, für uns als Gesellschaft, die Möglichkeit, uns als Ankömmlinge an der eigenen Tür zu begrüßen und erneut den Fremden lieben, der dein Selbst gewesen ist (in den Worten von Derek Walcotts Gedicht Liebe für Liebe am Ende des dritten Bandes der Reihe).
Wir brauchen nur zurückzudenken an das Kippbild alte Frau/ junge Frau oder an das Kanizsa-Dreieck im ersten Band, um uns daran zu erinnern, dass wir sehr leicht nur bestimmte Aspekte der Dinge wahrnehmen oder etwas hartnäckig für real halten können, das eher eine Illusion ist als eine Tatsache. Und das sind sehr einfache Beispiele im Vergleich zu der fließenden Komplexität der Probleme und Situationen, mit denen wir es im Leben jeden Tag zu tun haben, ganz zu schweigen von den Problemen, denen sich unsere Länder und die Welt als Ganzes gegenübersehen. Uns allen passiert es nur allzu leicht, dass wir komplexe Situationen falsch wahrnehmen und an einer unvollständigen oder einseitigen Sichtweise festhalten, besonders wenn wir nicht aufmerksam darauf achten, wie wir sehen und wie wir wissen. Und so schließen wir vielleicht gedankenlos andere Dimensionen einer Thematik rundweg aus, die es eigentlich verdient hätten, als zumindest teilweise berechtigt anerkannt zu werden, bloß weil wir sie schlichtweg nicht sehen wollen. Diese Scheuklappen-Mentalität, dieses zumindest partiell blinde Festhalten an einer Interpretation von Ereignissen, die vielleicht nur zu einem gewissen Grad stimmt, wenn überhaupt, erzeugt Feindschaft und Leid – für uns und für andere. Könnten unsere Institutionen und unsere Politik nicht gesünder und klüger werden, wenn wir alle uns nur ein klein wenig darum kümmerten, das Feld des Bewusstseins innerlich und äußerlich so auszuweiten, dass wir zumindest zu einem gewissen Grad in Betracht ziehen könnten, dass Formen des Wissens, Sehens und Seins, die grundsätzlich anders sind als unsere, auch ihre Berechtigung haben?
Was für Meinungen auch immer Sie vertreten oder nicht vertreten, seien sie politischer, religiöser, ökonomischer, kultureller, historischer oder sozialer Natur, oder einfach nur Positionen, die Sie in der Familie zu den verschiedenen Themen beziehen, die jeden Tag aufkommen – Sie könnten einen Augenblick auch all denen Beachtung schenken, die eine diametral entgegengesetzte Meinung vertreten. Sind sie denn alle auf dem Holzweg? Oder sind sie »schlechte Menschen«? Gibt es in uns womöglich die Tendenz, andere zu entmenschlichen, sie in eine Schublade zu stecken, sie vielleicht sogar zu dämonisieren? Finden Sie in sich eine Tendenz, Verallgemeinerungen über »sie« anzustellen und Pauschalurteile über »sie« und »ihren Charakter« oder ihre Intelligenz oder gar über ihre Menschlichkeit zu fällen? Wenn wir anfangen, auf diese Weise auf das zu achten, was in unserem Kopf passiert – unsere Gedanken schlichtweg als Gedanken zu sehen, unsere Meinungen als bloße Meinungen, unsere Emotionen als Emotionen –, dann stellen wir vielleicht ganz schnell fest, dass dieses Generalisieren und Auf-einen-Haufen-Werfen uns sogar mit Menschen passiert, mit denen wir zusammenleben und die wir lieben. Das ist der Grund, warum die Familie gewöhnlich so ein wunderbares (und manchmal auch wahnsinnig machendes) Labor für die Erzeugung von größerem Gewahrsein, von mehr Mitgefühl und Weisheit ist und die Chance bietet, diese Tugenden im Alltagsleben tatsächlich umzusetzen und zu verkörpern. Denn wenn wir uns plötzlich in der Situation wiederfinden, in der wir eisern an der Überzeugung festhalten, dass wir Recht und die anderen Unrecht haben, dann kann das, selbst wenn es in großem Maße zutreffen sollte und sehr wichtige Dinge auf dem Spiel stehen (oder wir das zumindest meinen und auf Biegen und Brechen darauf beharren), unsere Wahrnehmung verzerren: Wir riskieren, der Verblendung anheimzufallen, und dem, was ist. Wir riskieren, der Eigentlichkeit der Dinge und der Beziehungen, in denen wir uns befinden, in einem gewissen Ausmaß Gewalt anzutun, jenseits aller »objektiven« Gültigkeit der einen oder der anderen Position. Wenn ich meinen eigenen Geist prüfe, dann muss ich zugeben, dass ich selbst jeden Tag zu all diesen Dingen neige und auf sie achtgeben muss, damit ich nicht in großem Stil verdumme. Und ich denke, dass ich in dieser Hinsicht nicht der Einzige bin.
Wenn nur ein klein wenig davon im Spiel ist – und das Gleiche läuft aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei denen ab, die gegenteiliger Meinung sind als Sie, wenn diese Menschen an Sie denken und »alle Gleichgesinnten« –, ist es in dieser Situation dann auch nur im entferntesten wahrscheinlich, dass irgendjemand begreift, was in Wirklichkeit vor sich geht? Begreift, dass es möglich wäre, zumindest ein paar Gemeinsamkeiten, identische Interessen, eine größere Wahrheit anzuerkennen? Oder hat die Art, wie wir sehen und denken, die Situation, das Thema oder die Tagesordnung dermaßen polarisiert und uns so blind gemacht, dass es nicht mehr möglich ist, die Dinge so zu sehen und zu erkennen, wie sie wirklich sind? Oder uns daran zu erinnern, dass wir es eigentlich nicht wissen und in diesem Nicht-Wissen eine riesige kreative und potenziell heilende Kraft liegt? Das ist nicht Ignoranz, und es ist auch nicht ignorant. Es ist mitfühlend. Es ist klug. Das Wissen, dass wir es nicht wissen, ist kraftvoller und heilsamer, als aus schierer Angst Mauern zu bauen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen oder Vorwände für einen Krieg zu suchen oder endlos neue Feindbilder zu schaffen.
Zu wissen, dass wir es nicht wissen (oder gewöhnlich nur teilweise wissen), kann zu enormen Lichtblicken im Herzen und im Geist führen und zu Potenzialen orthogonaler Art, die ansonsten nicht möglich wären. Erinnern Sie sich, was der koreanische Zen-Meister Soen Sa Nim (Bände 1 und 3) mit Leuten machte, die an irgendeiner Position festhielten. »Wenn Sie sagen, dies sei ein Stock oder eine Uhr oder ein Tisch, eine gute Situation oder eine schlechte Situation oder die Wahrheit, dann gebe ich Ihnen dreißig Schläge (metaphorisch natürlich – er hat nie jemanden geschlagen). Und wenn Sie sagen, dies sei kein Stock, keine Uhr, kein Tisch, keine gute Situation oder keine schlechte Situation oder die Wahrheit, dann gebe ich Ihnen dreißig Schläge. Was tun Sie?«
Bedenken Sie: Er erinnert uns eigentlich daran, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, diesem Freund-Feind-Denken, diesem ständigen »Ist es gut oder schlecht?« aufzuwachen. Es war ein Akt des Mitgefühls, uns in diese Zwickmühle zu bringen oder uns aufzuzeigen, dass wir das ja dauernd selber tun.
Ja, was tun? Was tun? Sollen wir die Dinge denn nicht beim Namen nennen? Was ist mit Völkermord, Mord, Ausbeutung, Wirtschaftskriminalität, politischer Korruption, institutionalisierten Strategien der Täuschung (im Internet und anderswo), strukturellem Rassismus und Ungerechtigkeit? Ja, natürlich können wir die Dinge beim Namen nennen, und manchmal haben wir sogar die moralische Pflicht, aufzustehen und sie zu benennen, wenn wir tatsächlich Bescheid wissen. Aber wenn Sie Bescheid wissen, wenn Sie die fragliche Sache wirklich klar sehen und nicht einfach an einem Vorurteil festhalten, dann werden Sie auch sofort sehen, dass es vielleicht nicht das Einzige oder Wichtigste ist, das Ding beim Namen zu nennen, besonders wenn das alles ist, was Sie tun. Es könnte etwas geben, das in dieser Situation angemessener ist, als nur einen Begriff oder ein Etikett hinzustellen, ganz gleich, wie wichtig es ist, aufzustehen und das, was geschieht, beim Namen zu nennen – und es ist extrem wichtig. Es kann auch zwingend notwendig sein, zu handeln, und zwar klug zu handeln, um einen konkreten, lebendigen Weg zu finden, auf dem man mit dem, was sich entwickelt, auf integere und würdevolle Weise eine Beziehung aufbauen kann. Etwas, was Sie vielleicht tatsächlich tun können, das über bloßes Benennen oder gar Beschimpfen hinausgeht oder darüber, lediglich mit Gleichgesinnten einer Meinung zu sein.
Wenn es im wörtlichen Sinne um »Dinge« ginge, die beim Namen zu nennen sind, wäre es wohl angemessen, sie in die Hand zu nehmen, etwas mit ihnen zu arbeiten und andere dazu zu bringen, mitzumachen. In jedem Moment so zu handeln, dass unsere Erkenntnis leibhaftig zum Ausdruck kommt, wäre das Beste, was wir in jedem Moment tun können, und auf diese Weise würden wir uns schrittweise in Richtung Weisheit bewegen, wenn wir bereit wären, aus den Konsequenzen unserer Handlungen zu lernen. Alles andere kann sehr schnell zu leerem Gerede werden. Der Politiker, der sich um ein Amt bewirbt, nennt die Dinge beim Namen und sagt, es müsse etwas geschehen. Doch wie kommt es, dass seine (oder ihre) Ansichten über diese »Dinge« sich so schnell und so radikal ändern, sobald er oder sie im Amt ist? Metaphorisch gesprochen, ist dieses jeweilige »Ding« oder Thema immer noch da. Oder war es im Moment der Wahlkampfrede nur deshalb ein Thema, weil es ihr gerade in den Kram passte und es ein nützliches Werkzeug zu einem ganz anderen Zweck war?
Bertrand Russell paraphrasierend könnte man sagen, dass die Menschen gelernt haben, durch die Luft zu fliegen und in die Tiefen des Meeres hinabzutauchen. Aber wir haben noch nicht gelernt, auf dem Festland zu leben. Die letzte Herausforderung für uns ist nicht der Ozean oder der Weltraum, so interessant und verlockend sie auch sein mögen. Die letzte, die wichtigste und dringlichste Herausforderung für uns sind der menschliche Geist und das menschliche Herz. Sie besteht darin, dass wir uns selbst erkennen, und zwar, am allerwichtigsten, von innen her! Die letzte Herausforderung ist eigentlich das Bewusstsein selbst. In ihr kommt alles zusammen, was wir wissen, alle Weisheitstraditionen aller Völker auf diesem Planeten, einschließlich all der verschiedenen Arten des Wissens – durch Wissenschaft, Kunst, alte Stammeskulturen, durch meditatives Erforschen, durch lebendig-konkrete Achtsamkeitpraktiken. Das ist die Herausforderung unserer Ära und unserer Spezies, heute, da wir weltweit auf so viele Arten miteinander vernetzt sind, dass das, was in Helsinki oder Moskau oder in Tweets aus dem Weißen Haus passiert, was in Brüssel oder Bagdad oder Kuala Lumpur passiert, oder in Mexiko-Stadt oder New York oder Washington oder Kabul oder Peking oder sonstwo, schon am nächsten Tag oder im nächsten Monat das Leben der Menschen praktisch überall und allerorten auf der Welt zutiefst beeinflussen kann. Und damit ist noch nichts über die massive Zersplitterungen gesagt, die ständig die Demokratie selbst bedrohen: die Ideale echter Inklusion und Gleichheit vor dem Gesetz, die dafür sorgen sollen, dass alle »Zellen« des politischen Gemeinwesens dieselbe »Blutversorgung« haben. Es ist das exakte Gegenteil davon, den Kopf in den Sand zu stecken und sich nur um die eigenen, eng definierten Interessen zu kümmern, die Maximierung der eigenen Sicherheit oder Zufriedenheit oder Vermögenslage. Vielmehr ist es so, dass dieses ganze Unternehmen namens Achtsamkeit und das Erforschen der Möglichkeiten, uns selbst und die Welt zu heilen, einen Weg bietet, uns sozusagen von Zeit zu Zeit in diesem »Wald« umzuschauen und seine Fülle direkt zu spüren, statt den »Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen« und sich in Einzelheiten von Bäumen und Ästen zu verlieren, so wichtig diese Einzelheiten auch sein mögen. Es erinnert uns daran, dass die verzerrende Optik engstirniger und unhinterfragter Gedanken und Meinungen – gewöhnlich getrieben von Angst, Gier, Hass und Verblendung in unterschiedlichem Ausmaß, und natürlich von einem endemischen Stammesdenken, dem jahrtausendealten Instinkt, die Welt in Freund und Feind zu unterteilen, heutzutage ausgebrütet und angeheizt von Privatsendern und sozialen Netzwerken, zu denen böswillige Aktivitäten im Internet gehören, oft Bots, sowie die übermächtige Tendenz auf allen Seiten, echte Beweise zu missachten – dass diese verzerrende Optik eine ungeheure Falle ist, die uns hindert, neue Lichtblicke und Chancen zu sehen.
Das soll nicht heißen, dass es keinen Platz gibt für Meinungen und leidenschaftlich vertretene Ansichten. Es ist nur so: Je mehr diese Ansichten die gegenseitige Durchdringung der Dinge auf der Mikro- und auf der Makro-Ebene berücksichtigen, desto größer wird auch unsere Fähigkeit, mit der Welt, mit unserer Arbeit, unserer Sehnsucht und unserer Berufung auf eine Art und Weise umzugehen, die zu mehr Weisheit und Harmonie beiträgt, nicht zu mehr Streit, Elend und Unsicherheit.
Heute haben wir, mehr als jemals zuvor, praktisch an allen Fronten sowohl individuell als auch kollektiv die unschätzbar wertvolle Gelegenheit wie auch die Werkzeuge, uns nicht in gedankenlosem Egoismus und destruktiven Gefühlen zu verrennen und uns von ihnen blenden zu lassen, sondern buchstäblich zur »Be-Sinnung« zu kommen. Wenn wir das tun, werden wir vielleicht aufwachen und das tiefe Unbehagen erkennen, das während der vergangenen zehntausend Jahre Menschheitsgeschichte zum chronischen (Krankheits-)Zustand der Welt und unserer Spezies geworden ist. Wir werden praktische Schritte unternehmen, um neue Wege des Gleichgewichts und der Harmonie in der Art und Weise, wie wir unser Leben als Individuen führen und die Beziehungen zwischen den Nationen gestalten, ins Auge zu fassen und aufzubauen: Wege, die dazu beitragen, unsere destruktiven Tendenzen und gelegentlich schiere Widerwärtigkeit (Geisteszustände, die nur Unwohlsein und Entfremdung im Inneren und im Äußeren stärken) zu erkennen und zu reduzieren, und die andererseits unsere Fähigkeit zur Mobilisierung und Verkörperung von Weisheit und Mitgefühl in den Entscheidungen, die wir von Moment zu Moment darüber treffen, wie wir leben müssen und was wir mit unseren kreativen Energien zur Heilung des politischen Gemeinwesens tun könnten, vergrößern.
*
Wir haben in diesen vier Bänden die Metaphern von Krankheit und »Un-Wohlsein« erforscht, in dem Versuch, die tiefere Natur unserer Beunruhigung über dieses Menschendasein aus verschiedenen Blickwinkeln zu definieren und zu verstehen und warum wir uns so oft dermaßen »daneben« fühlen, so voller Verlangen nach etwas, das uns zu unserer Ganzheit und Erfüllung zu fehlen scheint, obwohl es uns in den entwickelten Ländern (und was das angeht, auch in denen, die einmal »Entwicklungsländer« genannt wurden) doch materiell und in Bezug auf Bildung und viele andere Faktoren wesentlich besser geht, als es der überwiegenden Mehrheit der Menschheit in den Generationen vor uns jemals gegangen ist.17 Wenn ein relativ hoher Lebensstandard, materieller Reichtum und Überfluss und selbst bessere Gesundheit und Gesundheitsfürsorge als je zuvor in der Geschichte uns nicht genügen, um glücklich, zufrieden und innerlich mit uns im Reinen zu sein, was könnte es dann sein, was uns noch fehlt? Und was müssten wir tun, damit wir schätzen lernen, wer wir sind und was wir bereits haben? Und was sagt unsere Unzufriedenheit über uns selbst als Land, als Welt, als Spezies aus, das zu wissen uns helfen könnte? Wie könnten wir aufhören, uns selber fremd zu sein, und heimkommen in das, was wir in all unserer Fülle eigentlich sind? Wie könnten wir unsere wahre Natur und unser wahres Potenzial als menschliche Wesen erkennen und lebendig verkörpern?
Wir könnten für einen Moment nach innen schauen und uns fragen, was nötig wäre, damit wir uns als Individuen innerhalb des politischen Gemeinwesens genau jetzt vollständig ganz und glücklich fühlen könnten, wo wir doch, wie wir durch die Schulung in Achtsamkeit immer wieder gesehen haben, genau in diesem Moment schon unleugbar ganz und vollständig sind? Eines, das nötig sein könnte, ist, herauszutreten aus diesem Leben, das wir die meiste Zeit im Kopf führen, wo wir in Gedanken und Wünschen und die Turbulenzen reaktiver Gefühle und Abhängigkeiten verstrickt sind, sei es nun Abhängigkeit vom Essen (die Fettleibigkeits-Epidemie) oder von Schmerzbetäubung (die Opioid-Epidemie) oder von irgendetwas anderem. Letzten Endes scheinen wir gefangen in unseren endlosen und oft verzweifelten Versuchen, die äußeren Umstände, Ursachen und Bedingungen so zu arrangieren, dass sie, wie wir immer hoffen, schließlich zu einer besseren Situation führen werden, in der wir, wie wir glauben, endlich allen Schmerz werden auslöschen und glücklich und in Frieden werden leben können.
Hinter all dem erkennen wir vielleicht unsere gewohnheitsmäßige, verführerische, aber letztlich deplatzierte Besessenheit von der bemerkenswert dauerhaften Idee eines seltsam ungreifbaren, festen, beständigen, unveränderlichen persönlichen Ichs. Dieses nebulose Gefühl eines festgefügten Ichs wird, wenn es mit der Lupe der Achtsamkeit untersucht wird, leicht als ziemlich illusionär erkannt. Im tiefsten Herzen wissen wir das alle, glaube ich. Und doch scheint uns diese fixe Idee eines beständigen, festen Ichs (und die daraus resultierende Ichbezogenheit) ständig in Bann zu schlagen und auf der Suche nach Erfüllung seiner anscheinend endlosen Bedürfnisse und Wünsche zu allen möglich Dingen zu treiben. Wenn wir, und sei es nur für einen Augenblick, zum Mysterium unseres Da-Seins erwachen, dann zeigt sich, dass dieses Ich-Konstrukt so sehr viel kleiner ist als das volle Ausmaß unseres Seins. Und das ist für unser Land und für die Welt genauso wahr wie für uns als Individuen.
Am Ende entspringen diese Einsichten (und die Lichtblicke, die sie begleiten können) aus der Kultivierung einer größeren Nähe und Vertrautheit mit Geist und Körper, Moment für Moment; aus dem Erkennen der wechselseitigen Verbundenheit der Dinge jenseits unseres Eindrucks, sie seien isoliert und unverbunden, und jenseits unserer Verblendung erzeugenden Fixierung auf die Vorstellung, sie zum eigenen engstirnigen Vorteil unter Kontrolle halten zu können.
Unsere Ganzheit und wechselseitige Verbundenheit lässt sich in der Tat hier und jetzt, in ein und jedem Moment, dadurch verifizieren, dass wir aufwachen und erkennen: Wir und die Welt, die wir bewohnen, sind im tiefsten vorstellbaren Sinne nicht getrennt. Wie wir gesehen haben, gibt es viele Wege, diese Wachheit durch die systematische Übung der Achtsamkeit zu kultivieren und zu fördern. Alle eignen sich gut, uns zu einem umfassenderen Bewusstsein zu führen, was – in jedem Sinne dieses Begriffs – »Gesundheit des politischen Gemeinwesens« heißt, und dafür Verantwortung zu übernehmen.
*
Durch die Praxis der Achtsamkeit, in der wir üben, tief in uns selbst hineinzuschauen, haben wir eine größere Vertrautheit und Intimität mit dem entwickelt, was möglicherweise letzten Endes die Wurzel unseres Unbehagens und Leidens ist: die Dynamik der Geisteszustände von Gier, Hass und Ignoranz und wie sie sich auf unterschiedlichste Weise in der Welt manifestieren. Vielleicht sind wir auch so weit gelangt, dass wir ansatzweise sehen und spüren, wie jede(r) Einzelne auf eigene Weise wirksam dazu beitragen könnte, Leid zu verringern, Leid zu mildern, Leid zu transzendieren – das eigene und das von anderen – und dazu, die menschengemachten Leidens-Ursachen, wo immer möglich, innerlich und äußerlich mit der Wurzel auszureißen.
Vielleicht ist uns inzwischen auch aufgegangen, dass wir kein vollkommen gesundes und friedliches Privatleben führen können, wenn wir in einer Welt leben, die selber krank und so unfriedlich ist; in der die Menschen einander und der Erde direkt und indirekt so viel Leid zufügen, vor allem aus Mangel an Verständnis für unsere wechselseitige Verbundenheit und oft, wie es scheint, aus Gleichgültigkeit, auch wenn wir es »eigentlich besser wissen«. Dies ist natürlich eine zutiefst menschliche Verhaltensweise, aber auch damit können wir arbeiten, wenn wir bereit sind, als Individuen und als Gesellschaft eine bestimmte Art von innerer Arbeit zu leisten. Selbst epidemische Engstirnigkeit ist veränderbar, wenn es uns zu erkennen gelingt, welchen potenziellen Wert es hat, anders leben und handeln zu lernen: mit größerem Bewusstsein für die wechselseitige Abhängigkeit und das Ineinander-Eingebettet-Sein von »Ich« und »den anderen«; für die wahren Bedürfnisse und die wahre Natur dieses »Ich« und dieser »anderen«; mit anderen Worten: wenn wir lernen können, die verzerrende Optik der eigenen Gier, der Angst, des Hasses und der Unbewusstheit schon zu erkennen, wenn sie ins Spiel kommt, und wir nicht zulassen, dass sie die tieferen und gesünderen Elemente unseres Wesens überschatten. All das kann sich ergeben, wenn wir bereit sind, unseren Schmerz und unser Leid als Individuen, als Nation und als Spezies mit Bewusstheit, Mitgefühl und einem gewissen Grad an Gelassenheit anzuschauen und auszuhalten; bereit, sie sprechen und neue Dimensionen wechselseitiger Verbundenheit offenbaren zu lassen, die unsere Einsicht in die Wurzeln des Leidens vertiefen und uns dazu drängen, unsere Empathie nicht zu beschränken auf die, die uns am nächsten stehen, sondern weiter auszudehnen. Das bedeutet, dass letztlich die Grundbedürfnisse der Menschen überall auf der Welt erfüllt sein müssen und sie frei sein müssen von Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Entwürdigung durch andere. Mit anderen Worten: Es bedeutet, dass die grundlegenden Menschenrechte aller Menschen überall gewahrt sein müssen. Wie wir wissen, ist das heute für den größten Teil der Menschheit auf diesem Planeten traurigerweise nicht der Fall, weder in meinem Heimatland noch weltweit.
Nicht gänzlich abwegig als Beschreibung für die Wirkung unserer Spezies auf den Planeten Erde, aber auch auf unsere eigene Gesundheit und unser Wohlergehen als Spezies ist die Metapher der »Auto-Immunkrankheit«. Man könnte auch sagen, dass wir Menschen uns ständig selber im Weg stehen. Wir stolpern andauernd über Hindernisse, die wir uns trotz aller Klugheit unwissentlich selber in den Weg gelegt haben. In allen vier Bänden dieser Reihe weise ich darauf hin, dass das, was wir in der Medizin in den letzten vierzig Jahren über das Verhältnis von Geist und Körper und die potenzielle Heilkraft von Achtsamkeit/Herzerfülltheit gelernt haben, tiefgreifende Konsequenzen haben kann für die Art und Weise, wie wir das überwältigende »Un-Wohlsein«, unter dem der größere Körper unseres Landes und der größere Körper dieser einen Welt leiden, begreifen und behandeln können. Die Symptome dieses Un-Wohlseins springen uns aus Zeitungen, Fernsehnachrichten, Talkshows und sozialen Netzwerken Tag für Tag auf eine Weise an, die fassungslos macht, unsere Vorstellungskraft übersteigt und uns manchmal an unserem Verstand zweifeln lässt.
Wie schon bei den anderen Aspekten dieser Erkundung – Achtsamkeit als Meditationsübung und als Seinsweise – untersuchen wir das Thema des politischen Gemeinwesens und seinen Bezug zur Achtsamkeit nicht mit dem Ziel, Meinungen zu ändern oder zu bekräftigen, weder die eigene noch die von anderen. Im Leben eine größere Achtsamkeit zu kultivieren bedeutet nicht, dass wir uns der einen oder anderen Ideologie oder Meinung verschreiben, so verlockend das bisweilen sein mag. Es bedeutet vielmehr, dass wir die Gelegenheit haben, die Dinge auf neue Art und Weise zu sehen, mit frischem Blick, Moment für Moment, mit den Augen der Ganzheit. Was Achtsamkeit für uns tun kann: unsere Meinungen, alle Meinungen als das zu enthüllen, was sie sind, nämlich Meinungen. Mit dieser Art von Erkenntnis werden wir sie als das sehen, was sie sind, sodass wir uns vielleicht nicht so sehr in sie verstricken und von ihnen blenden lassen, was immer ihr Inhalt sein mag, auch wenn wir uns manchmal ganz bewusst bestimmte Standpunkte zu eigen machen, sie mit kraftvoller Überzeugung vertreten und ihnen gemäß handeln. Achtsamkeit lädt in dieser Hinsicht dazu ein, in den Spiegel des eigenen Geistes zu schauen, die eigenen Fixierungen zu begreifen und bis dato unerkannte Möglichkeiten der Untersuchung und Heilung zu erkunden und vielleicht auch der Erweiterung unseres Horizonts, statt bei gewissen Themen lediglich reflexhaft und parteiisch in Zustimmung oder Ablehnung zu verfallen. Diese Haltung gegenüber dem Erleben der Realität, so wie sie ist, ist also auch eine Einladung, sozusagen »das Objektiv zu wechseln«, mit einer Rotation im Bewusstsein zu experimentieren, die vielleicht so groß ist wie die Welt, oder – oftmals zur selben Zeit – so nah wie dieser Moment und dieser Atemzug, in diesem Körper, in diesem Geist und in diesem Herzen, die Sie und ich und wir alle in die Landschaft des Jetzt einbringen (siehe Buch 2, Teil 1). Dies ist die Essenz und das Geschenk der formellen Meditationsübung und der Seinsweise, der Lebensweise, namens »Achtsamkeit«.
Das Ziel hier ist auch, daran zu erinnern, dass Bewusstheit nichts Passives ist. In jedem Moment beeinflusst unser Bewusstseinszustand und alles, was ihm entspringt, die Welt. Wenn unser Tun aus dem Sein, aus dem Gewahr-Sein hervorgeht, ist es wahrscheinlich ein klügeres, freieres, kreativeres, fürsorglicheres Tun; ein Tun, das per se größere Weisheit, größeres Mitgefühl und mehr Heilung in der Welt und in Ihrem Herzen in Bewegung setzen kann. Das gezielte Engagement für Achtsamkeit in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und im politischen Gemeinwesen, und sei es in der denkbar kleinsten Form, hat das Potenzial – da wir alle Zellen des einen Körpers dieser Welt sind – zu einem echten Aufblühen, zu einer echten Renaissance menschlicher Kreativität und menschlichen Potenzials zu führen, zur Manifestation einer tiefen Gesundheit als Spezies und als Welt. In vielen Bereichen passiert es bereits, in ganz kleinen Ansätzen (die irgendwie doch nicht so klein sind). Die Renaissance ist schon da.
Wenn ich sage, dass es für die Welt von Nutzen sein kann, wenn wir alle mehr Verantwortung für ihr Wohlbefinden übernehmen und mehr Bewusstheit in das politische Gemeinwesen einbringen, dann soll das kein Rezept zu einer ganz bestimmten Therapie sein, mit der wir ein bestimmtes Problem in Ordnung bringen können, und es soll auch nicht die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, im Detail beschreiben und bestimmten Parteien, Individuen, Traditionen oder Denkweisen eine Schuld zuschreiben (so sehr der reflexhafte Impuls dazu in bestimmten Momenten aufkommen mag). Mein Bild der Situation soll vielmehr ein impressionistisches sein, so wie ein impressionistisches Gemälde sich in seiner ganzen Fülle und Tiefe erst dann offenbart, wenn man ein paar Schritte zurücktritt, es in seiner Ganzheit auffasst und sich nicht zu sehr mit den einzelnen Farbtupfern beschäftigt. Es soll auch auf liebevolle Weise provokativ sein, eine Einladung an uns alle, noch einmal mit frischem Blick hinzusehen und unsere liebgewonnenen Vermutungen, Fixierungen, Ängste, vielleicht auch ungeprüften Standpunkte und Sichtweisen auf den Prüfstand zu stellen, ein Aufruf an uns alle, auf neue Weise aufmerksam zu sein. Es ist auch ein Aufruf, sorgfältiger die Art und Weise zu untersuchen, wie wir etwas wahrnehmen und erkennen (oder denken, dass wir es wahrnehmen und erkennen). Es ist die Einladung zu einer achtsamen Prüfung, wie überhaupt der Prozess vonstatten geht, durch den wir uns Meinungen bilden, und genau diese Meinungen dann eng mit unserer Identität (dem, was wir zu sein glauben und womit wir uns identifizieren) verknüpfen.
Es ist auch eine Einladung, sich allmählich neue Metaphern auszudenken, um uns selbst und unseren Platz in der Welt zu begreifen und die wahre Komplexität der realen Welt zu würdigen, ohne die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass der menschliche Geist in großem Maße viele der Probleme, denen wir uns heute als Land und als Spezies gegenübersehen, erzeugt oder, wie man sagen könnte, fabriziert und wuchern lassen hat; und dass diese Probleme, wie alles andere auch, nicht so dauerhaft, beständig oder real sind, wie unser Geist es sich ausmalt. Schon allein diese Einsicht kann uns neue und einfallsreiche Wege zum Umgang mit dem bescheren, was oft nach unlösbaren Problemen und unbesiegbaren Feinden aussieht. Es könnte sinnvoll sein, sich hier an zwei berühmte Kommentare von Albert Einstein zu erinnern. Der erste besagt: »Die Realität ist bloß eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige.« Und der zweite: »Die Probleme, die es heute auf der Welt gibt, lassen sich nicht mit der Denkweise lösen, die sie erzeugt hat.« Es lohnt sich, diese beiden Beobachtungen im Gedächtnis zu behalten, während wir im vollen Bewusstsein der Totalkatastrophe, die die Situation des Menschen darstellt, Achtsamkeit kultivieren.
Wir könnten sagen, dass der menschliche Geist die Vorstellung einer »realen Welt« (und der Einschränkungen, die wir uns selbst auferlegen, wenn wir an diese Welt und was darin möglich ist, denken) genauso fabriziert hat, wie er die verdinglichte Vorstellung eines dauerhaften Ich konstruiert. Wenn wir untersuchen und uns klar bewusst werden, wie der Geist sowohl uns selbst als auch das, was wir die Welt nennen, wahrnimmt, auffasst und begreift, dann können viele der illusorischen und selbst auferlegten Einschränkungen sich auflösen, während wir neue Wege des Handelns finden, die auf dieser Rotation des Bewusstseins beruhen.
Die Einzelheiten werden sich aus unserer fortdauernden Praxis ergeben, während wir Tag für Tag unser Leben führen. Eine reine Macher-Mentalität, die lediglich die Dinge in Ordnung bringen und wieder zurechtrücken will, indem sie der Welt eine ganz bestimmte »Lösung« oder Reform, von der wir überzeugt sind, vorschreibt, ist per se wahrscheinlich wenig hilfreich, so wichtig solche Bemühungen auch sein mögen. Eine umfassendere Heilung unserer ganzen Art und Weise des Sehens und Seins ist ebenfalls nötig. Dies verlangt eine Wendung im Bewusstsein sehr vieler Menschen – eigentlich von uns allen – auf breiter Basis und eine Bereitschaft, die Dinge anzuerkennen, wie sie sind, und auf kreative und orthogonale Weise mit ihnen zu arbeiten, wobei wir all die unerschöpflichen Ressourcen und Kenntnisse nutzen, die uns innerlich und äußerlich heute zur Verfügung stehen. Statt auf einen einzigartigen »Erlöser« in Form eines charismatischen Führers zu hoffen, der es für uns richten und der uns »den Weg weisen« wird, sollten wir einsehen, dass unsere Spezies vielleicht einen Punkt in der Evolution erreicht hat, an dem wir Menschen das historische Muster heroischer, faszinierender Persönlichkeiten (ganz gleich, wie herausragend sie im Guten oder Schlechten sein mögen) hinter uns lassen und Wege werden finden müssen, um Verantwortung und Führungsfunktionen breiter und kooperativer zu streuen: so, wie ja auch Herz und Leber und Gehirn nicht miteinander um die Vorherrschaft über den Organismus streiten, sondern für das nahtlose Wohlergehen des Ganzen zusammenarbeiten, und so, wie es die Billionen einzelner Zellen tun, die zusammen einen gesunden menschlichen Körper ausmachen.
Konfrontiert mit der Grund-Diagnose namens Dukkha (siehe Band 1) mit ihren verschiedenen Bedeutungen und Konnotationen – wir könnten alternativ auch »Welt-Stress« sagen – und mit dem Verständnis einiger Grundursachen für Dukkha können wir hier, wenn es überhaupt ein Rezept gibt, zur Behandlung unserer gegenwärtigen Situation als Spezies nur mit einem ganz allgemeinen Rezept aufwarten: dass, so seltsam das klingen mag, sich jede(r), der/die sich betroffen fühlt von dem Dilemma, mit dem wir uns als Spezies und als Gesellschaft konfrontiert sehen, um die Kultivierung von größerer Achtsamkeit bemüht, als Übung und als Lebensweise; dass wir Achtsamkeit sanft und elegant in jeden Aspekt unseres Lebens und unserer Arbeit einbringen, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, was dabei herauskommt, wer auch immer wir sind, was auch immer unsere Arbeit und unsere Berufung sein mag; und dass wir, diese Achtsamkeit so gut wie möglich praktizieren und leibhaftig verkörpern, individuell und kollektiv, als hinge unser eigenes Leben und das der Welt davon ab.
Denn wie wir von Moment zu Moment entscheiden, wie wir leben und handeln wollen, das beeinflusst die Welt ein klein wenig, kann aber trotzdem in ungleich größerem Maße von Nutzen sein, wenn die Motivation, der unsere Entscheidungen entspringen, gesund und ethisch positiv ist und die Handlungen selbst klug und mitfühlend sind. Auf diese Weise kann sich die Heilung des politischen Gemeinwesens ohne strenge Kontrolle oder Anleitung entwickeln: durch das selbstständige und gleichzeitig interdependente Tätigwerden und die Bemühungen vieler verschiedener Menschen und Institutionen, mit vielen verschiedenen und reichhaltigen Perspektiven, Zielen und Interessen, aber auch mit einem gemeinsamen und potenziell verbindenden Interesse, nämlich dass es der Welt besser gehen soll. Das ist es, was Politik im besten Falle fördert und bewahrt.
Natürlich wird nicht jede(r) mit der Praxis der Achtsamkeit beginnen, weder kurzfristig noch langfristig. Aber Stück für Stück wächst, wie es nun schon seit Jahren geschieht, die Zahl und der potenzielle Einfluss derer, die auf vielen verschlungenen, überraschenden – und bis dato oft schlichtweg unvorstellbaren – Pfaden dazu gelangen, diesen Weg zu größerer geistiger Gesundheit und Weisheit zu wählen. In den kommenden Generationen, oder sagen wir in den kommenden Jahrhunderten (und auch gerade jetzt im Moment …) haben wir die bemerkenswerte Gelegenheit, als einzelne Menschen, als Nation und als Spezies das volle Potenzial unserer Kreativität und Klarsicht zu verwirklichen und diese in den Dienst der Ganzheit, der Heilung und der Inklusivität zu stellen. Wir können sie in den Dienst derjenigen stellen, von denen wir alle behaupten, dass wir sie uns am meisten wünschen und dass sie uns die größte Chance geben würden, uns sicher und glücklich zu fühlen: Gerechtigkeit, Mitgefühl, Fairness, Freiheit von Unterdrückung, die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten für alle, ein gutes, erfülltes Leben zu führen, und damit also Frieden, guter Wille und Liebe – nicht nur für uns selbst oder für die, mit denen wir uns identifizieren, sondern für alle menschlichen Wesen, ja für alle fühlenden Wesen, mit denen wir auf so vielfältige, Leben spendende und Leben bewahrende Weise unauflöslich verbunden sind.
Wir stehen sozusagen auf einem Gipfelpunkt in der Entfaltung der Geschichte, an einem bedeutsamen Wendepunkt. Sei es nun revolutionär oder evolutionär oder beides: Die Zeit, in der wir leben, bietet einzigartige Gelegenheiten, die wir mit jedem Atemzug ergreifen und nutzen können. Es gibt nur einen Weg, das zu tun: dass wir in unserem Leben, wie es sich hier und jetzt entfaltet, unsere tiefsten Werte und unsere Einsicht, was das Allerwichtigste ist, lebendig verkörpern – und das mit anderen teilen in dem Vertrauen, dass solch lebendiges Handeln, selbst in den kleinsten Kleinigkeiten, die Welt mit der Zeit zu größerer Weisheit und Gesundheit und Vernunft hinlenken wird.
Das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber, wie gesagt – und das gilt für jede(n): Was sonst könnten wir mit diesem einen, wilden und kostbaren Leben Sinnvolles anfangen?
16 Siehe Band 3, Teil 1.
17 Vgl. Rosling, Hans, Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Berlin: Ullstein Verlag, 2018 (orig. ders., Factfulness: Ten Reasons Were Wrong About the World – And Why Things Are Better Than You Think. London: Hodder & Stoughton General Division, 2019); Pinker, Steven, Aufklärung jetzt. Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung. Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag, 2018 (orig. ders., Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. New York, NY: Random House, 2018).