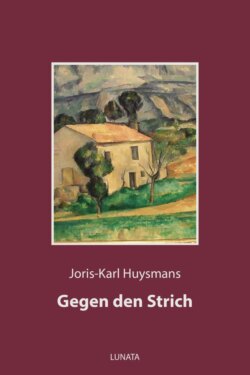Читать книгу Gegen den Strich - Joris-Karl Huysmans - Страница 9
Zweites Kapitel
ОглавлениеNach dem Verkauf seiner Güter nahm Herzog Jean die alten verheirateten Dienstleute zu sich, welche seine Mutter gepflegt und die zu gleicher Zeit dem Amte als Verwalter und Kastellane in Schloss Lourps vorgestanden hatten, das bis zur Feststellung des gerichtlichen Verkaufs unbewohnt und leer geblieben war.
Er ließ das Ehepaar nach Fontenay kommen. Sie waren an die Tätigkeit der Krankenwärter, an die Regelmäßigkeit, mit der von Stunde zu Stunde die Arzneien verabreicht wurden, wie an das starre Schweigen des Klosterlebens gewöhnt. Ohne mit der Außenwelt im Geringsten zu verkehren, verblieben sie stets in geschlossenen Zimmern hinter verschlossenen Fenstern.
Dem Mann wurde die Reinigung der Zimmer und das Einholen übertragen, die Frau mit dem Kochen beauftragt. Er überließ ihnen den ersten Stock des Hauses, doch mussten sie dicke Filzschuhe tragen. Er ließ Windfänge vor den gut geölten Türen anbringen und ihre Fußböden mit dicken Teppichen belegen, so dass er ihre Schritte über seinem Kopfe nicht hörte.
Er verabredete ebenfalls mit ihnen eine gewisse Art zu klingeln und bestimmte die Bedeutung der einzelnen Klingelzeichen nach ihrer Kürze und Länge; bezeichnete auf seinem Schreibtisch den Platz, wo sie jeden Monat das Rechnungsbuch hinlegen mussten – kurz er richtete sich so ein, dass er nicht oft genötigt war, sie zu sehen.
Ebenso wenig wollte er, da die alte Dienerin manches Mal am Hause vorüber gehen musste, um aus einem kleinen Schuppen Holz zu holen, dass ihn ihr Schatten störe, welcher dann durch die Scheiben seiner Fenster fiel. Er liess ihr daher ein besonderes Kostüm aus flandrischer Seide mit weisser Mütze und niedergeschlagener breiter schwarzer Kapuze anfertigen, in der Art, wie sie die Frauen des Beguinenklosters in Gent tragen.
Wenn der Schatten dieser Kopfbedeckung in der Dämmerung an seinen Fenstern vorüberglitt, so gab er ihm das Gefühl, dass er sich in einem Kloster befinde. Es erinnerte ihn an die stillen frommen Dörfer, die toten und versteckten Stadtviertel einer tätigen und lebhaften Stadt.
Er regelte und stellte auch die Stunden der Mahlzeiten fest, die übrigens wenig gewählt, vielmehr überaus einfach waren, denn die Schwäche seines Magens erlaubte ihm nicht, verschiedene oder schwere Gerichte zu genießen.
Um fünf Uhr im Winter, beim Herannahen der Dunkelheit, nahm er ein leichtes Frühstück ein, welches aus zwei Eiern, kaltem Fleisch und Tee bestand. Um elf Uhr hielt er seine Hauptmahlzeit; manchmal trank er etwas Kaffee, Tee oder Wein während der Nacht, und gegen fünf Uhr morgens naschte er wohl noch ein paar leichte Sachen, worauf er sich schlafen legte.
Er nahm diese Mahlzeiten, deren Anordnung und Reihenfolge ein für alle Mal zu Anfang jeder Jahreszeit festgesetzt wurde, an einem Tisch in der Mitte eines kleinen Zimmers ein, welches von seinem Arbeitszimmer durch einen ganz mit dickem Stoff ausgeschlagenen Korridor getrennt und ganz hermetisch verschlossen war, so dass weder Geruch noch Lärm in die beiden andern Gemächer dringen konnte.
Dieses Esszimmer glich einer Schiffskajüte mit gewölbtem Plafond, im Halbkreis mit Balken, Wänden und Fußböden aus hellem Fichtenholz versehen, mit dem kleinen, runden, ins Holz eingelassenen Fenster, das der Luftöffnung an den Seiten eines Schiffes nicht unähnlich war.
Gleich japanischen Schachteln, von denen die eine immer in die andere hineinpasst, war dieser Raum vom Architekten in einen größeren eingeschaltet, der als eigentlicher Esssaal erbaut war.
Dieser hatte zwei Fenster, eines unsichtbar durch eine leichte Bretterwand den Blicken entzogen, das aber durch eine Feder nach Wunsch niedergelassen werden konnte, damit frische Luft durch die Öffnung eindringe, um die Fichtenholzkajüte zirkuliere und sich hier verbreite. Das andere sichtbare Fenster befand sich grade gegenüber dem runden Kajütenfensterchen in der Holzbekleidung, jedoch zugesetzt durch ein grosses Aquarium, welches den ganzen Raum zwischen dem kleinen runden und dem wirklichen Fenster in der Mauer ausfüllte. Das Tageslicht drang also durch das große Fenster, durch das Wasser und schließlich durch das runde Fenster in die Kajüte.
Wenn dann der Samowar auf dem Tische dampfte und die Sonne im Herbste unterging, so rötete sich das Wasser im Aquarium trübe und gläsern und warf einen leichtfeurigen Schimmer auf das helle Getäfel.
Nachmittags manchmal, wenn der Herzog Jean zufällig wach war und aufstand, setzte er den Betrieb der Wasserröhren welche das Aquarium leerten, in Bewegung, und ließ es sich wieder von neuem mit frischem Wasser füllen. Indem er dann einige Tropfen farbiger Essenz hineintat, erzeugte er grünliche und gelbliche, milchweiße oder silberne Färbungen, wie die natürlichen Gewässer je nach der Farbe des Himmels, der mehr oder minder starken Glut der Sonne, oder des nahenden Regens erscheinen, mit einem Wort: wie es die Jahreszeit der Atmosphäre verursacht.
Er bildete sich dann ein, in dem Zwischendeck einer Brigg zu sein; und neugierig betrachtete er wunderbar gearbeitete Fische, die, aufgezogen durch ein Uhrwerk, vor der Scheibe des runden Kajütenfensters vorbeischwammen und in dem künstlichen Gras hängen blieben. Oder er betrachtete, während er den Teergeruch einsog, mit dem man den Raum besprengt hatte, bevor er ihn betrat, die an den Wänden aufgehängten farbigen Stiche, welche – wie in den Agenturen der Schifffahrtsgesellschaften – Dampfschiffe auf dem Weg nach Valparaiso oder La Plata vorstellten. Oder er besah die eingerahmten Tabellen, auf welchen die Reiseroute der Linie der Postdampfer der Compagnien Lopez und Valéry, die Frachtgelder, die Häfen des Postdienstes im Atlantischen Meer verzeichnet waren.
Dann, wenn er müde war diese Fahrpläne zu Rate zu ziehen, ließ er seine Blicke über die Chronometer und Kompasse schweifen, über die Winkelmesser und Zirkel, die Fernrohre und Karten, die zerstreut auf dem Tisch lagen, auf dem sonst nur ein einziges Buch aufgestellt war, gebunden in Seehundsleder: Arthur Gordon Pyms Abenteuer, welches besonders für ihn auf streifiges Papier reinster Faser gedruckt war, jedes Blatt sorgfältig ausgesucht und mit einer Schwalbe im Wasserzeichen.
Da waren außerdem Fischereigeräte, durch Lehm gezogene Netze, aufgerollte braune Segel, ein kleiner schwarz gestrichener Anker aus Kork, zu einem Haufen nahe der Tür vereinigt, welche durch einen kleinen ausgepolsterten Flur in die Küche führte, und der ebenso wie der Korridor den Esssaal mit dem Arbeitszimmer verband, um die Gerüche und den Lärm aufzusaugen.
Auf diese Art verschaffte er sich ohne große Mühe sofort die augenscheinlichsten Eindrücke einer Seereise. Besteht doch das Vergnügen der Abwechslung im Grunde genommen einzig in der Erinnerung und fast niemals in der Gegenwart, in dem Augenblicke selbst. Er kostete sonach diese Abwechslung in vollen Zügen, mit aller Bequemlichkeit, ohne jede Anstrengung und ohne die sonst unvermeidlichen Verdrießlichkeiten in dieser erdachten Kajüte.
Bewegung schien ihm zudem überflüssig, da ihm die Einbildung leicht die gewohnte Wirklichkeit des Lebens zu ersetzen vermochte.
Nach seiner Ansicht war es nämlich möglich, sich die Wünsche, die für die schwierigsten gelten, im normalen Leben künstlich selbst zu befriedigen und dies mittels Täuschung durch eine genaue Fälschung der erwünschten Gegenstände zu tun. Ist es doch klar, dass jeder Feinschmecker heutigen Tages entzückt ist, wenn er in einem wegen der Vortrefflichkeit seines Kellers berühmten Restaurant die teuren Weine schlürft, welche nach Pasteurs Methode aus leichten billigen Weinen hergestellt sind. Falsch oder echt, diese Weine haben ganz dasselbe Aroma, dieselbe Farbe, dieselbe Blume, und verursachen also auch dasselbe Vergnügen, das man beim Kosten und Genießen echter und reiner Weine empfindet, die infolge starker Nachfrage schließlich für Gold kaum aufzutreiben sein möchten.
Es unterliegt nach alledem keinem Zweifel, dass sich diese berauschende Abweichung, diese geschickte Lüge und Täuschung des Geistes in die Welt des realen Verstandes übertragen lassen, und dass man mithin ebenso leicht wie in der materiellen Welt eingebildete Wonnen genießen kann, die fast in allen Punkten den wirklichen gleichen. Kein Zweifel zum Beispiel, dass man im Notfall dem störrisch langsamen Geiste nachhelfen, beim Lesen einer fesselnd geschriebenen Reisebeschreibung ruhig am Kamin verweilen und sich erfolgreich angenehmen Forschungen hingeben kann. Wie man sich auch – ohne Paris zu verlassen – das wohltuende Gefühl eines Seebades suggerieren kann, da es ja genügt, sich nach Vigier zu begeben, dessen Bäder mitten in der Seine liegen.
Wenn man dort das Wasser der Wanne salzen lässt und nach der Vorschrift des Arzneibuches schwefelsaures Sodasalz und Magnesia hinzufügt und ein kleines Ende Kabeltau aus einer Seilerei mitnimmt und dann den Duft, welchen dieses Tau noch bewahrt hat, einsaugt und dabei eifrig Joanne’s Handbuch liest, welches die Schönheiten des Strandes, an dem man sein möchte, beschreibt; und wenn man sich dann schließlich noch leise von den Wellen schaukeln lässt, welche die Dampfschiffe, die an der schwimmenden Badeanstalt vorbeifahren, in der Badezelle aufwerfen, wenn man das Ächzen des Windes hört, der sich unter den Brücken fängt, und dem dumpfen Lärm der Omnibusse lauscht, die wenige Schritte weiter über Pont-Royal hinwegrollen – ist da nicht die Illusion des Meeres unleugbar da?
Es handelt sich eben nur darum, seinen Geist auf einen bestimmten Punkt zu richten.
Da ist nicht eine ihrer Erfindungen, möge sie für noch so feinsinnig oder noch so großartig gelten, die das Genie des Menschen nicht zu schaffen imstande wäre! Da ist kein Wald von Fontainebleau, kein Mondschein, welchen nicht eine von elektrischem Licht überflutete Dekoration hervorzuzaubern vermöchte; kein Wasserfall, welchen die Wasserleitungskunst nicht täuschend nachahmen könnte, kein Felsen, der nicht durch Papiermaché herzustellen wäre, keine Blume, die nicht durch besonderen Tafft und zart bemaltes Papier genau so wiedergegeben werden könnte!
Unzweifelhaft hat diese uralte Schwätzerin Natur die gutmütige Bewunderung der wirklichen Künstler erschöpft, und der Augenblick ist gekommen, sie verbessert zu ersetzen, so weit es sich eben durch die Kunst ermöglichen lässt.
Und dann, um ehrlich zu sein: dasjenige ihrer Werke, welches fraglos als das künstlichste gilt, diejenige ihrer Schöpfungen, deren Schönheit nach Aller Ansicht die ursprünglichste und vollkommenste ist, das Weib! Hat der Mensch nicht seinerseits ein ebenso künstliches Wesen voll von Leben geschaffen, welches vom Gesichtspunkt der plastischen Schönheit aus ihr vollkommen gleichwertig ist? Gibt es wohl hienieden ein Wesen, das, in Freuden der Brunst empfangen und mit Schmerzen aus der Mutterschaft hervorgegangen, an Form und Race strahlender und prächtiger sei, als dasjenige der beiden Lokomotiven, die auf der Nordbahn ihren Dienst verrichten?
Die eine, die Crampton, eine entzückende Blondine, mit scharfer Stimme, von hohem, schlankem Wuchs, eingeschnürt in ein glänzendes Kupferkorsett, geschmeidig – nervös wie eine Katze – eine schmucke goldige Blondine, deren außergewöhnliche Anmut nahezu erschreckt, wenn sie ihre Stahlmuskeln steift und den Schweiß ihrer warmen Schenkel dadurch erhöht, dass sie die ungeheure Rosette ihres zarten Rades in Bewegung setzt und wie rasend an der Spitze des Schnellzuges vorwärts stürmt!
Die andere, die Engerth, eine monumentale, dunkle Brünette mit dumpfen rauen Tönen, mit stämmigen Lenden, eingepresst in ihren gusseisernen Panzer, ein unförmiges Wesen mit wilder Mähne schwarzen Rauches und mit sechs niedrigen gepaarten Rädern; welche erdrückende Macht, wenn sie die Erde erzittern macht und plump und langsam den schweren Güterzug hinter sich drein schleppt!
Sicherlich gibt es unter den zarten blonden und den majestätischen brünetten Schönheiten keine derartigen Typen zarter Schlankheit und erschreckender Kraft; auch kann man mit Recht sagen: der Mensch hat, in seiner Art, ebenso Gutes geschaffen wie Gott.
Diese Betrachtungen kamen des Esseintes, wenn ihm der Wind das sanfte Pfeifen der kleinen Eisenbahn zutrug, welche sich wie ein Kreisel zwischen Paris und Sceaux hin und her bewegt.
Sein Haus war ungefähr zwanzig Minuten von der Station Fontenay entfernt; aber die Höhe, auf welcher es stand, und seine einsame Lage liessen nicht den Lärm des gemeinen Lebens bis zu ihm dringen.
Das Dorf selbst kannte er kaum. Durch seine Fenster hatte er eines Nachts die stille Landschaft betrachtet, die sich vor ihm ausbreitete und hinunterzog bis zum Fuß des Hügels, auf dessen Spitze die Batterien des Gehölzes von Verrières aufgepflanzt sind.
In der Dunkelheit rechts und links stiegen verworrene Massen stufenweise auf, in der Ferne von anderen Batterien und anderen Forts überragt, deren hohe Böschungen im Mondlicht wie in Wasserfarben mit schimmerndem Silber auf dunklem Himmelsgrund gemalt erschienen.
Zusammengeschrumpft im Schatten der Hügel erschien die Ebene in der Mitte wie mit Mehl bestreut und mit weissem Cold-cream bestrichen. In der warmen Luft, die leise die farblosen Gräser fächelte und würzigen Duft verbreitete, schüttelten die wie mit Kreide übertünchten Bäume im Mondlicht ihr fahles Laubwerk und vergrösserten ihre Stämme, deren Schatten den Gipsboden mit schwarzen Streifen furchten, auf dem die Kieselsteine wie Tellerscherben glänzten. Ihres verkünstelt geschminkten Aussehens wegen missfiel dem Herzog Jean diese Landschaft nicht. Seit dem Nachmittag, den er auf der Suche nach dem Hause im Dörfchen von Fontenay zugebracht hatte, war er niemals mehr am Tage den Weg gegangen. Das grüne Laub dieser Gegend flößte ihm außerdem kein Interesse ein, bot es doch nicht einmal den zarten melancholischen Reiz dar, welcher der oft rührend kränklichen Vegetation entströmt, die notdürftig zwischen dem Schutt des Weichbildes nahe den Wällen hervorschießt.
Überdies waren ihm an jenem Nachmittage im Dörfchen einige dickbäuchige Einwohner mit Backenbärten und Leute in Gehröcken mit Schnurrbärten begegnet – Köpfe, die ohne Zweifel der Obrigkeit oder dem Militär angehörten; und seit dieser Begegnung hatte sein Widerwille gegen jedes menschliche Gesicht noch mehr zugenommen.
Während der letzten Monate seines Aufenthaltes in Paris, als er alles überwunden hatte, empört durch die allgemeine Heuchelei und vom Weltschmerz niedergedrückt, war die Überreiztheit seiner Nerven derartig gestiegen, dass sich der Anblick mancher Gegenstände oder Wesen seinem Gehirne so tief einprägte, dass es mehrerer Tage bedurfte, um nur die Spuren davon zu verwischen. Unangenehme Gesichter, die sein Blick auf der Straße streifte, waren ihm zur wahren Qual geworden.
So litt er entschieden beim Anblick gewisser Physiognomien, deren hausbackener unfreundlicher Typus ihm wie eine Beleidigung erschienen; es wandelte ihn eine wahre Lust an, diejenigen zu ohrfeigen, welche da langsamen Schrittes mit gelehrter Miene und gesenkten Augen über die Straße gingen, wie auch jene, die sich in den Hüften wiegen und sich gar wohlgefällig in Spiegelscheiben zulächeln, oder jene anderen wieder, die eine ganze Welt von Gedanken zu bewältigen scheinen, indem sie mit der wichtigsten Miene den albernsten Klatsch und den haarsträubendsten Blödsinn der Tagesblätter verschlingen und einfach wiederkäuen.
Er witterte bei allen eine so eingewurzelte Dummheit, einen solchen Abscheu gegen seine eigenen Ideen, eine solche Verachtung der Literatur, der Kunst, kurz, was er verehrte, als wäre es ihnen erblich angeboren oder in ihre beschränkten Krämerseelen eingeankert, die, schließlich nur auf Gaunerei und Geld erpicht, wie alle unbedeutenden und schwachen Geister, nur für niedrige Zerstreuungen der gemeinen Politik eingenommen sind, so dass er wütend nach Hause ging, um sich mit seinen Büchern einzuschließen.
Kurz, er hasste mit ganzer Kraft die neuen Generationen, diese Vertreter moderner Flegelei, die das Bedürfnis haben, überall in den Speisesälen und Kaffeehäusern laut zu schreien und unverschämt zu lachen, die uns auf der Straße wüst anrennen, ohne um Verzeihung zu bitten, oder einem auch wohl einen Kinderwagen zwischen die Beine schieben, ohne sich zu entschuldigen oder kaum den Hut zu lüften.