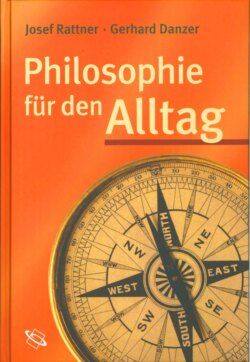Читать книгу Philosophie für den Alltag - Josef Rattner - Страница 10
3. Das Triviale und das Ungemeine
ОглавлениеSeit man über das Wesen des Menschen nachdenkt, wendet man gern dualistische Konzepte an. Man geht davon aus, dass die menschliche Wesensbeschaffenheit aus zwei mehr oder minder antagonistischen Merkmalen besteht. Eine solche Antithetik ist manchmal grob strukturiert. Gleichwohl hat sie sich in den Wissenschaften und in der Philosophie oft als brauchbar erwiesen.
Bei Goethe tritt das dualistische Denken unter dem Begriff der Polarität auf. Darin sah der Naturforscher-Dichter ein Aufbauprinzip der lebendigen Natur und des Seelenlebens. Schopenhauer wandte die Antithetik weitläufig an, indem er seine Anthropologie auf den Gegensatz zwischen dem dumpfen Lebensdrang (Wille zum Leben) und dem Bewusstsein gründete. Das übertrug Nietzsche in das olympische Götterpaar Dionysos und Apollo, die seiner Meinung nach in allen Kulturerscheinungen und im Leben überhaupt wirksam sind. Eine ähnlich polare Erscheinungswelt beschrieb Henri Bergson unter dem Titel des élan vital (Lebensschwungkraft) und der Intelligenz.
Auch bis in die Psychoanalyse hinein finden sich Grundannahmen, in denen wir polare oder antagonistische Momente entdecken. So beschrieb Sigmund Freud die menschliche Psyche als ein Zusammenwirken von Ich- und Sexualtrieben, narzisstischer und Objektlibido, Eros und Thanatos. Alfred Adler sprach vom Gegensatz zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsstreben bzw. den Kompensationen des ersteren durch den Machtwillen oder das Gemeinschaftsgefühl. Und C. G. Jung schließlich konstruierte eine Deutung der Fülle seelischer Phänomene innerhalb der beiden Einstellungsweisen der Introversion und der Extraversion, des Spannungsfeldes zwischen persönlichem und kollektivem Unbewussten und der Antithetik zwischen Persona (Berufsmaske) und Schatten auf der einen und des tieferen Selbst auf der anderen Seite. Es scheint, dass wir hier vor einem Denkmodell stehen, das von vielen Seiten her in Anspruch genommen wird.
Wir werden in der Folge das menschliche Leben unter dem dualistischen Aspekt des Trivialen und des Ungemeinen beschreiben. Es handelt sich um zwei Existenzweisen, in welchen sich das Menschsein abspielt. Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob der Mensch die Wahl zwischen dem einen und dem anderen hätte. Immer hat er teil am Trivialen, und auch wenn er das Ungemeine (das Außergewöhnliche und Überdurchschnittliche) anstrebt und erreicht, fällt er stets wieder in die Trivialität zurück. Dem Kenner der Existenzphilosophie wird in diesem Zusammenhang der dort beschriebene Gegensatz von uneigentlichem und eigentlichem Existieren in den Sinn kommen. Tatsächlich ähnelt unser Begriffspaar jenem, das Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre und andere diesbezüglich verwendet haben.
Wir gehen davon aus, dass das übliche Menschenleben sich weitgehend in der Sphäre des Trivialen ereignet. Das ist so verbreitet, dass sich die meisten Menschen dessen nicht bewusst werden und das „Man-selbst-Sein“ im Sinne Heideggers für selbstverständlich halten. Und doch bewundert man jene, die durch eine besondere Lebensführung und durch spezielle Kulturleistungen ins Ungemeine und Ungewöhnliche hinaufwachsen. Was man Talent, Begabung, Genie, Persönlichkeit und menschliches Format nennt, ist irgendwie beheimatet im Nicht-Trivialen und gewinnt seinen Rang durch eine gewisse Vorbildhaftigkeit, an der sich die Kultur orientiert.
Bevor wir zur Analyse der von uns ins Zentrum gerückten Begriffe des Trivialen und des Ungemeinen übergehen, werden wir in der Folge an drei Beispielen untersuchen, wie herausragende Kulturträger mit der genannten Polarität umgingen. An diesen Exempeln soll deutlich werden, wie es einzelnen Persönlichkeiten gelang, aus der Herrschaft des Gewöhnlichen auszubrechen und sich im Ungewöhnlichen anzusiedeln.
Goethe ist ein eindrückliches Beispiel für eine mögliche Synthese des Trivialen und des Ungemeinen zugunsten des Letzteren. Der Dichter wurde schon in jungen Jahren sehr berühmt. Durch seine Lyrik, sein Götz-Drama und besonders durch seinen Werther setzte er sich an die Spitze der Sturm-und-Drang-Bewegung und der literarischen Epoche der Empfindsamkeit. Zugleich aber hatte er sein juristisches Examen absolviert und praktizierte mit halber Anteilnahme als Anwalt in Frankfurt.
Aber da folgte er der Einladung des sieben Jahre jüngeren Herzogs Karl August nach Weimar und ließ sich in der Stadt an der Ilm nieder. Er wurde zum Freund und Günstling der Herzogsfamilie. Um ihn zu beschäftigen, gab man ihm ein Amt in der Regierung. Zum Erstaunen der Minister erwies er sich als enorm tüchtig. Bald konnte man ihn zum Minister ernennen, und später wurde er (inzwischen nobilitiert) sogar Ministerpräsident des Landes. Während Jahrzehnten beaufsichtigte er viele Ressorts, und immer war seine Amtsführung tadellos. Daneben war er auch ein vollendeter Höfling, Vergnügungsmeister des Hofes und scheinbar völlig angepasstes Mitglied der höfischen Gesellschaft.
Man kann das die triviale Seite seines Lebens nennen. Daneben aber wirkte er still und unauffällig am Aufbau des Ungemeinen und Außergewöhnlichen seines Daseins. Schon die Liebe zu Charlotte von Stein geht in diese Richtung. Es wird immer merkwürdig bleiben, dass sich Goethe an diese sieben Jahre ältere verheiratete Hofdame mit drei Kindern innig anschloss und während zehn Jahren ihr unerschütterlicher Cavaliere servente blieb. Es ist kaum anzunehmen, dass er hierbei sinnliche Erfüllung fand. Charlotte erzog ihn zu höfischen Manieren und war bloß seine Seelengeliebte. Die Abkehr von einer direkten Sexualität und die Hinwendung zu einem fast absoluten Minnedienst scheint eine der Bedingungen gewesen zu sein, unter denen der Aufbau von Goethes Künstler-Persönlichkeit stattfand.
Dazu bewältigte er aber auch, während sein Dichtertalent scheinbar mehr oder minder brach lag, ein ungeheures Pensum an Bildungsarbeit. Er machte sich in zunehmendem Maße mit der Kultur des Abendlandes vertraut. Es gab nichts, an dem er nicht Interesse nahm. Als er sich dann von Charlotte löste und 1786 nach Italien reiste, machte er eine innere Wandlung durch. Er entdeckte im Süden nicht nur die Antike, sondern fand auch im tieferen Sinne zu sich selbst zurück. Darin war enthalten das Erwachen des leibhaftigen Sexus, den er später in den Römischen Elegien wundervoll und offenherzig beschrieben hat.
Goethe hat sein Leben als einen Bildungsroman angelegt, und nicht umsonst ist der Wilhelm Meister eines seiner Hauptwerke geworden. Im unbedingten Festhalten am Wunsch nach einer ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Existenz schuf er sich eine nahezu einmalige Persönlichkeitskultur, die in seine Werke eingegangen ist. Das merkte nach und nach das gebildete Europa, und in seinen späten Jahren erhielt Goethe einen Brief aus England, der adressiert war an „Seine Exzellenz, den Fürsten von Goethe“. Das gefiel dem alten Weisen nicht schlecht: Er erklärte dem aufhorchenden Eckermann, der Briefschreiber habe wohl gemeint, dass er (Goethe) ein „Geistesfürst“ sei und darum diese Redewendung benützt.
Nach Nietzsches Meinung hat Goethe ein Höchstmaß an Bildung erworben. Er assimilierte alles Wissen des Abendlandes und die Kenntnis der Kunstwelt. Auch in der Praxis des Lebens war er wohl informiert. Er beweist, dass der Mensch bei geeigneter Vitalität und Weltoffenheit auch in einem trivialen Milieu alle Möglichkeiten des Ungemeinen und Exzeptionellen ausschöpfen kann.
Goethe war wohl in der Lage, sich dem eigenen ungemeinen Schaffen zu widmen, ohne deswegen das triviale Menschentum kritisieren und abwerten zu müssen. Das entsprach seiner Wesensart, die Thomas Mann richtig als einen „ins Geniale hinauf gesteigerten Biedersinn“ bezeichnete. Da sich der Dichter seines Wertes fest und ruhig bewusst war, fühlte er sich durch eine philiströse Umwelt nicht in Frage gestellt. Er umfasste sie mit einem „liebenden Blick“ (Nicolai Hartmann), der auch im gewöhnlichen und banalen Leben die Poesie entdeckte.
Anders ging es Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit enthielt pathologische Ingredienzien. Das lag schon an der sehr verschiedenen Wesensart seiner Eltern. Der Vater war ein Danziger Kaufherr mit echter republikanischer Gesinnung. Er war ein moralisch aufrechter Mensch, aber mit stark melancholischem Grundzug. Die wesentlich jüngere Mutter hatte eine sanguinische Lebenseinstellung. Es gab Disharmonien zwischen diesen beiden Partnern, die sich auf den zukünftigen Philosophen übertrugen.
Um ihn von seinen intellektuellen Neigungen abzulenken, nahmen die Eltern den Jüngling auf eine Europareise mit. Im Gegenzug dazu sollte er versprechen, ein Kaufmann zu werden. Auf dem Europatrip lernte Schopenhauer viel. Er las „im Buch der Welt“, und er hat später betont, dass derlei einem Bücherstudium vorzuziehen sei. Als aber der Vater 1806 in einem Anfall von Trübsinn seinem Leben ein Ende setzte, trat die Notwendigkeit an Arthur heran, den durchaus ungeliebten Kaufmannsberuf zu erlernen. Seine Mutter ging nach Weimar, wo sie im Kreis um Goethe gern aufgenommen wurde. Man schätzte die Madame Schopenhauer sehr, und ihr Salon wurde von der Weimarer Elite oft besucht. Damals begann sie ihre Karriere als Schriftstellerin, und sie war lange Zeit darin viel erfolgreicher als ihr Sohn, der zu ihr in einem gespannten Verhältnis stand.
Schopenhauer musste sich die Erlaubnis zum Studium von der Mutter erkämpfen. Als Zwanzigjähriger bereitete er sich fast fieberhaft auf die Universität vor. Mit der ganzen Leidenschaft seiner energischen Persönlichkeit stürzte er sich in die Studien, die er erfolgreich mit seiner philosophischen Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde beendete. Als er diese der Mutter überreichte, scherzte sie, das sei wohl etwas für Zahnärzte oder Apotheker. Grimmig erwiderte der Philosoph, seine Schriften würden noch gelesen werden, wenn die Texte der Mutter längst verstaubt seien.
Schopenhauer gilt als berühmter Pessimist, Frauenfeind, Lebensverneiner und tiefgründiger Denker. Aber aus seiner Vorgeschichte wird vielleicht verständlich, dass er ein ängstlicher Paranoiker war, der trotz höchster Geistesgaben stets in Dissonanz zu den Mitmenschen lebte. Als sein Hauptwerk erschien (Die Welt als Wille und Vorstellung, 1818), wurde dieses viele Jahre lang kaum beachtet. Mit seinem cholerischen Temperament steigerte sich der Denker in das Gefühl hinein, es gäbe eine Verschwörung gegen ihn. Er reagierte darauf mit einer Menschenfeindschaft, die sich erst im Alter milderte, als der beginnende Ruhm auf ihn zukam.
Diese Misanthropie ist die Grundlage von Schopenhauers dauernder Publikumsbeschimpfung, womit er das Menschengeschlecht bedenkt. Er wirft ihm vor, dass sein Leben völlig in der Trivialität versinke. Die ganze Gesellschaft sei auf Schein, Trug und leerem Getue aufgebaut. Und doch hat der Mensch, im Unterschied zum Tier, nicht nur einen dumpfen Lebensdrang, sondern auch seine Intelligenz, die einer Laterne gleiche, womit er sein Leben und den ganzen Kosmos erhellen könne. Darum müsse der Mensch seinen Intellekt pflegen, d. h. Bildung und Kultur erwerben, um seiner Aufgabe gerecht zu werden.
In unzähligen Abwandlungen schärft uns der Philosoph ein, dass man „ein wesentlicher Mensch“ werden müsse. Was im Leben zählt, ist nicht, was man hat oder in der Gesellschaft vorstellt, sondern was man wirklich ist. Alle eigentliche Existenz gründet in physischer und psychischer Gesundheit, geistiger Ansprechbarkeit, Persönlichkeitskultur und Vernunfttätigkeit. Da er gerade die drei zuletzt genannten Werte bei seinen Zeitgenossen vermisst, wirft er ihnen Philistrosität und Oberflächlichkeit vor. Fast überall herrsche das Triviale, und wer ein ungemeiner Mensch ist, erleide immer ein Märtyrerschicksal.
Anders als Schopenhauer beschrieb Friedrich Nietzsche den Gegensatz zwischen dem Trivialen und dem Ungemeinen. 1859 war das Buch von Charles Darwin über Die Entstehung der Arten erschienen. Wie nahezu alle Denker der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war auch Nietzsche vom Evolutionismus tiefgreifend beeinflusst. Alles, was er untersuchte, sah er unter der Perspektive der Evolution, die bis zum Menschen hinaufreicht und möglicherweise über ihn hinausgehen soll.
Darwin hatte deklariert, dass im Kampf ums Dasein der „Tüchtigste“ die besten Chancen zum Überleben habe. Nietzsche meinte, das korrigieren zu müssen. In seiner Sicht hatte eher das Mittelmäßige und Unauffällige den Vorteil, keiner strengen Auslese zum Opfer zu fallen. Jedenfalls zeigt sich das am Schicksal jener Ausnahme-Existenzen, die innerhalb der Kultur schöpferische Leistungen vollbringen. Die Genies aller Zeiten wurden von den „Viel-zu-vielen“ (der Menge) immer angefeindet, isoliert und eliminiert. Das Ungemeine erliegt fast regelmäßig dem Angriff des Durchschnitts.
Im Gegensatz hierzu wollte Nietzsche die Menschen dafür gewinnen, für die Zukunft eine höhere Entwicklung des Menschseins ins Auge zu fassen. Hierfür prägte er bekanntlich die missverständliche Formel vom „Übermenschen“, welcher „der Sinn der Erde“ sei. Die ganze Kulturentwicklung hat für den Philosophen nur dann Wert und Bedeutung, wenn im wachsenden Maße Bedingungen geschaffen werden, innerhalb deren das Werden und Wachsen des Genius zustande kommt. Nietzsches poetisch-philosophisches Hauptwerk Also sprach Zarathustra kreist im Grunde um zwei Hauptgedanken: Die Lehre vom Übermenschen und die Theorie von der ewigen Wiederkunft alles Gleichen.
Das Wiederkunfts-Konzept können wir auf sich beruhen lassen. Für Nietzsche bedeutete es unsäglich viel, weil es eine Formel für eine nahezu unsägliche Lebensbejahung war. Trotz seiner andauernden Krankheit rang sich der Philosoph zu einem amor fati (Liebe zum Schicksal) durch. Indem er die Wiederkunft postulierte, sagte er damit, er würde ein solches Leben voller Schmerzen und Qualen auch unendliche Male akzeptieren, wenn es nur den geistigen Ertrag abwerfe, den er seiner jämmerlichen Existenz abtrotzte.
Im Zarathustra wird der trivialen Existenzweise ein leidenschaftlicher Kampf angesagt. Am prägnantesten findet man das bereits in jenen Reden, welche der aus der Einsamkeit in die Stadt kommende Prophet auf dem Marktplatz zum Volke spricht. Einerseits schildert er in glühenden Farben die Aufgabe, aus dem Menschen nach und nach einen Übermenschen zu bilden; andererseits zeichnet er das abschreckende Bild des „letzten Menschen“, der ungefähr jenem entarteten Menschentypus ähnelt, den im 20. Jahrhundert Aldous Huxley (Schöne neue Welt) und George Orwell (1984) so düster gemalt haben. Zarathustra ermahnt das Volk, den Weg vom Affen zum Menschen nicht in umgekehrter Richtung zurückzugehen. Man soll den Menschen nicht verkleinern, sondern ihn vergrößern. Das wird nicht durch den Triumph der Technik und durch tausenderlei Daseinserleichterungen geschehen. Wenn der technisch und zivilisatorisch aufgeputzte „Menschenfloh“ auch mühelos über den Globus springen kann, ist das noch lange nicht ein Grund zum Jubeln. Nur die Blüte der Kultur rechtfertigt das menschliche Leben.
Nietzsches Predigt wurde von den Zeitgenossen wie auch ihren Nachfolgern vielfach missverstanden. Was man einige Zeit später als Überwindung des Trivialen und Ankunft des Ungemeinen darbot, war eher die Herrschaft des Untermenschentums als die Vorbereitung zukünftiger Kulturschöpfung. Die Barbarei nahm überhand, und wir haben heute noch daran zu tragen, ihre verheerenden Folgen zu überwinden.
Das Problem des Antagonismus der von uns erörterten beiden Daseinsmöglichkeiten besteht nach wie vor. Wie soll der Mensch einen Weg finden zwischen der Banalität des Durchschnittlichen und der Chance des Ungewöhnlich- und Einzeln-Seins? Aus dem Obigen hat sich ergeben, dass die Kulturarbeit allein über das Philistertum des mittleren Menschseins hinwegführt. Georg Simmel sagt mit Recht: „Die Kultur ist der Weg der Seele zu sich selbst.“ Also wird der Mensch nur dann sich selbst finden, wenn er die Wege der Kultur beschreitet.
Wir veranschaulichen diese These wiederum an drei Beispielen und wählen hierzu aufs Neue große Kulturrepräsentanten, die das Dilemma zwischen dem Trivialen und dem Ungemeinen grandios bewältigt haben. Der mittlere Leser soll hier jedoch nicht sagen, dass derlei für ihn zu hoch angesetzt sei. Was geniale Menschen konnten, ist für uns „mindere Leute“ ein Vorbild. Vorbilder und Ideale sind jedoch nicht Ziele unseres Strebens, sondern nur dessen Wegweiser. Sie geben an, wohin wir tendieren sollen, aber es wäre Hybris, wenn wir solchen maßgeblichen Persönlichkeiten gleichkommen wollten.
Jacob Burckhardt (1818 – 1897) ist einer der bedeutendsten Kulturhistoriker der Neuzeit. Der Basler Gelehrte stammte aus einer Patrizierfamilie seiner Heimatstadt. Sein Vater war Antistes oder Oberpfarrer, und er wollte, dass sein begabter Sohn in seine Fußstapfen trete. Der frühe Tod der Mutter jedoch erzeugte bei Burckhardt eine leicht melancholische Wesensart. Er war berührt von der Vergänglichkeit aller Dinge, und anstelle der Theologie studierte er lieber Geschichte und Kunstgeschichte. Wesentliche geistige Anstöße erhielt er in Berlin, wo Leopold von Ranke und Gustav Droysen seine Lehrer waren.
Schon in seinen frühen 40er Jahren veröffentlichte er seine drei Meisterwerke, die ihn an die Spitze der Historikerzunft setzten: Das Zeitalter Konstantins des Großen; Die Kultur der Renaissance in Italien; Der Cicerone – eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Diese drei herausragenden Texte ebneten ihm den Weg zur Berufung für das Ordinariat in Basel. Johann Jakob Bachofen, der kühne Mythenforscher und Entdecker des Mutterrechts, empfahl den Baslern die Wahl des jüngeren Kollegen mit dem Prädikat, dieser sei ein vir eruditissimus (ein höchst gebildeter Mann).
Als Student bereits hatte Burckhardt erstmals den Boden Italiens betreten. Dieses Land war damals das Sehnsuchtsziel deutscher Künstler und Gelehrter. Sie folgten unter anderem den Spuren Goethes, der mit seiner Italienischen Reise einen frühen Kunstführer für diesen Kulturbereich verfasst hatte. Burckhardts Cicerone bot nun eine nahezu komplette Beschreibung und Würdigung aller Kunstdenkmäler, die in der südlichen Zone zu finden waren.
Während 30 Jahren lehrte unser Autor an der kleinen Universität Basel. Ihm verdankte die Stadt (wenn man seinem jüngerem Kollegen Nietzsche Glauben schenken will) ihren Ruf als Humanismus-Metropole. Manche deutsche Universität hätte gern den feinsinnigen Kulturgeschichtler berufen. Er wollte aber seiner Stadt treu bleiben und lebte und lehrte dort bis zu seinem Tode.
Er war einer der sensibelsten Kunstkenner der Epoche. Jedes Jahr reiste er nach Italien, um dort die großen Kunstwerke immer wieder zu betrachten. Aber dieser einzigartige Ästhet lebte zu Hause wie ein Asket und Philister, was Nietzsche außerordentlich verwunderte. Wiewohl er ein reicher Mann war, hatte er nur eine karge Wohnung. Und abends ging Burckhardt mit seinen Basler Standesgenossen zum Biertrinken und Politisieren, wo es meistens eher konservativ zuging. Das war eine Art Doppelleben. Er entrichtete seinen Tribut an das Mittelmaß, aber wenn er dozierte oder Bücher schrieb, orientierte er sich an den ganz illustren Meistern der Vorzeit. In gewisser Weise gehörte er der „Goethe-Familie“ an, nämlich jenen Intellektuellen, die das Erbe Goethes weiterführten. Und auch das Erbe der Antike war ihm heilig. Das sieht man an der posthum herausgegebenen voluminösen Schrift Griechische Kulturgeschichte, die seit ihrem Erscheinen unzählige Leser für das Altertum begeistert hat.
Burckhardt widmete sein Leben und Schaffen der Bewahrung der Kultur von Alt-Europa. Daraus bezog er seine Bildungserlebnisse, die ihn zum überragenden Humanisten machten. Gleichwohl blieb er „nebenbei“ der brave und konservative Bürger, der im bürgerlichen Denken der Neuzeit eine wichtige Stellung einnimmt.
Ein anderer souveräner Vermittler zwischen der Sphäre des Trivialen und des Ungemeinen war Rainer Maria Rilke (1875 – 1926). Der Dichter hatte früh sein Leben auf die Werte des Schönen, des Edlen und des Anmutigen ausgerichtet. Es war also eine durchaus ästhetische Existenzweise, die er anvisierte. Es war aber nicht leicht, in diese Lebensform hineinzuwachsen. Eine wesentliche Förderung hierzu erhielt der junge Rilke dadurch, dass er 1897 in seiner Liebeswerbung um Lou Andreas-Salomé erfolgreich war. Diese kultivierte Frau, die früher die Freundin Nietzsches war und später die Schülerin von Sigmund Freud wurde, gab ihm wichtige Impulse für sein Leben und Dichten. Für diese Liebesbeziehung war es kein Hindernis, dass Lou mit dem Göttinger Iranisten Friedrich Andreas verheiratet war. Sie war diese von ihrem Gatten erzwungene Ehe unter der Bedingung eingegangen, dass es darin keine sexuellen Kontakte geben dürfe.
Rilke stilisierte von da an sein Leben völlig auf die Kunst hin. Nach der Trennung von Lou versuchte er zwar eine bürgerliche Existenz; er heiratete in Worpswede die Bildhauerin Clara Westhoff und bekam mit ihr eine Tochter. Er bemühte sich redlich, als Journalist für die Familie aufzukommen, aber das gelang nur teilweise. Nach kurzer Zeit trennte sich das Paar in Freundschaft. Für Rilke begann ein Wanderleben, mit vielen Liebschaften, aber auch mit großer Einsamkeit. Alles war darauf gerichtet, seine Sprachkunst zu entfalten und sein Werk zu ermöglichen.
Die Sorge um die materielle Existenz wurde ihm zum Glück durch das Verlegerpaar Anton und Katharina Kippenberg sowie durch adelige Protektorinnen abgenommen. Rilke war Schützling einer ganzen Reihe von Damen aus der hohen und höchsten Aristokratie. Das war eine der Bedingungen für seine poetische Produktion; er musste sich geliebt und anerkannt wissen. Und da er über eine einzigartige Liebenswürdigkeit verfügte, gelang es ihm regelmäßig, geistvolle und hochrangige Frauen für sich zu interessieren. Auch als er nach 1918 in die Schweiz ging, hatte er in wenigen Monaten reiche und dominierende Persönlichkeiten für sich gewonnen. Ein Winterthurer Industrieller schenkte ihm als lebenslängliches Lehen den Schlossturm Muzot im Wallis, so dass der Dichter in seinen letzten Jahren materiell völlig gesichert als Schlossherr leben konnte.
Einsamkeit, Askese, erlesene Brieffreundschaften, eine erhabene Gebirgslandschaft und vornehme Protektion schufen die Voraussetzungen für die Aufgipfelung seines poetischen Œuvres, die ihm in der Walliser Zeit gelang. Dort dichtete er die Duineser Elegien und die Sonette an Orpheus. In beiden Texten gibt er eine profunde dichterische Auslegung der menschlichen Existenz, welche die Philosophie seither mit ihren eigenen Bemühungen als kongenial eingestuft hat.
Rilke war erstaunlich konsequent in der Abweisung von allem, was an das triviale Dasein erinnern konnte. In den Phasen seines Schaffens lebte er völlig in einer reinen Kunstwelt. Nur so ist es zu begreifen, dass seine Kunst von schwebender Eleganz und ätherischem Tiefsinn ist. Die Forderung, die er in seinem Leben und Denken erhob, kann zusammengefasst werden in seine berühmte und oft zitierte Formulierung: „Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen!“ Das bedeutet, dass der Mensch dann wesentlich existiert, wenn er alles Erfahrene, Erlebte und Erschaute konsequent in „Weltinnenraum“ verwandelt. Rilke ließ keinen Zweifel daran, dass das nur unter dem Einfluss des Eros geschieht.
Burckhardt und Rilke mussten weite Bereiche des Trivialen ausklammern, um ihr Leben und Schaffen im Ungemeinen zu etablieren; der Letztere lebte sozusagen als „Edelschnorrer“, und vom Ersteren ist nicht anzunehmen, dass er je einer Frau sexuell nahe gekommen ist. Im Unterschied zu diesen beiden Geistesheroen konnte Sigmund Freud ein schlicht alltägliches Dasein mit einer genialen Lebensleistung verbinden. Er führte über 50 Jahre lang eine streng monogame Ehe mit seiner Frau Martha, hatte mit ihr sechs Kinder, war gütiger und gediegener Familienvater und ein gewissenhafter Arzt und Forscher. Neben diesem fast unauffälligen bürgerlichen Eingeordnetsein verlief sein spannungsreiches Schicksal als Begründer einer neuen Seelen- und Seelenheilkunde. Dazu kam sein glänzendes literarisches Werk, das in der wissenschaftlichen Literatur der Epoche fast einzigartig dasteht.
Als Stefan Zweig in seinem Buch Heilung durch den Geist den Meister zu würdigen unternahm, rühmte er dessen Haltung der Einfachheit und des sozialen Angepasstseins. Freud, dem in Zweigs Werk die Nachbarschaft mit Mesmer und Mary Baker-Eddy keineswegs gefiel, wandte dagegen ein, dass er doch wesentlich komplizierter sei, als der befreundete Dichter ihn darstelle. Er habe jahrzehntelang leidenschaftlich seinen kostspieligen archäologischen Interessen gefrönt und dafür ein Vermögen ausgegeben. Auch habe er fast jedes Jahr in seinen Urlauben ausgedehnte Reisen nach Italien unternommen, um sich an dessen Kunstschätzen und Altertümern für sein Werk zu inspirieren. Unter seiner bürgerlichen Fassade seien Strebungen und Strömungen verborgen, die Zweigs Lob unterschlage.
Tatsächlich träumte er von Jugend an von einem höchst heroischen Leben. Wie er in Die Traumdeutung und anderswo mitteilt, waren die Vorbilder seiner Jugendzeit keine Geringeren als Moses, Hannibal, Oliver Cromwell (ein Sohn Freuds trug dessen Vornamen), Shakespeare, Goethe, Napoleon, Lessing, Heine usw. Man sieht: Der geniale Psychoanalytiker identifizierte sich mit den Heroen der Geschichte und der Kultur. Auch ordnete er seine Psychoanalyse gern in die Tradition von Kopernikus und Darwin ein; wollte er doch als Student schon einen möglichst imposanten Beitrag zum menschlichen Wissen leisten.
Wie grandios Freud von sich selbst dachte, erkennt man auch noch am Ende seines Lebens. Schwer krebskrank musste er seine Heimat Österreich 1938 verlassen und konnte durch die Intervention seiner Freundin Prinzessin Marie Bonaparte von Griechenland und des Präsidenten Franklin D. Roosevelt nach England emigrieren. Als er mit der Fähre von Calais ins Exil-Land übersetzte, träumte er von William dem Eroberer, der im Jahre 1066 mit seinen Normannen die englische Insel durch Invasion in Besitz nahm. Der hinfällige Greis fühlte sich als „Konquistador“, wie er sich denn auch bei Gelegenheit so intensiv mit Napoleon auseinander setzte, dass vermutlich sogar eine Geistesverwandtschaft mit dem großen Feldherrn nahe liegt.
Freud beweist, dass ein Leben im Trivialen und Unauffälligen eine Teilnahme an der schöpferischen Kultur in keiner Weise ausschließt. Daher möchten wir aus unseren Darlegungen die Schlussfolgerung ableiten, dass auch „triviale Menschen“ durchaus keinen Schaden erleiden würden, wenn sie sich ihrerseits vom Kulturellen, Ungemeinen und Überragenden (soweit die Möglichkeiten reichen) beeinflussen ließen. Wir haben bis zu diesem Punkte unseres Essays die Übersetzung des Fremdwortes „trivial“ ausgespart. Ein Fremdwörter-Lexikon sagt zu diesem Wort aus dem Lateinischen: „abgedroschen, alltäglich, platt und geistlos“. Es ist nicht einzusehen, warum der Mensch, welchem von der Natur das herrliche Geschenk der Vernunft, der Geistigkeit und des universellen Verstehens gemacht wurde, von diesen Gaben nicht einen (wenn auch sparsamen) Gebrauch machen sollte.