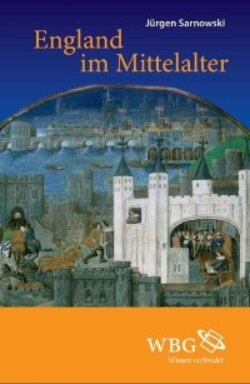Читать книгу England im Mittelalter - Jürgen Sarnowsky - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеDie mittelalterliche englische Geschichte zeichnet sich durch einen ganz eigenen Charakter aus. Vor allem wegen der geographischen Lage lässt sie sich schon von Anfang an gegen die kontinentalen Entwicklungen abgrenzen, ist aber zugleich nicht ohne die kontinentale Geschichte zu verstehen. So bildeten sich in der Frühzeit nach dem Einfall der Angelsachsen in das römische Britannien eigenständige Königreiche, die anders als die meisten vom römischen Christentum geprägten Reichsbildungen niemals Teil des Frankenreichs wurden. Vielmehr entstand nach weiteren Invasionen, denen der Dänen und Norweger im 9. und 10. Jahrhundert, ein vereinigtes englisches Königreich, das auch die Eroberung durch Dänen (1016) und Normannen (1066) überstand. Ungeachtet seiner Insellage geriet England jedoch nach 1066 in eine weitgehende, fast ‚koloniale‘ Abhängigkeit vom Kontinent, die auch nach der Übernahme der Herrschaft durch die Anjou (1154) andauerte. Eine Wende brachten dabei erst der Verlust des angevinischen Festlandsbesitzes (nach 1204) und die von den Baronen erzwungene Ausweisung der südfranzösischen Berater des Königs (1258). Aber obwohl die Anjou nunmehr tatsächlich zu englischen Königen wurden, gaben sie ihre Ansprüche auf den einstmals ererbten Festlandsbesitz nicht auf, seit 1328 bzw. 1337 erweitert um den Anspruch auf die französische Krone, der schließlich in den Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich führte (bis 1453). Das Wechselspiel zwischen England und den kontinentalen Mächten bestimmte selbst den Ausgang der innerenglischen Rosenkriege, in denen sowohl die Rückkehr Eduards IV. nach seiner zwischenzeitlichen Absetzung (1471) als auch die schließlich erfolgreiche Invasion Heinrichs VII. (1485) kontinentale Unterstützung erfuhren.
Die Beziehungen Englands zum Kontinent waren aber nicht nur politisch und militärisch geprägt. Vielmehr bestanden enge Kontakte auf kirchlicher, wirtschaftlicher und kultureller Ebene. So waren die Engländer seit der Christianisierung in die auf Rom ausgerichteten kirchlichen Strukturen eingebunden, durch die päpstliche Bestätigung der Erzbischöfe von Canterbury, die Übertragung der Kirchenreform, die Teilnahme an Konzilien und Kreuzzügen sowie durch die geistlichen Orden, die in England wirkten. Schon in angelsächsischer Zeit gab es Handelsbeziehungen mit dem Frankenreich, und im späteren Mittelalter exportierten fremde und einheimische Kaufleute vor allem Wolle, Häute und Metalle, aber auch (um 1200 und erneut seit dem 14. Jahrhundert) Tuche aus England in alle Teile Europas, um ihrerseits kontinentale Waren nach England einzuführen. In dieser Zeit bestand zudem zwischen den Universitäten in Oxford und Cambridge und dem Kontinent ein reger Austausch von Personen und Ideen.
Gerade vor diesem Hintergrund bedarf es für die Auseinandersetzung mit der englischen Geschichte des Mittelalters einiger Vorüberlegungen, da an einen modernen Nationenbegriff nicht angeknüpft werden kann. Zunächst stellt sich die Frage, inwieweit überhaupt jeweils von einem zeitgenössischen Verständnis von „England“ als Ganzem ausgegangen werden kann. Ungeachtet kontinentaler Missverständnisse kann wohl vorausgesetzt werden, dass ‚England‘ nicht mit ‚Großbritannien‘ gleichzusetzen ist – die Geschichte von Wales, Schottland und Irland soll somit nur dann berücksichtigt werden, wenn sie sich mit der englischen berührt. Dies wird bereits beim englischen Kirchenvater Beda deutlich, der in seiner 731 abgeschlossenen »Kirchengeschichte des englischen Volkes« (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Britannien als „eine Insel im Ozean“ beschrieb, „die einst Albion hieß (…), über 800 Meilen nach Norden an Länge, 200 Meilen an Breite hat“, und der dann die Völker anführte, die zu seiner Zeit auf der Insel lebten, Angelsachsen, Briten, Scoten (Iren) und Pikten, aber zugleich darauf verwies, dass „die Insel zuerst nur die Briten hatte, von denen sie den Namen erhielt“.1 Wenn sich Beda bewusst auf eine Kirchengeschichte gentis Anglorum beschränkte und auf die Schilderung der britischen Geschichte verzichtete, bestimmt dies räumlich und zeitlich auch den Ausgangspunkt dieses Buchs, das mit den angelsächsischen Eroberungen und den in ihrer Folge entstandenen angelsächsischen Reichen beginnt.
Ähnliche Zeugnisse für ein angelsächsisches bzw. englisches Gemeinschaftsgefühl lassen sich auch aus den späteren Jahrhunderten finden, wenn auch unter jeweils anderen Vorzeichen. Ein späteres Beispiel bietet der vielleicht berühmteste Reisebericht des englischen Mittelalters, der von Sir John Mandeville aus der Zeit um 1360, auch wenn die von ihm beschriebenen Reisen, die ihn angeblich bis nach Indien und in das Reich des Priesterkönigs Johannes führten, wahrscheinlich nie stattgefunden haben. Mandeville stellt sich als in England, genauer in St. Albans, geborener Ritter vor, der seine Schrift zunächst aus dem Lateinischen ins Französische, dann aus dem Französischen ins Englische übertragen habe, damit ihn jeder aus seiner ‚Nation‘ verstehen könne. Die Erwähnung der französischen Sprache ist dabei kein Zufall, vielmehr bildete sie noch immer die Sprache der adligen Oberschicht, selbst wenn das Englische auch schriftlich zunehmend an Bedeutung gewann. England war damit, wie Mandevilles Angabe zu seinem Geburtsort deutlich macht, ein geographischer Begriff und gleichzeitig die Bezeichnung für die werdende, unter dem Königtum vereinigte ‚Nation‘, die noch nicht durch die gemeinsame Sprache definiert war. Diese Konstruktion verlor bis zum Ausgang der Rosenkriege keineswegs jede Bedeutung, wie noch der Erfolg Heinrichs VII. über Richard III. 1485 belegt. Dieses Ereignis soll hier auch in konventioneller Weise zum Schlusspunkt der Darstellung gewählt werden, obwohl sich zwischen der Herrschaft des Hauses York und der ‚neuen Monarchie‘ der Tudors durchaus Kontinuitäten beobachten lassen.
Dieses Buch kann damit nicht mehr sein als eine Einführung, ein weit gespannter Überblick über ein Jahrtausend englischer Geschichte. Wer sein Bild vom englischen Mittelalter vertiefen will, dem sei die in der Auswahlbibliographie verzeichnete Literatur empfohlen. Die in den Text integrierten Quellenzitate sollen den Zugang zur reichhaltigen Überlieferung erleichtern, die gleichwohl meist nicht unmittelbar zu uns spricht, sondern vielmehr erst noch ‚entschlüsselt‘ werden muss. Mein besonderer Dank gilt der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, und hier insbesondere Frau Verena Artz und Herrn Daniel Zimmermann, die das Erscheinen des Bandes in dieser Form ermöglichten.