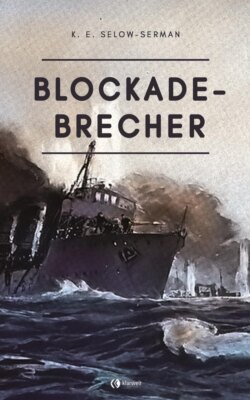Читать книгу Blockade-Brecher - K. E. Selow-Serman - Страница 5
Durch die Bewachungslinien
ОглавлениеWie ein schmaler, bläulichdunkler Streifen zeichnet sich eine Zeitlang die deutsche Küste noch im Dunst des Wintertages ab, bis sie allmählich unter der Kimm verschwindet. Mit voller Fahrt strebt der Dampfer „Marie“ nordwärts. An Backbord taucht in weiter Ferne Helgoland auf. Die schöne rote Sandsteinfarbe scheint vom Dunst aufgesogen, schwarz und steil springt das Land aus der See. Das Tauschobjekt für ein schönes Stück Ostafrika. Wie wertvoll aber der „Hosenknopf“, wie die Engländer früher so verächtlich das Felseneiland nannten, war, hat der Weltkrieg so recht bewiesen. Die Insel in englischen Händen hätte die vollständige Unterbindung jeder Operation der deutschen Flotte zur Folge gehabt, ein Durchbruch wie der jetzt geplante wäre ein nahezu aussichtsloses Unternehmen gewesen. Musste es dann doch den Engländern ein leichtes sein, die Bewachungslinien zur Abriegelung der Häfen in der deutschen Bucht zu beiden Seiten der Insel nach dem Festland hinüberzuziehen. Dazu hätte es noch nicht einmal vieler Schiffe bedurft. Jetzt müssen sie ihre Sperrlinien hunderte von Seemeilen weit draußen, von Schottland nach Norwegen und Island legen, zahlreiche Schiffe jeder Art, vom riesigen Hilfskreuzer bis hinab zum bewaffneten Fischdampfer müssen Tag und Nacht die Kreuzer und Zerstörer, deren Zahl bei weitem für diese Aufgabe nicht ausreicht, unterstützen.
Die Dämmerung bricht herein. Die grünen Wasser der Nordsee färben sich dunkler, bis sie allmählich tiefschwarze Farbe annehmen. Fahl leuchtend rauschen die weißen Schaumkronen der Wellen heran, mit dumpfen Schlägen prallt die See gegen die Bordwand, in Stagen und Wanten fingt der auffrischende Westwind. Ruhig setzt der deutsche Dampfer seine Fahrt fort. Weit vorgeschoben noch stehen die deutschen Vorpostenboote, nicht ungesehen käme der Feind. Und wieder vergeht in gleichförmiger Stille eine Stunde. In dem dustern Grau des Winterabends blinkt ein Licht. Eine Sekunde kaum leuchtet es, verschwindet. Unmittelbar folgt ein zweites, in kurzen Zwischenräumen weitere. Lang . . . kurz . . . kurz . . . lang: Ein Fahrzeug der äußersten deutschen Bewachungslinie, das die „Marie“ gesichtet und sie sofort als Frachtdampfer erkannt hat. Kaum fünfhundert Meter ab liegt das kleine Schiff, das in der Dünung nach beiden Seiten stark überholt. Klein, unscheinbar, mit zwei Masten und einem Schornstein. Ein ehemaliger Fischdampfer, der sich unter seiner schützenden grauen Farbe kaum in schattenhaften Umrissen vom nebligen Hintergrund abhebt. Längst ist er vom Zeitpunkt, zu dem der Blockadebrecher passieren will, verständigt und fordert nun durch Morsen das verabredete Gegensignal. Minuten später liegt das Vorpostenboot achteraus und versinkt wieder im Dunkel der Nacht. Das letzte deutsche Schiff, das der Besatzung für lange Zeit, vielleicht für immer, vor Augen kommt.
Bis hierher reicht der Schutz der deutschen Flotte. Von jetzt ab heißt es für Kapitän Sörensen, sich allein weiterhelfen, dem Glück und dem seemännischen Geschick des Führers und der Leute vertrauend. Jede Stunde steigert die Gefahren. Feindliche U-Boote, Kreuzer und Patrouillenschiffe können auftauchen. Ihnen gegenüber ist der deutsche Dampfer, sobald er als solcher erkannt ist, verloren. Es kommt nur darauf an, die feindlichen Fahrzeuge nach Möglichkeit zu umgehen.
Es ist Neumondzeit. Kein Stern schimmert durch die nachtschwarzen Wolken, die in wilder Fahrt vor dem Wind nach Osten jagen. Trotzdem suchen mit scharfen Nachtgläsern bewaffnete Augen nach allen Seiten das Dunkel zu durchforschen. Kein Schimmer, nicht der kleinste Lichtschein dringt aus dem Schiff. Weder Positions- noch Dampferlaternen brennen, der blinde Zufall nur könnte den Feind auf die Spur bringen. Zwar sind die englischen Bewachungslinien noch weit, einzelne Kreuzerverbände aber können hier streifen. Auch sie fahren abgeblendet, um den deutschen U-Booten nicht zum Opfer zu fallen. Ein Flüstern . . . eine ausgestreckte Hand . . . da . . . an Backbord . . . ein schwarzer Schatten . . . ein Schiff . . . ein Feind . . . nein, es ist nichts, eintönig nur rauscht die See, schrill pfeift der Wind.
Noch dämmert der Morgen nicht, als sich auf dem Bootsdeck beim Schornstein ein eigenartiges Treiben entwickelt. Zwei mit Farbtopf und Pinsel bewaffnete Matrosen klettern am Schornstein hoch, und nach einer halben Stunde emsiger Arbeit unterbricht ein grellroter Ring das eintönige Schwarz. Es ist kein leichtes Stück, das Werk in See auszuführen, Kernworte in niederdeutscher Sprache feuern aber die „Künstler“ und ihre Gehilfen, die von Deck aus die leiterartigen Gerüste halten, zu Glanzleistungen an. In kurzer Zeit schon ist die Farbe auf dem Ringe unter der Hitze, die der Schornstein ausströmt, getrocknet. Jetzt folgt die Feinmalerei. Soll das Schiff die Abzeichen der Robinsonline tragen, dann muss auf das rote Feld noch zu beiden Seiten ein weißer Stern. An Backbord sitzt der Matrose Gert, ihm gegenüber an Steuerbord Otten. Die beiden sind Ostfriesen; zusammen sind sie aufgewachsen, haben gleichzeitig auf demselben Schiff ihren Dienst in der Marine getan und sind einträglich und vergnügt an Bord der „Marie“ gekommen. Ein edler Wettstreit herrscht zwischen ihnen. Gert ist zuerst mit seinem Stern fertig. Prüfend betrachtet er sein Werk und meint zu Otten, der eben den letzten Strich zieht: „Wenn John Bull min‘ Sid füt, denn holt hei us nich an.“ Otten ist zwar auch von der vorzüglichen Ausführung der Arbeit überzeugt, hat aber doch ernste Bedenken, dass das Kunstwerk einen „zu sauberen“ Eindruck macht. „Un so en richtigen Collier mut en besten sudelig sin!“
Stundenlang verfolgt das Schiff seinen Kurs nordwärts, ohne ein verdächtiges Fahrzeug zu sichten. An Steuerbord sind dicht unter der Küste einige dänische Motorfischer emsig beim Schollenfang beschäftigt. Sie kümmern sich gar nicht um den Dampfer, der weit ab von ihnen vorbeizieht. Das Wetter ist klar, frei und offen liegt die See, bis auf zehn Seemeilen sichtig. Gegen zwei Uhr nachmittag meldet der Ausguck backbord voraus Rauchwolken. Beim schärferen Zusehen sind auch bald die eben über die Kimm tauchenden hohen Masten eines Schiffes zu erkennen, das anscheinend mit schneller Fahrt südwärts steuert. Ein Augenblick kurzer Überlegung, ein rascher Entschluss. Was da über der Kimm heraufkommt, kann nur der Feind sein. Drei Schornsteine, aus denen in schweren Wolken dunkler Qualm dringt, heben sich ab: ein englischer Hilfskreuzer! Und schnurgerade führt ihn sein Kurs dem deutschen Dampfer entgegen. Jetzt heißt es ausweichen, was nur die Maschine hergibt. Einige Ruderkommandos, ein Rattern am Maschinentelegraphen. Ein leises Zittern geht durch das Schiff, als die Schraube schneller und schneller zu wirbeln beginnt. Höher kämmt das weiße Bugwasser die Bordwände längs. Mit hoher Fahrt strebt der deutsche Dampfer jetzt dem Skagerrak zu, als wenn er, von England kommend, quer über die Nordsee einen dänischen oder schwedischen Hafen anzusteuern beabsichtige.
Der Hilfskreuzer ist inzwischen weiter heraufgekommen. Anscheinend ist es ein Cunarder, der im Dienste der britischen Admiralität fährt. An Gegenwehr ist gor nicht zu denken. Was sollte die „Marie“ den 15-Zentimeter-Geschützen, die der drüben an Bord führt, entgegensetzen? Das einzige Heil liegt nur in der Flucht. Nicht eine Sekunde wird der nahende Gegner aus den Augen gelassen. Er hat eine Fahrt im Leibe, die dem deutschen Dampfer nur zu sehr überlegen ist. Zusehends wächst er aus dem Wasser heraus, wird größer und deutlicher. Und gerade jetzt, in diesem Augenblicke, der der ganzen Fahrt ein jähes Ende zu bereiten droht, die in dieser Jahreszeit so seltene Sichtigkeit! Die Sonne steht zwar schon ziemlich tief im Westen, bis zur völligen Dunkelheit aber mag noch eine halbe Stunde vergehen. Und was kann in der Zeit nicht alles geschehen! . . .
Eine Zeitlang scheint es, als ob der Hilfskreuzer den Trampdampfer, der die Abzeichen einer englischen Reederei trägt und seinem Kurs nach von England kommt, nicht beachten wolle. Ruhig setzt er seinen Weg fort. Dann aber, als er achteraus liegt, flattern drüben Signale hoch. Auf die vorläufig noch große Entfernung sind sie nicht abzulesen, zweifellos aber bedeuten sie das peinliche „J. D.“, den Befehl zum sofortigen Stoppen. Das entspricht nun allerdings nicht ganz den Absichten Sörensens. Wieder schrillt der Maschinentelegraph, noch stärker wird das Zittern, höher steigt die Umdrehungszahl der Schiffsschraube. Unten in Heiz- und Maschinenräumen wissen sie genau, was jetzt von ihnen abhängt. Stählerne Muskeln krampfen sich, zum Platzen gespannt treten die Adern hervor, in Strömen fließt der Schweiß. Schneller und schneller jagt der deutsche Dampfer durch die grüne See. Ob es gelingen wird?
Starr blicken sie hinein in die rotflammende Sonne, zählen zum so- und sovielten Male die Minuten, in denen das schützende Dunkel endlich hereinbrechen muss, bis sich geblendet die Augen abwenden. Ein unterdrückter Ruf des Wachoffiziers, ein freudestrahlendes Gesicht wendet sich Sörensen zu: „Er folgt uns nicht!“ Der Kapitän schüttelt den Kopf. Er weiß, welch überlegene Geschwindigkeit in dem englischen Hilfskreuzer steckt und dass es ihm, wenn er auch nur den geringsten Verdacht schöpft, ein leichtes ist, die Entfernung aufzuholen. Fast scheint es einen Augenblick, als ob die drei Schornsteine kurzer würden und der Engländer wieder langsam unter der Kimm verschwände, Er hält seinen südlichen Kurs durch.
Es scheint nur. Plötzlich aber verkürzen sich die Umrisse des Cunarders, er dreht dem deutschen Dampfer nach. Sie haben Verdacht geschöpft, die Jagd beginnt. Fünf Minuten verstreichen . . . langsam nähert sich der untere Sonnenrand dem Wasser, setzt auf. . . . Noch ist die Entfernung zu groß, als dass der Engländer von seinen Geschützen Gebrauch machen könnte, aber von Minute zu Minute bringt ihn die überlegene Geschwindigkeit näher heran . . . .
Die Sonne ist verschwunden, graue Schatten ziehen von allen Seiten herauf. Die scharfen Umrisse der beiden Schiffe scheinen sich aufzulösen und mit der Dämmerung in eins zu verschwimmen. Auf dem Hilfskreuzer blitzt es auf, eine Reihe von Sekunden später kommt aus weiter Entfernung der kurze Knall eines Schusses herüber. Der Engländer sieht sein Ziel in der rettenden Dunkelheit verschwinden und versucht nun das letzte Mittel, es zum Halten zu bringen. Das Aufschlagen der Granate ist nicht mehr zu sehen, und von Sekunde zu Sekunde vertieft sich die Dunkelheit der schnell hereinbrechenden Winternacht. — Der Verfolger ist außer Sicht . . . .
Mit Hartruder dreht Sörensen auf Nordkurs, um im Gegner die Ansicht zu erwecken, dass es sich um ein harmloses Handelsschiff handelt, das dem Aufgebrachtwerden und dem Verschleppen nach Kirkwall entgehen will. Weit entfernt an Backbord achteraus erhellt sich die Nacht, Scheinwerferkegel huschen über das Wasser und suchen den Flüchtling in östlicher Richtung. Abgeblendet in tiefstem Dunkel jagt der inzwischen unbehelligt nach Norden.
Die letzte Stunde hat harte Arbeit von den Kesseln und in den Bunkern gefordert. Alles, was an Deck entbehrlich ist, das dienstfreie Maschinenpersonal, das sich von der letzten Wache kaum umgezogen hat, ist sofort, als der Verfolger auftauchte, wieder an die Arbeit gegangen. Jetzt muss aus dem Schiff herausgeholt werden, was Kessel und Maschine hergeben wollen, oder alles ist verloren, und es bleibt nur noch die Versenkung des Schiffes übrig. Ein gefüllter Kohleneimer nach dem andern kommt aus den Bunkern in den Heizraum, derbe Fäuste fassen sie, und durch die offenen Feuertüren sausen die Kohlen in mächtigem Schwunge auf die rotweiße Glut, die sich höher und höher türmt. Die Maschine vermag die Überfülle des Dampfes nicht zu verarbeiten. Längst ist der Zeiger des Dampfdruckmessers über den roten Polizeistrich hinausgewandert, jede Sekunde kann einer der auf diesen Überdruck nicht gebauten Kessel in die Luft fliegen. Zischend strömt der überschüssige Dampf aus den Sicherheitsventilen. Unentwegt wird weiter gearbeitet. Immer noch steht der Zeiger des Maschinentelegraphen auf äußerster Kraft, und der Befehl von der Brücke lautet, das letzte aus der Maschine herauszuholen. Die schweren Eisenteile wirbeln mit einer Geschwindigkeit, wie sie das gute Schiff sicher noch nicht gekannt hat, seit es die Bauwerft verließ. Dann, nach einer Stunde, kommt die erlösende Nachricht, dass der Verfolger abgeschüttelt ist und der Befehl, mit den Umdrehungen herunterzugehen. Mit der größten Spannung sieht alles an Bord dem heranbrechenden Morgen entgegen. Hoffentlich hat der Engländer nicht andere Schiffe alarmiert.
Im Osten dämmert der Tag. An Steuerbord steigen dunkle Felsen aus der See hoch, weiß brandet der Gischt an starren Granitwanden. Eine Stunde später ist der Tag da. In hellem Sonnenglanze, weithin sichtbar liegt die See. Die gute Sichtigkeit ist zwar eine große Gefahr für das ganze Unternehmen, weil feindliche Kreuzer das deutsche Schiff nur zu leicht entdecken können, andererseits aber liegt an Steuerbord das neutrale Land, dessen Hoheitsgebiet leicht erreichbar, ist, wenn eine verdächtige Rauchwolke auftaucht. Freilich ist es besser, wenn kein Feind in Sicht kommt; hat der Weltkrieg doch schon zur Genüge bewiesen, welch merkwürdige Begriff? von neutralen Grenzen England hat.
Nichts ist zu sehen, einsam steuert der Dampfer seinen Kurs weiter. Gegen Mittag kommt die norwegische Küste aus Sicht. An Backbord voraus tauchen die Masten und weißen Flächen eines großen Seglers auf, der anscheinend von Kirkwall einem norwegischen Hafen zustrebt. Die Kurse der Schiffe kreuzen einander. Beim Näherkommen setzt die Bark die blaugelbe Flagge Schwedens. Wie lange mögen die Engländer wohl den armen Teufel widerrechtlich festgehalten haben! In schlanker Fahrt, leicht überliegend zieht das schöne Schiff unter der Last seiner schneeweißen Segel vorbei, um nach einer Stunde unter der Kimm unterzutauchen.
Eintönig in gleichmäßigem Takt stampft die Maschine, in gleichen Umdrehungen mahlt die Schraube durch die See. Meile um Meile wird zurückgelegt, immer weiter rückt der Zeiger aus dem Patentlog, immer näher kommt die gefährlichste Zone.
Ein Schuss! . . . Ein scharfer Knall zerreißt das gleichmäßige Rauschen der See. Mit einem Satz stürzen Kapitän und Wachoffizier nach der Nock der Brücke, von wo der Schall herüberdringt. Scharf, doppelt angestrengt spähen die Augen über die einsame See. . . Da! . . . ein grauer Turm . . . niedrig, kaum über das leichtbewegte Wasser herausragend der Schiffskörper . . . noch ist keine Zeit zu weiterer Überlegung, als es drüben, kaum fünf Seemeilen ab, aufblitzt. Heulend fegt die Granate dicht am Bug vorbei. . . Flucht ist unmöglich. . . Es heißt dem bitteren Befehle folgen.