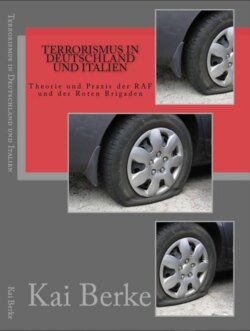Читать книгу Terrorismus in Deutschland und Italien: Theorie und Praxis der RAF und der BR - Kai Berke - Страница 19
ОглавлениеDie antiautoritär- internationalistische Ausrichtung der Studentenbewegung
Unter dem Einfluss von Theoretikern wie Frantz Fanon oder Che Guevara bildete sich im Westberliner SDS um 1965 ein antiautoritär- internationalistischer Flügel um Rudi Dutschke und Bernd Rabehl heraus, der dem antikolonialen Befreiungskampf in der 3. Welt die entscheidende Bedeutung im globalen Wettstreit zwischen Kapitalismus und Sozialismus zusprach und deshalb der Solidarität mit den Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt besondere Bedeutung zumaß.
Die Aktionen dieser Gruppe, die aus der Subversiven Aktion hervorgegangen war, bekamen ihre Publizitätswirkung auch nicht durch ein traditionelles Sozialismusverständnis sondern durch die Thematisierung postmaterieller Werte, die in bewussten Regelverletzungen, wie z. B. schon im Dezember 1964 mit der Durchbrechung der Polizeiketten bei der Anti- Tschombé- Demonstration ihre spezifischen, für viele attraktiven Ausdrucksformen hatten.
In den folgenden Jahren gab es verschiedene Versuche des organisatorischen Zusammenschlusses und des gemeinsamen Kampfes seitens der Befreiungsbewegungen des Trikonts, wie zum Beispiel auf der Solidaritätskonferenz der Tricontinentale im Januar 1966 in Havanna. Grundgedanke war, die Kräfte des US- Imperialismus in vielen verschiedenen parallelen Kämpfen aufzureiben. Nach Guevaras Focustheorie war für den Beginn des Guerillakrieges eine revolutionäre Situation nicht unbedingt erforderlich; vielmehr sei diese durch die Erfolge des aufständischen Focus erst zu schaffen.
Diese Theorien, wie auch die Schriften Herbert Marcuses, übten einen großen Einfluss auf die Studentenbewegung in der BRD und Westberlin aus, und es begannen Diskussionen darüber, wie und welche Oppositionsgruppen in den imperialistischen Metropolen den Widerstand in der Dritten Welt praktisch unterstützen könnten.
Verbreiterung und Radikalisierung- Vom 2. Juni 1967 zu den Osterkrawallen 1968
Nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg durch den Polizeihauptmeister Kurras auf einer Demonstration gegen den Besuch des persischen Schah in Berlin am 2. Juni 1967 verbreiterte und radikalisierte sich die Bewegung erheblich. Die Berliner Polizei, die auf einen kommunistischen Aufstand besser vorbereitet war als auf die Provokationsstrategie der Studenten, verlor – zusätzlich aufgehetzt durch die Springerpresse – immer mehr das Augenmaß und reagierte auf den grenzverletzenden Protest immer gewalttätiger. In dieser Situation begannen zunehmend Diskurse über Gegengewalt und Diskussionen, welche Organisationsformen den veränderten Bedingungen angemessen wären.
Erste Ideen, wie das rurale Guerillakonzept auf städtische Räume zu übertragen wäre, entwickelte das Organisationsreferat von Dutschke und Krahl vom September 1967. In der von Bewusstseinsmanipulation geprägten bundesdeutschen Gesellschaft sei die Organisationsform der Mitgliederpartei nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr müssten kleine (studentische) „Bewusstseinsgruppen“ den Charakter des Systems durch exemplarische Aktionen offen legen und so massenhaftes Bewusstsein von der Notwendigkeit des Kampfes produzieren. Auch wenn bei Dutschke/ Krahl natürlich nicht von bewaffnetem Kampf die Rede ist, stellt das Organisationsreferat eine Grundlage des späteren Stadtguerilla- Konzeptes der RAF dar.
Am 3. April 1968 verübte eine Gruppe um Andreas Baader und Gudrun Ennslin aus Protest gegen die Gleichgültigkeit der Bevölkerung dem Vietnam- Krieg gegenüber einen Brandanschlag auf zwei Frankfurter Kaufhäuser. Als dann am 11. April 1968 Rudi Dutschke niedergeschossen wurde, begann eine überaus gewalttätige, mehrtägige Kampagne gegen den Springer- Konzern („Osterunruhen“), der wegen seiner Hetze gegen die Studenten für das Attentat mitverantwortlich gemacht wurde. Für viele war nach dem Attentat, wie Ulrike Meinhof es in ihrer Kolumne in Konkret schrieb, die Grenze vom Protest zum Widerstand überschritten.
Niedergang und Spaltung der APO
Doch über diesen Punkt der höchsten Mobilisierung und Radikalisierung kam die Bewegung nicht hinaus. Mit Dutschke fiel die Person aus, die die unterschiedlichen Strömungen zusammengehalten hatte. Im SDS, der die theoretische Hegemonie über die Bewegung übernommen hatte, setzten sich die Traditionalisten langsam wieder gegen die Antiautoritären durch. Deutlich wurde der Widerspruch zwischen beiden in der Frage, wie man die erreichte Mobilisierung verbreitern könne. Die Traditionalisten wollten mit einer Betriebskampagne den Kontakt zur Arbeiterschaft intensivieren, während die Antiautoritären eine Justizkampagne vorschlugen. Diese bot sich wegen der Vielzahl der nach den Osterunruhen eingeleiteten Verfahren an.
Im Verlauf des Jahres 1969 zerbrach die APO in viele Fraktionen, von denen die größte nach der Bildung der sozialliberalen Koalition in Bonn wieder in die Parteien (vornehmlich die SPD) zurückkehrte. Die Traditionalisten organisierten sich in verschiedenen autoritären K- Gruppen, während ein Teil des antiautoritären Flügels sich radikalisierte und in den bewaffneten Kampf mündete. Der Weg dahin führte von der Erfahrung staatlicher Repression über militanten Widerstand, wie bei der Schlacht am Tegeler Weg zu Gruppen wie dem Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen, Tupamaros Westberlin u.a., die die Provokationsstrategie in Formen des bewaffneten Widerstands überführten.
Die große Mehrheit der an der APO Beteiligten wollte aber keine Systemveränderung sondern war ganz konkret gegen bestimmte Auswüchse großkoalitionären Regierungshandelns und setzte dagegen auf Werte wie Demokratie, Solidarität, Partizipation u.a. Diese Mehrheit setzte Vertrauen in die neue sozialliberale Koalition unter Kanzler Brandt, der in seiner ersten Regierungserklärung vom 28.10.1969 ein ehrgeiziges Paket an Reformen und einen neuen politischen Stil ankündigte.