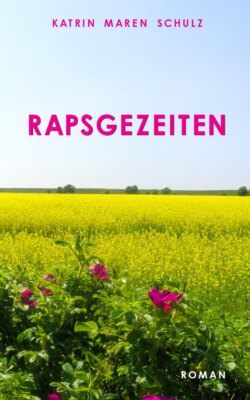Читать книгу Rapsgezeiten - Katrin Maren Schulz - Страница 8
ОглавлениеZwiespalt
Zurück in der Stadt. Hochsommerstadt. Es ist schön, meine beiden liebsten und vertrautesten Menschen wieder um mich zu haben. Wir sitzen auf der Terrasse unserer Dachgeschosswohnung, in der Ferne blinkt der Fernsehturm vom Alexanderplatz.
Ich erzähle, viel und lange. Am meisten davon, wie sehr mich das neu entdeckte Land begeistert hat. Linda und Tim freuen sich für mich. Aber ein bisschen bin ich ihnen auch fremd.
„Du bist anders geworden“, meinen sie.
Ich spüre das auch. Erklären kann ich es aber nicht. Mir fehlen die Worte dafür, die beschreiben könnten, was dieses Stück nordfriesische Küste mit mir gemacht hat.
Wir gehen noch auf die Modersohn-Brücke. Das ist Kult hier, in unserem Kiez. Die Brücke führt über die S-Bahngleise, und von ihr aus ist abends der Sonnenuntergang hinter dem Fernsehturm zu beobachten. Wenn die Abende so lau sind, wie heute, ist viel los. Dann versammeln sich die Kiezbewohner auf der Brücke, trinken ihr mitgebrachtes Bier. Einer sitzt mit seiner Gitarre da, und spielt und singt selbstkomponierte Lieder. Von der Liebe, und vom Fernweh. Für mich?
Zu Beginn des Sommers war ich hier gerne. Jetzt aber kann ich diesem Kult nichts mehr abgewinnen: zu viele Menschen, zu viel Stimmengewirr, und hinter unseren Rücken brausen Autos vorbei. Ich kenne das nicht mehr, den Sonnenuntergang zu teilen. Und ich weiß nicht, ob ich es wieder lernen mag.
Ich mag zurück nach Hause. Gestern noch war das mein Haus im Norden.
Das ganze Wochenende liegt noch vor mir, bevor der Büroalltag wieder beginnt. Bekomme Besuch von einem Freund. Wir hatten uns lange Zeit nicht mehr gesehen. Sitzen im Straßencafé über hitzeflirrendem Asphalt und erzählen uns unsere Leben.
„Du wirkst so unglaublich authentisch“, sagt er.
Ja, er bringt es auf den Punkt, so fühle ich mich auch. So echt, so normal, so selbst. Noch habe ich sie bei mir, die Authentizität, die ich im Norden entwickelt habe. Mag sie auch nicht loslassen. Aber verliere sie trotzdem, mit jedem Tag mehr in der Stadt.
Schon in der ersten Arbeitswoche wieder wird mir die Stadt zu viel, und zu anstrengend. Die langen Wege, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, machen mich irre. Wege voller Menschen, Lärm, Werbeplakaten. Reizüberflutung, in den Augen, in den Ohren, im Gehirn. Stinkende, lärmende Stadt auf jedem Weg ins Büro, und zurück. Und ich mittendrin. Freiwillig.
Die Menschen rennen so viel. Sie rennen der U-Bahn hinterher, obwohl die doch im Berufsverkehr alle fünf Minuten kommt. Sie rennen über rote Ampeln, um den Bus zu erwischen. Sie rennen und hetzen - wofür? Um am Ende zehn Minuten früher im Büro zu sitzen? Was haben sie davon, außer dafür ihr Leben riskiert zu haben?
Ich beobachte sie, während ich still auf die nächste Bahn warte. Und frage mich, warum ich eigentlich so lebe, wie ich lebe? In einem anstrengenden Moloch, in dem ich das Geld verdiene, mit dem ich mir zehn Tage schöne Welt pro Jahr kaufe?
Zwischen Berlin und mir existiert schon immer etwas wie eine Hassliebe. An manchen Tagen kann ich Berlin einfach nur umarmen und lieben. Und an anderen Tagen nervt sie mich an, diese Stadt - mit ihren Hässlichkeiten aus Beton, und ihren Miniatur-Grünflächen, die Natur vorgaukeln wollen. Mit ihrem rauen Ton, der menschengemacht ist.
Seit meiner Rückkehr schweigen wir uns an, Berlin und ich. Wissen nicht mehr, was wir voneinander halten sollen.
Im Büro ist alles wie immer. Hatte ich etwa etwas anderes erwartet? Wie viel Zeit müsste vergehen, dass sich in einem Büroalltag Veränderung zeigt? Geht es anderen auch so - dass es ihnen manchmal auf die Füße fällt, das ewige das-Gleiche-tun?
Einer Kollegin vielleicht: sie hat gekündigt, und wechselt in eine andere Agentur. Sie verändert ihr Tätigkeitsumfeld, nicht aber ihre Tätigkeit. Ob das ausreicht, um Veränderung empfinden zu können? Ich glaube es nicht. Lasse mir das aber nicht anmerken, als sie euphorisch von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz erzählt. Sehe ihr zu, wie sie strahlt, voller Erwartung auf etwas völlig Neues. Gedanklich prognostiziere ich ihr Enttäuschung.
Sie hatte ihren neuen Job gesucht, auf dem Stellenmarkt. Mein Weg wäre das nicht. Nicht, wenn ich eigentlich zufrieden bin mit dem was ich habe, und einfach nur ein bisschen Langeweile empfinde. Dann will ich nicht aktiv die Veränderung suchen. Weil ich glaube, dass sie kommt, wenn sie kommen soll. Ich will dann nur eines: wach und aufmerksam sein. Um ihr die Tür öffnen zu können, wenn sie anklopft, die Veränderung. Solange sie das nicht tut, will ich schätzen, was ich habe. So habe ich es mir jedenfalls vorgenommen, letzte Woche, im Bad in der Nordsee.
Für einen kurzen Moment sehe ich die Wasserperlen auf meiner Haut glitzern. Aber es ist nur eine Illusion.
Zufriedenheit, in meinem Urlaub noch war sie so nah. Jetzt entzieht sie sich mir, als sei sie beleidigt. Als sei sie nicht einverstanden mit diesem Umfeld, das ich ihr hier biete. Hier, in meinem Stadtleben, entschwindet sie. Wohin?
Es ist Arbeitsgruppentreffen. Mein Ehrenamt, dem ich nebenbei nachgehe, weil das Thema mich so sehr interessiert. Und weil ein bisschen Ehrenamt ruhig jeder leisten kann, finde ich, zumindest bislang. Um nachhaltige Lebensstile geht es da, und die Rolle der Arbeit darin. Ihre Verteilung, die nicht gerecht ist: auf der einen Seite die Vollzeitstellen inklusive Überstunden, auf der anderen Seite die Arbeitslosen, die schon über eine Teilzeitstelle glücklich wären. Wir diskutieren politische Modelle, mit deren Hilfe die vorhandene Erwerbsarbeit umverteilt werden könnte, damit alle etwas davon haben.
Es ist ein spannendes Thema, und auch genau meins. Ich arbeite in Teilzeit, bewusst. Aus der Überzeugung heraus, dass Erwerbsarbeit allein nicht das Zentrum meines Lebens ist, und es noch ein Leben darüber hinaus gibt: täglich, wöchentlich, monatlich. Nicht nur, oder erst, mit der Rente. So habe ich mehr Freizeit als andere, aber auch weniger Geld.
Warum lassen sich nicht mehr Menschen von der Teilzeitarbeit begeistern, fragen wir uns. Und bleiben immer wieder an diesen finanziellen Aspekten stecken: weniger zu arbeiten kann sich sicherlich jeder gut vorstellen. Weniger Gehalt zu erhalten jedoch nicht. Selbst den Besserverdienenden scheint dies schwer zu fallen. Zu sehr lockt die Warenwelt, mit ihren Angeboten und Verheißungen eines noch prächtigeren Lebens.
Mir graut es. Vor dieser Vorstellung, wie viele Menschen an fünf Tagen einer Woche, die doch nur sieben Tage hat, Dinge tun, die sie nicht wirklich für sich tun, sondern für einen Arbeitgeber. Wie viel das an Lebenszeit ist. Lebenszeit, die auch mit liebgewonnenen Menschen, oder selbstgewählten Tätigkeiten bereichert werden könnte. Ich verstehe die, die fünf Siebtel ihrer Lebenszeit einem Arbeitgeber zur Verfügung stellen, genauso wenig wie die, die auf dem Weg zur Arbeit hetzen. Ich verstehe die Vergötterung von Erwerbsarbeit nicht. Sie ist ein Hilfsmittel für das Leben für mich, nicht Lebensmittelpunkt.
Auf dem Heimweg von der Arbeitsgruppe fühle ich mich öde und leer. Was bringt es, mein Engagement? Niemals werden wir etwas ändern, an den festgefahrenen, über Jahrzehnte etablierten Strukturen im Erwerbsleben und in der Arbeitsmarktpolitik. Wir haben schöne Ideen - aber wer will sie hören? Wir haben schöne Ideen - aber wir bekommen sie nicht gebündelt. Das ist das Verhängnis, oft, an politischer Arbeit: die Fakten bündeln zu können, um sie zu transportieren, nach außen.
In dieser Arbeitsgruppe gelingt das selten. Kein Ende oder Ergebnis in Sicht. Erst heute wird mir das wirklich bewusst.
Ob sich über so etwas wie die Zukunft der Arbeit, im politischen Sinne, jemand Gedanken macht, der am Watt lebt? Der täglich diese Weite und Stille um sich hat? Der dort womöglich selbständig arbeitet? Denkt der über das Politische in der Arbeit nach?
Ich glaube nicht. Glaube vielmehr, das ist ein Großstädterding. Vielleicht, weil sich in der Großstadt eher die atypischen Lebens- und Arbeitsstile ansiedeln, die Patchwork-Lebensstile. Über meinen Schreibtisch im Büro gehen viele Lebensläufe, und Lebensgeschichten, weil ich für die Personalverwaltung verantwortlich bin. Einige sind da dabei, die früher vielleicht noch als ‚Job-Hopper‘ bezeichnet worden wären. Früher, als es noch normal war, sein Leben lang in einer Firma, in einem Berufsbild, zu bleiben. Heute ist es normaler geworden, mal dies und mal jenes zu tun, mal hier und mal dort gearbeitet zu haben. Der Wechsel ist Standard geworden.
Was steckt dahinter? Sind es die Unsicherheiten des Arbeitsmarktes - oder die persönlichen Unzufriedenheiten und Suchen nach mehr?
Ist es vor allem in der Stadt so, weil die so viele Möglichkeiten bietet? Oder ist es vor allem in der Stadt so, weil ihre Bewohner sich so wichtig nehmen, und immer weiter und weiter wollen? Wichtiger, als Landmenschen es tun, weil denen das große Ganze viel präsenter ist?
Gehöre auch ich dazu, zu diesen Großstädtern, die sich so wichtig nehmen?
In der U-Bahn, mit der ich nach Hause fahre, sehe ich einige von ihnen. Sie wälzen Arbeitspapiere, markern darin herum, mit gerunzelter Stirn. Oder sie telefonieren, und führen Gespräche, in denen in jedem zweiten Satz die Worte ‚Projekt‘ oder ‚Meeting‘ vorkommen. Mir graut, schon wieder. Vor diesem Eindruck, den ich von uns Großstädtern habe:
Hier, in der Großstadt, da nehmen wir uns und alles so wichtig. Unsere Projekte, unsere Arbeit, unsere vermeintliche Unabkömmlichkeit. Dahinter die Angst zu verpassen, oder nicht zu genügen. Und wir übersehen dabei das, was dazwischen existiert, immer existiert, inspiriert, und des Rätsels Lösung gibt: einfach da zu sein. Einfach da sein, reagieren auf das was ist, was kommt, von draußen, weil es rein will, nach drinnen, zu uns.
Das ist Wichtig-Nehmen: aufmerksam sein. Nicht abgelenkt, sondern da sein, präsent sein. Nicht der Körper noch hier und der Geist schon dort.
Ich mag nicht wieder wichtig werden.
Ich mag einfach nur da sein.
Stattdessen stülpt sich der städtische Alltag über mich wie Matsch, wie ein Sumpf aus Verpflichtungen durch den ich wate. Der warme Spätsommer versüßt das nur mäßig. Würde gerne ab und zu die Pausetaste drücken, aber ich finde sie nicht. Lässt sich die Pausetaste nicht aus dem Urlaub in die Stadt importieren? Was hält mich in der Stadt davon ab, ‚nichts’ zu tun? Im Urlaub noch wollte ich mich dem Lebensfluss hingeben. Nun meine ich schon wieder, dagegen anstrampeln zu müssen. Oder habe ich ihn verloren?
Im Norden habe ich das einfache Dasein schätzen gelernt. Einfaches Dasein, mit dem Meer vor der Nase. Nichts anderes machen können und müssen als das, was sich an diesem Ort bietet. An diesem Ort, an dem sich an Persönlichem nur das Notwendigste und Liebste befindet. An dem sich auch das Handeln eingrenzt auf das dem eigenen Leben Wichtigste. Nur.
‚Nur’ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Reduzierung, sondern Essenz.
Am Meer ist so viel Kraft. Pure Energie. Ich ein kleines Element darin, und auch voller Kraft, als würde die überschwappen, durch die Wellen, in die Poren. Infiltriert mit Energie und Kraft, ich. So ganz anders als in der Stadt.
Am Meer bei mir, in der Stadt neben mir.
Dabei ist es doch so elementar, bei sich zu sein. Erschreckend, wie oft ich mich verliere, in meinem Stadtleben, und eben nicht bei mir bin, sondern nur funktioniere. ‚Nur’ diesmal in der Bedeutung der Reduzierung, nicht der Essenz.
Nur zu funktionieren - das ist zu wenig.
Nur da zu sein - das ist Fülle.
Irgendwie werde ich nun den nahenden Winter in Berlin überstehen müssen, ohne seidigen Sand an den Füßen, und ohne funkelnde Salzwassertropfen auf der Haut.
Ich denke immer wieder mal an Marielou in diesem Winter. Wie es ihr wohl geht? Ob sie wiederkommt im nächsten Jahr?
Meine Neugier lässt mich öfter als früher am Haus von den Hansens vorbeigehen, immer in der Hoffnung, vielleicht etwas aufzuschnappen oder zu entdecken, was mir einen Hinweis auf sie geben könnte. Gestern hat es sich tatsächlich gelohnt: Herr Hansen hatte die Post auf dem Gartentisch liegen lassen, darunter war eine Weihnachtskarte von Marielou - ich konnte nicht anders, als die Karte zu lesen.
„Manchmal frage ich mich, ob ich nicht mein Leben umkrempeln sollte: zu Euch in den Norden ziehen, und mir dort einen Job suchen“ stand, neben den Weihnachtsworten, darauf.
Das klingt mir nach genau den Fragen, die aufkommen in dem Alter, in dem Marielou zu sein scheint. Ich kenne das. Mir ging es auch so als ich Mitte Dreißig war: was vorher gut und richtig war, schien es plötzlich nicht mehr zu sein. Was sich vorher fest und überzeugt anfühlte, wurde plötzlich unsicher und hinterfragt. Es fühlte sich an, als würden die Warums und Weshalbs hinter jeder Ecke lauern, an jedem Tag und in jedem Lebensaspekt. Als wolle das Leben noch einmal neu aufgebaut werden. Als sei es nicht schon anstrengend genug gewesen, das aufzubauen, was ist: wollte mein Leben sich noch einmal definieren und neu erschaffen. Leider scheint es dabei oft wie ein quengelndes Kind, das nicht sagt was es will, sondern nur, was es nicht will. Und wenn es etwas will, dann weiß es nicht, wie es das bekommen kann.
Die Menschen nennen dies auch gerne eine ‚Midlife-Crisis‘, und packen ihre Gefühle in diese Schublade. Sie machen die Schublade fest zu, belächeln ihren Inhalt, und tun die Gefühle als nicht ernst zu nehmen ab.
Ich mag keine Schubladen, und das Wort Krise erst recht nicht. Ich sehe mir lieber Marielou an als das, was sie gerade ist: eine Persönlichkeit, die kurz vor der vermutlichen Mitte ihres Lebens angekommen ist. Ist es für diese Persönlichkeit nicht ganz normal nachzufragen, was war, was sein sollte, und was ist? Um daraus abzuleiten, was kommen soll? Ich finde das ist gesund, es ist eine Art von autobiografischer Bestandsaufnahme: welche Träume hatte ich einmal, welche davon wurden Realität, welche nicht? Und wenn nicht, warum? Sind noch nicht verwirklichte Träume noch von Bedeutung, oder im Laufe der Zeit uninteressant geworden? Gibt es Visionen, die erfüllt werden wollen?
Es ist wichtig für ein gutes und glückliches Leben, diese Fragen für sich zu beantworten, und zu überprüfen, was wie wann umgesetzt werden könnte von all dem, was noch auf Umsetzung wartet. Darüber nachzudenken, welche Form und welcher Zeitpunkt sich dafür eignet.
Meist ist es die innere Stimme, die einem das alles verrät.
Jeder Mensch hat seine Antworten, zu seiner Zeit. Wichtig ist, sich Gelegenheit zu geben sich selbst zuzuhören, damit die innere Stimme nicht verstummt, müde und erschöpft vom Überhört-werden. Die Menschen sind so unachtsam gegenüber ihrer inneren Stimme. Dabei ist die doch die weiseste Begleiterin, die der Mensch nur haben kann. Der inneren Stimme zuzuhören ist schwierig, wenn eine Tätigkeit und Verpflichtung der nächsten folgt, wenn der Tagesablauf fest geplant ist, Verantwortungen wahrzunehmen sind, Dinge erledigt werden wollen.
Aber die kann warten, so eine ‚Midlife-Crisis‘. Sie gibt erst Ruhe, wenn sie beantwortet ist, oder wenn sie erstickt wurde. Bevor sie erstirbt, begehrt sie aber erst noch mehrmals kräftig auf; denn sie versucht hartnäckig, ihre Wünsche durchzusetzen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und ich bin gespannt darauf, welche Erfahrungen Marielou damit machen wird.
Ein neues Jahr hat begonnen. Es ist Mai inzwischen. Dass alles gut ist, wie es ist, stimmt nicht mehr. Es stimmte an der Nordsee, im letzten Sommer. Aber nicht in meinem Stadtleben, in diesem Frühjahr. Den Winter über haben sich meine Fragezeichen hinter der Arbeit versteckt, ich habe mehr Zeit im Büro verbracht, als geplant war. Jetzt bin ich wieder bei meiner Teilzeit angekommen, und da tauchen sie wieder auf, die Fragezeichen vom letzten Jahr.
Sie wollen wissen, ob ich zufrieden bin mit meinem Lebensentwurf. Und sie wollen wissen, wie es mit der Marielou weitergeht, die im Norden leben möchte.
Im letzten Sommer entstand diese Idee, mein Leben durch mehrere Reisen in den Norden in Einklang zu bringen. Inzwischen bin ich noch nicht einmal mehr die, die überhaupt in den Norden reist, denn: mir ist das Geld ausgegangen. Knappheit. Immer bei null am Ende des Monats. Die Kehrseite der Teilzeitarbeit, nun spüre auch ich sie: das Teilzeitgehalt reicht für das Existenzielle, aber im Moment nicht für mehr.
Vielleicht habe ich den Winter über auch zu viel für vermeintlich existenziell notwendig gehalten, und das Sparen auf den Sommer im Norden vergessen? Zu verlockend war es oft, mich nach einem anstrengenden Arbeitstag mit etwas besonderem, Käuflichen, zu belohnen. Bei drei bis vier Arbeitstagen pro Woche habe ich das nicht, dieses Bedürfnis nach Belohnung. Da belohnt mich die viele frei verfügbare Zeit.
Ein Sparbuch habe ich noch, eines für ‚Notfälle‘. Aber da ran zu gehen, damit tue ich mich schwer - für einen neuen Aufenthalt an der Nordsee, in diesem Häuschen, an das ich so oft denke?
Andererseits begehrt mit dem beginnenden Sommer auch die Sehnsucht nach St. Peter-Ording enorm auf. Die Sehnsucht danach, den Horizont zu sehen. Die Sehnsucht nach Menschenleere und Wattenstille. Nach Ausbruch aus der engen, vollen Stadt. Nach Alleinsein, mit mir.
Bald habe ich eine Woche Urlaub. Was mache ich damit?
Sehne mich nach einem Wink des Schicksals. Ich nenne das so: wenn etwas passiert, oder mir etwas begegnet, das mir unmissverständlich klar macht, was mein nächster Schritt sein soll. Dieses Etwas kann ein Gesprächsfetzen sein, den ich aufschnappe, oder ein Plakat. Ein Flyer, der irgendwo rumliegt, und auf mich zu warten scheint. Irgendetwas eben, das mir einen Impuls gibt. Die Frau im Zug hat so einen Gesprächsfetzen in mir hinterlassen. Die Frau im Zug auf der Fahrt nach St. Peter-Ording, im letzten Sommer. Komisch, dass ich mich immer noch daran erinnere. Manche Sätze hallen scheinbar sehr lange nach. Sie sagte in ihr Handy etwas von der Angst, die der Freiheit entgegensteht.
Meine Freiheit wäre jetzt ein Urlaub im Norden. Die Angst um meine finanzielle Situation steht ihr entgegen.
Tausche ich Freiheit gegen Sicherheit? Dafür fühle ich mich zu zögerlich. Dazu fehlt mir der Mut. Dafür fehlt mir der Wink des Schicksals.
Früher habe ich mich immer auf ‚das Schicksal’ verlassen – nun bin ich enttäuscht von ihm, weil es sich nicht zeigt. Früher hat sich das Schicksal öfter mal eingemischt in mein Leben. Hat mir Jobs besorgt, oder hilfreiche Kontakte. Hat mir Freunde vorgestellt, uns zusammengebracht. Mit ‚meinem’ Haus im Norden vom letzten Jahr, da hatte es auch seine Finger im Spiel, das Schicksal. Über Linda hat es den Kontakt zwischen mir und der Besitzerin des Hauses, Frau Martens, hergestellt. Und die wiederum hat mich an Herrn Hansen verwiesen. Ohne diesen Kontakt wäre ich nie an meinen Lieblingsfleckenerde auf Eiderstedt gekommen.
Aber jetzt? Wo ist es? Wo ist der Wink, der mich lotst, durch diesen Sommer, mit zu wenig Geld zum Reisen?
Es helfen nur zwei Dinge in dieser Wartezeit: zu tun, was zu tun ist, und einen guten Draht zur inneren Stimme aufbauen. Also los. Schwimme ich weiter im großstädtischen Treiben, meinen Tätigkeiten, und höre mir dabei zu.
Plötzlich prallt etwas hart in meinem städtischen Alltag auf: der Tod. Ein guter Bekannter, einer aus der Arbeitsgruppe, ist mit Anfang fünfzig gestorben. Einfach so, auf einer Dienstreise. Seinen Vortrag hatte er zuvor noch gehalten. Ausgelaugt war er. Ausgelaugt vom vielen Ehrenamt und Engagement, das ihm wohl viel ideelle Anerkennung brachte, umso weniger finanzielle allerdings. Ausgebrannt war er, und ausgelaugt. Das Herz hat sich verabschiedet.
Der meldet sich nicht an, der Tod. Er steht überrumpelnd, erschlagend, einfach so da und greift zu.
Visionär war er, auch Hedonist, irgendwie auch Anarchist, und bodenständiger Träumer. Schöne Abende habe ich mit ihm erlebt, zuletzt den im indischen Restaurant. Er kippte den Gratis-Mangolikör in den Schnaps, den er sich bestellt hatte, weil der Schnaps allein so widerlich schmeckte. Und weil er sehen wollte, wie sich die Mischung verhält. Er hob theatralisch gestikulierend die Arme und rief „es lebe das Proletariat“ als ein Obdachloser das Restaurant betrat und fragte, ob er die Toilette benutzen könne. Er schwärmte von seinem verfallenen Schloss in Tschechien, zu dem ich in diesem Sommer unbedingt mit sollte, nicht zuletzt, weil er mich endlich mal vögeln wollte, was er - frank und frei wie immer - offen kundtat. Abende mit ihm waren einfach immer fantastisch, amüsant und inspirierend.
Nun, genau drei Wochen nach dem Restaurantbesuch, ist er tot. Habe die Todesnachricht per E-Mail erhalten. Gruselig ist das. Inmitten von Spam und Newslettern steht der Tod eines Menschen, den ich auf die uns eigene Weise lieb hatte und sehr schätzte. Aber es gibt nun mal weder den geeigneten Zeitpunkt, noch die geeignete Mitteilungsart, für eine solche Nachricht.
Und jetzt das Gedankenchaos: schöpfe ich alles aus, was das Leben mir anbietet? Gehe ich verschwenderisch, womöglich geringschätzend, mit seinen Angeboten um? Verpasse ich zu viel, lehne ich zu viel ab? Warum setze ich so manches, von dem ich träume, nicht schneller um?
Vielleicht bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit ...
Sentimentalitäten der Trauerphase? Oder sind nicht genau das die Fragen, die wir uns täglich stellen sollten? Dann ist das hier gerade gar kein Gedankenchaos, sondern Klarheit.
Vor Jahren fuhr ich einmal mit einer Freundin, in deren Auto, im Berliner Umland an Rapsfeldern entlang. Sie fuhr viel zu schnell, und die Rapsfelder wurden zu gelber, strukturloser Fläche. Ich ging davon aus, dass es gleich kracht, und Es zu Ende ist. Mein Geist hob irgendwie ab, Bilder meines Lebens zogen an mir vorbei im Schnelldurchlauf, und ich weiß noch, dass ich dachte:
„Ich habe alles ausgekostet und ausgeschöpft in meinem bisherigen Leben - alles ist gut. Schade nur, dass ich Tim nicht mehr erzählen kann, wie schön dieser Tag war.“
Es krachte nicht. Aber für dieses Erlebnis bin ich noch heute dankbar. Ich habe daraus meine ‚Rapsfeld-Theorie‘ erschaffen:
An dem Tag meines Lebens, der mein letzter sein wird, möchte ich nicht denken müssen „hätte ich doch ...“.
Und dieser Tag kann immer sein. Heute, morgen, übermorgen. Wie damals, bei den vorbeiziehenden Rapsfeldern, möchte ich auch jetzt, in jedem Moment, mein Leben so führen, dass ich beruhigt sein kann es ausgeschöpft zu haben. Gelingen aber, tut das nicht immer. Leider gibt es dennoch Lebensphasen, in denen ich ‚das Rapsfeld’ fürchte. Weil etwas in der Pipeline der Umsetzung hängt, was ich mich noch nicht traue.
Vielleicht sollten wir alle unsere Schnäpse mischen, wenn sie einzeln nicht schmecken, und sehen, wie sich die Mischung verhält.
Die Nachricht vom Tod hat gedankliche Konsequenzen, als wäre ich im Watt: sie öffnet mir die Augen, erweitert mein Blickfeld, und zwingt mich hinzusehen, auf die vielen Möglichkeiten, die ich habe. Diese Nachricht schleudert mich mit beiden Beinen auf den Boden und fragt:
„Was willst du? Tu es!“
Dabei ist das letzte ‚Tu es’ noch gar nicht lange her. Habe mich wieder tätowieren lassen, nach einer Ewigkeit des Wünschens. Über die alten Tattoos bin ich noch heute glücklich - warum nicht also ein neues? Meine Tattoos sind wie Marker, die ich mir gesetzt habe, über Jahre verteilt. Jedes einzelne erinnert mich an bestimmte Phasen meines Lebens, Erlebnisse, Vorkommnisse, die mich geprägt haben. Aufgezeichnete Fragmente einer Lebensgeschichte, individuell und subjektiv deutbar nur. Vor ein paar Wochen kam ein neues dazu: das, das schon im letzten Sommer am Ordinger Strand durch meinen Kopf geisterte, das ich skizzierte in mein Notizbuch, als ich im Strandkorb saß. Dieses neue Tattoo markert die Phase meines Lebens, in der ich ‚meinen’ Ort an der Nordsee gefunden habe, den Ort, der mir das Herz erwärmt, der mich willkommen hieß, an dem ich sein will, immer und immer wieder.
Eine neue Heimat kam dazu, zu meinem Leben. Ein neuer Hafen, den ich neben meinem Zuhause in Berlin gerne ansteuere. Das neue Tattoo ist ein Anker. Symbol der Hoffnung.
Ohne Anker, ohne Hoffnung, entsteht kein Handeln. Die Hoffnung ist wie ein Motor, ein Antrieb. Schiffe haben meist mehrere Anker, für die unterschiedlichen Anlässe und Vorkommnisse, auf rauer, oder ruhiger See. Mein Leben auch: hat mehrere Anker, die ich dort auswerfe, wo Sinn und Leidenschaft für das Tun spürbar sind. Und die ich auch wieder einholen kann, wenn es Zeit ist, die Reise fortzusetzen ...
Die Reise jetzt, in diesem Frühsommer, wohin soll sie gehen?
Das aktuelle „Was willst du? Tu es!“ - was ist das?
Die Zeit jetzt ist überlagert vom Tod. Kein freier Kopf für eigene Pläne. Die Arbeitsgruppe trifft sich wieder. Nicht um über die Zukunft der Arbeit zu diskutieren diesmal, sondern um den Tod eines engagierten Mitstreiters zu verkraften. Zu versuchen, ihn zu verkraften. Um einen Nachruf zu schreiben. Um es zu teilen: das nicht fassen können und annehmen müssen.
Ich bezweifle, ob meine Art zu trauern die gemeinsame ist. Lieber tue ich das allein, mit meinen Erinnerungen an ihn, nicht mit fremden. Die Gedenkfeier im großen Kreis lasse ich aus. Dass ich an ihn denke, egal wann und wo, das zählt.
Und er, zusammen mit seinem Tod, er schleicht in meinem Denken herum, überall. Verwirrt es, reißt Schubladen auf, weggeschobene Gedanken raus, als wolle er mein Gehirn entrümpeln. Habe Angst, nicht das aufzugreifen, was sich mir bietet. Nicht das aufgegriffen zu haben, was sich mir geboten hat.
Panik ob potenzieller vertaner Chancen breitet sich in mir aus.
Was ist mein Lebensentwurf? Was treibt mich um? Was treibt mich an? Reicht es aus, achtsam gegenüber möglichen Veränderungen im Leben zu sein? Reicht es aus, darauf zu warten, dass sie anklopfen? So habe ich mir das im letzten Sommer zusammengereimt. Jetzt frage ich mich, ob ich nicht doch selbst mehr Veränderung anstoßen sollte?
Die Zeit kommt mir so unwirklich vor. Ist das, was alles passiert, und nicht passiert – ist das mein Leben?
In wenigen Jahren werde ich vierzig. Und frage mich, ob das überhaupt meine Lebensweise ist, so wie ich hier lebe, in der Großstadt, in der vieles so anders ist als in einer Kleinstadt: kopfgrenzenloser, individueller, chaotischer, provisorischer, unzensierter. Aber eben auch laut, und voll. Fern von Natur, und fern meiner Authentizität.
Zweifle. Als würde mich dieser Zwiespalt einfach ständig begleiten: Stadt oder Land?
Heute ist die Beerdigung des verstorbenen Bekannten, da graut mir eigentlich davor. Vielleicht wird sie mich aber auch zurechtrücken. Ich werde hingehen, ob ich will oder nicht.
Schon so oft bin ich an diesem Friedhof vorbeigefahren. Nie habe ich ihn besucht. Inmitten der Stadt, nahe dem Alexanderplatz, liegt er, umrahmt von weinbewachsenen Backsteinmauern. Hinter ihnen ist vom Stadtlärm fast nichts mehr zu hören. Der Friedhof saugt den Lärm einfach auf. Ein sehr alter Friedhof, mit einer Kapelle, in der es riecht, wie es in einer sehr alten Kapelle riecht: nach altem Gemäuer, Blütenduft und Kerzenwachs. Die Atmosphäre voller Trauer. Tag für Tag befinden sich trauernde Menschen hier drin. Es ist, als würde das Gemäuer ächzen unter der Last der Tränen und leidvollen Gedanken, die sich in ihm stauen. Und als würde es zugleich all dies tragen können und aufsaugen in sich.
Ich bin froh, als es heraus geht, wieder ins Grün des Friedhofs. Durch den alten Baumbestand blinzelt die Sonne, und blauer Himmel. Unwirklich in einer Beerdigungssituation. Und doch stehe ich da, und betrachte die Endlichkeit des Lebens. Sie scheint in mich hineinzukriechen, diese Endlichkeit, durch den erdigen Friedhofsboden meine Beine entlang bis ins Gehirn. Da klopft sie an, und fragt:
„Weißt du denn immer noch nicht, was du zu tun hast?“
Nach dem Zeremoniell verlasse ich die Trauernden. Gehe über den Friedhof, durch seine Stille. Neben mir, noch immer, die Endlichkeit, die auf eine Antwort wartet. Die mir nun klar wird, so klar. Ich stehe auf diesem Friedhof, eine Woche Urlaub vor mir, und habe keine Zweifel mehr: ich muss wieder nach St. Peter-Ording. Ja, ich habe wenig Geld zurzeit. Aber ein Sparbuch. So eines, zu dem die Eltern immer gesagt haben: falls Du mal einen besonderen Wunsch hast. Ich habe ein Sparbuch, mit Geld darauf. Ich bin auf einer Beerdigung, und erlebe die Endlichkeit des Lebens. Und da überlege ich, ob ich es mir leisten kann, ein paar Tage zu verreisen?
Es ist als würde diese Beerdigung mich wachrütteln: worauf will ich noch warten? Worauf will ich noch sparen? Auf die Zukunft?
Das, was ich heute Zukunft nenne, ist nicht mehr die Art von Zukunft, von der meine Eltern sprachen, als sie mir mein Sparbuch anlegten. Diese Zukunft findet jetzt gerade statt.
Wenn ich jetzt von Zukunft spreche, dann begebe ich mich Richtung Reife, nicht mehr Richtung Erwachsen-Werden.
Das bin ich schon.
Vielleicht heute geworden.
Das Wetter ist heute so sonnig und klar, geschmückt mit frischem Wind, dass ich mich an die Küste versetzt fühle. Ich weiß: ich will, nein, ich muss, wieder nach St. Peter-Ording.
Zwei Stunden später rufe ich Herrn Hansen an. Das Häuschen ist vermietet, aber bei ihm ist noch eine Ferienwohnung frei: von Sonntag bis Samstag, fünf ganze Tage, werde ich im geliebten Land sein.
Die Entscheidung fühlt sich absolut gut und richtig an. So selbstverständlich, dass ich gar nicht zappelig freudig bin, sondern plötzlich ganz ruhig werde. Als würde ich das Selbstverständlichste tun, was ich nur tun könnte:
Pendeln, zwischen Stadt und Land. Nicht nur im Kopf, sondern auch in der Tat.
Heute auf dem Wochenmarkt stand Frau Hansen hinter mir in der Schlange vor einem Stand und unterhielt sich mit einer Bekannten.
„Die junge Frau aus Berlin, die im letzten Jahr allein im Haus von Frau Martens war, hat sich spontan für Sonntag angekündigt“ erzählte sie.
Mein Herz hat Freudensprünge vollführt: das kann nur Marielou sein. Sonst war im vergangenen Jahr keine Frau allein in dem Haus. Aber warum nur hat sie so kurzfristig gebucht? Wenn selbst ich bereits im letzten Jahr wusste, dass sie wiederkommen wird: wusste sie selbst es denn nicht? Ob ihr das Geld fehlte für eine frühere Entscheidung? Sie wirkte nicht gerade wie eine, die in Geld schwimmt ...
Ich weiß noch, wie ich für meine ersten Urlaube auf Eiderstedt meine letzten Ersparnisse zusammengekratzt habe. Dabei hat mir immer mein Sicherheitsdenken reingeredet:
„Brauchst du das Geld nicht für etwas Wichtigeres?“
„Eiderstedt ist etwas unglaublich Wichtiges für mich“, habe ich ihm geantwortet.
Später, als ich zur Großverdienerin wurde, hätte ich zwar genügend Geld für viele Reisen gehabt, aber ich hatte die Zeit dafür kaum mehr.
Es mag ja ganz vernünftig sein, die eigene Existenz nicht zu gefährden finanziell. Aber andererseits nützen Wünsche nichts, wenn man sie sich gleichzeitig versagt, oder wenn man sich nicht traut, sich an ihre Umsetzung zu machen. Ein zu ausgeprägtes Sicherheitsdenken ist wie eine selbstgemachte Blockade des eigenen Lebensflusses. Und was soll das überhaupt sein: Sicherheit? Wie sind ihre Maßstäbe? Wo beginnt sie vorhanden zu sein, und wo endet sie? Ein Maximum von Sicherheit oder eine Vollendung des Sicherheitsgefühls gibt es nicht, denn dafür beinhaltet das Leben zu viele Unwägbarkeiten. Niemand kann hundertprozentige Sicherheit versprechen, und niemand kann sie sich selbst erschaffen.
Wenn es so ist wie ich vermute - dass Marielou noch sehr im Sicherheitsdenken verhaftet ist - wovor hat Marielou eigentlich Angst? Sie hat doch einen Job, das stand zumindest auf ihrer Weihnachtskarte, die ich im Winter gelesen hatte. Also hat sie ein regelmäßiges Einkommen, und das allein bietet schon so viel Sicherheit, von der andere nur träumen können. Ist Marielou knauserig, sparsam, geizig? Das wäre schade. Denn Geiz blockiert den Lebensfluss, und wenn das Leben nicht fließt, ist es erstarrt. Dafür ist Marielou nicht der Typ, vermute ich.
Ich selbst übrigens erst recht nicht.
Früher, in meinem alten Leben, habe ich sehr auf den Wink des Schicksals gesetzt, wenn ich vor der Entscheidung stand Geld für etwas auszugeben oder nicht. Ich brauchte ihn noch, als meine innere Stimme noch nicht so klar und deutlich zu mir gesprochen hat, wie sie es heute tut. Manchmal hat mich ein Wink des Schicksals tatsächlich an die Endlichkeit des Lebens erinnert - in meinem alten Leben hatte ich immer wieder vergessen, dass die existiert, und ich habe meine Lebenszeit mit unnützem Zeug vergeudet, als gäbe es kein Ende für sie.
‚Carpe diem‘ sagen die Menschen gerne, wie ein lockerer Spruch kommt es unbedacht wirkend von ihren Lippen.
Ich habe den Eindruck, der Begriff ist so ausgelutscht und verbraucht, dass er seine Wirkung verloren hat. Sonst würden die Menschen sich ihn doch viel mehr zu Herzen nehmen, oder? Aber das tun sie nicht. Sie verschleudern ihre Lebenszeit mit unnützem Zeug, als gäbe es kein Ende für sie. Dabei ist, sich immer wieder an die Endlichkeit des Lebens zu erinnern, wie ein Vergleichen von Soll- und Ist-Zustand der eigenen Wünsche und Ideen. Manch einer hat dabei schon festgestellt, dass das Ist dem Soll hinterherhinkt.
Ich vermute, dass bei Marielou bezüglich eines Lebens im Norden das Ist dem Soll hinterherhinkt. Vielleicht ist es ein noch zu träumerisches Bild, das sie davon hat. Aber solange sie sich kein genaueres Bild macht, kommt sie nicht weiter mit ihrer Frage nach dem Nordleben. Was ihr fehlt, ist ein tiefer Blick in die Kultur, in das Wesen der Einheimischen. Sie hat nur den touristischen Blickwinkel, und der kann auch beschönigend sein.
Aber sie entwickelt offensichtlich Energie, mehr darüber herauszufinden, und das ist, was zählt.
Ich freue mich darauf, sie wiederzusehen.