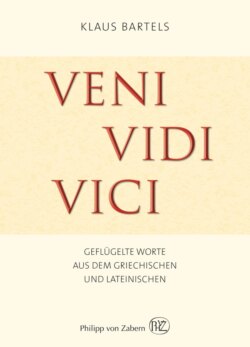Читать книгу Veni vidi vici - Klaus Bartels - Страница 7
A Ω
ОглавлениеἈγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω (Ageometretos medeis eisito). «Keiner, der nichts von Geometrie versteht, trete hier ein!» (in dem Sinne: «Keiner, der nichts von Mathematik versteht, …») Als Inschrift über dem Eingang der Platonischen «Akademie» angeführt bei Elias, Kommentar zu Aristoteles, Kategorien, in: Commentaria in Aristotelem Graeca, Band 18, S. 118, Zeile 18f.; ähnlich vorher bei Philoponos, Kommentar zu Aristoteles, De anima, in: Commentaria in Aristotelem Graeca, Band 15, S. 117, Zeile 27 (Ἀγεωμέτρητος μὴ εἰσίτω) und später bei Tzetzes, Historiarum variarum chiliades 8, 249, 973 (Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μον τὴν στέγην, «… betrete mein Haus»). Wenn die erst in der Spätantike bezeugte Inschrift erfunden ist, so ist sie gut erfunden: Die Mathematik und besonders die Geometrie, die den Blick von den vielerlei mehr oder weniger genau, größer oder kleiner gezeichneten Kreisen auf die eine unvergängliche Idee des Kreises lenkt, galt Platon als die unabdingbare Vorschule der philosophischen Dialektik, vgl. besonders Staat 7. 522 Cff.
Ἄγνωστος ϑεός (Agnostos theos). «Unbekannter Gott.» Lukas, Apostelgeschichte 17, 23, aus dem Anfang der Rede des Apostels Paulus auf dem athenischen Areopag: «Denn als ich durch eure Stadt ging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Inschrift stand: Dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch.»
Ἄγραφος νόμος (Agraphos nomos). «Ungeschriebenes Gesetz.» Der Begriff des «ungeschriebenen Gesetzes» begegnet zuerst in einem bei Andokides, Rede über die Mysterien 85ff., angeführten Solonischen Gesetz, das die Anwendung nicht schriftlich aufgezeichneter und öffentlich bekanntgemachter Gesetze ausschloß. In der Folge deutet der Begriff insbesondere auf das in der Natur begründete, besonderer Bestätigung nicht bedürftige «Naturrecht»; so bei Sophokles, Antigone 454f., wo Antigone sich gegenüber Kreons Gebot, den Leichnam des toten Polyneikes nicht zu bestatten, sondern den Vögeln und Hunden zu überlassen, auf die «ungeschriebenen, niemals wankenden Satzungen der Götter» (ἄγραπτα κἀσφαλῆ ϑεῶν/νόμιμα) beruft, und bei Thukydides, Peloponnesischer Krieg 2, 37, 3, wo Perikles in seiner Rede auf die Gefallenen den von den Archonten erlassenen Gesetzen die «ungeschriebenen» zur Seite stellt, die, wenn sie übertreten werden, «nach allgemeinem Urteil Schande bringen» (… ὅσοι ἄγραφοι ὅντες αἰσχύνην ὁμολουένην φέρουσιν).
Ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι (Aei gar eu piptusin hoi Dios kyboi).«Denn allemal gut fallen die Würfel des Zeus.» Sophokles, in: Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Fragment 809. Der in einem Scholion zu Euripides, Orest 603, dem Sophokles zugeschriebene, vielfach auch sonst – ohne Nennung eines Autors – angeführte Vers war nach dem Zeugnis des Eustathios, Kommentar zu Homers Ilias, S. 1084, Zeile 2f., und zur Odyssee, S. 1397, Zeile 18, «sprichwörtlich» geläufig.
(Κἀν βροτοῖς)/αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι (Kan brotois/hai deuterai pos phrontides sophoterai). «(Und bei uns Menschen sind) die zweiten Gedanken irgendwie die klügeren.» Euripides, Hippolytos 435f.; die Amme zu Phädra. Cicero, 12. Philippische Rede 2, 5, zitiert den offenbar geläufigen Vers in lateinischer Version: Posteriores enim cogitationes, ut aiunt, sapientiores solent esse, «Die späteren Gedanken sind ja, wie man sagt, gewöhnlich die klügeren»; in einem Brief an seinen Bruder Quintus, 3, 1, 18, spielt er mit den zwei griechischen Worten δευτέρας φροντίδας locker auf den Euripidesvers an. Vgl. Errare humanum est, unten S. 65.
Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων/μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυέμεν (Aien aristeuein kai hypeirochon emmenai allon/mede genos pateron aischynemen). «Immer der Beste zu sein und überlegen zu sein den anderen und dem Geschlecht der Väter nicht Schande zu machen.» Homer, Ilias 6, 208f.; der lykische Heerführer Glaukos zitiert die Mahnung, mit der sein Vater Hippolochos, der Sohn des Bellerophontes, ihn in den Trojanischen Krieg ausgesandt hatte. Der erste der beiden Verse erscheint Ilias 11, 784 noch einmal; dort erinnert Nestor den Patroklos an die Mahnung, mit der Peleus seinen Sohn Achilleus in den Krieg ausgesandt hatte. Cicero führt das Mahnwort in einem Brief an seinen Bruder Quintus, 3, 5, 4, leicht variiert in griechischer Sprache an.
Ἀλλ ’ἦ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐv γούνασι κεῖται (All’ etoi men tauta theon en gunasi keitai). «Aber wahrhaftig! Das liegt nun im Schoße der Götter.» Ein Homerischer Formelvers; Ilias 17, 514; Odyssee 1, 267 und öfter.
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον … (Andra moi ennepe, Musa, polytropon …) «Den Mann nenne mir, Muse, den vielgewandten …» Homer, Odyssee 1, 1; der Anfang der Homerischen «Odyssee», des – nach der «Ilias» – zweitältesten Werks der europäischen Literatur: «Den Mann nenne mir, Muse, den vielgewandten, der gar viel umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt zerstörte …» Homer kannte erst eine einzige Muse; zum Abschluß des Musenanrufs in Vers 10 wird sie noch einmal angesprochen: «Davon …, Göttin, Tochter des Zeus, sage auch uns!» Der Name des «vielgewandten», listenreichen Odysseus wird erst in der folgenden Götterszene genannt.
Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων (Anegnon, egnon, kategnon). «Ich habe gelesen, ich habe verstanden, ich habe verworfen.» Kaiser Julianus Apostata, der vom Christentum «Abtrünnige», in einem (nicht datierbaren) Brief an die führenden christlichen Bischöfe, bei Sozomenos, Kirchengeschichte 5, 18, 7. Wie Sozomenos weiter berichtet, erwiderten die Bischöfe: «Du hast wohl gelesen, aber nicht verstanden; denn wenn du verstanden hättest, hättest du nicht verworfen.» Das kaiserliche Verdikt ist der prägnanten Kürze des Caesarischen Veni vidi vici(unten S. 176) nachgebildet.
Ἄνϑρωπος μέτρον ἁπάντων (Anthropos metron hapanton). «Der Mensch ist das Maß aller Dinge.» Der sogenannte «Homo-mensura-Satz» des Protagoras, des Archegeten der griechischen Sophistik (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 1). Der Eingangssatz der – verlorenen – Schrift «Wahrheit» ist im Wortlaut und vollständig zitiert bei Sextus Empiricus, Adversus mathematicos 7, 60, und bei Diogenes Laërtios, Leben und Lehre der Philosophen 9, 51: Πάντων χρημάτων μέτρον (ἐστὶν) ἄνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων, ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν, «Aller Dinge Maß ist der Mensch, sowohl der seienden, daß (wie) sie sind, als auch der nicht seienden, daß (wie) sie nicht sind». Zitate in abhängiger Rede finden sich bereits bei Platon, Kratylos 385 Ef. (nur der erste Teil) und Theaitetos 152 A. An der zweiten Stelle erklärt Platon dazu: «Er meint es doch ungefähr so: Wie die einzelnen Dinge mir erscheinen, so sind sie für mich, und wie sie dir erscheinen, so sind sie wiederum für dich: Ein Mensch bist du doch so gut wie ich?» Vgl. noch die sarkastischen Bemerkungen im «Theaitetos» 161 Cff. und die Platonische Gegenthese in den «Gesetzen», 4. 716 C: Ὁ δὴ ϑεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον ἂν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον ἤ πού τις, ὥς φασιν, ἄνϑρωπος, «Der Gott also wäre uns wohl am ehesten das Maß aller Dinge, und er viel eher als etwa, wie sie sagen, irgendein Mensch».
Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσός … (Ariston men hydor, ho de chrysos …) «Das Beste ist das Wasser, und das Gold …» Pindar, Olympische Oden 1, 1. Die Eingangsworte des Siegesliedes für Hieron von Syrakus, Sieger mit dem Rennpferd im Jahre 476 v. Chr.
Ἀρχὴ ἥμισυ παντός (Arche hemisy pantos). «Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.» Bei Platon, Gesetze 6. 753 E, und Aristoteles, Politik 5, 4. 1303 b 29, ist der Satz als «sprichwörtlich» geläufig angeführt. Platon steigert das Wort an der Stelle noch über die «Hälfte» hinaus: Τὸ δ’ ἔστιν τε, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, πλέον ἢ τὸ ἥμισυ, «(Ein guter Anfang) ist aber sogar, wie mir scheint, noch mehr als die Hälfte». Aristoteles, Nikomachische Ethik 1, 7. 1098 b 7, zitiert das Wort in der gleichen zugespitzten Fassung: Δοκεῖ γὰρ πλεῖον ἢ ἥμισυ τοῦ παντὸς εἶναι ἡ ἀρχή, «Denn der Anfang scheint noch mehr als die Hälfte des Ganzen zu sein». Vgl. Aristoteles, Sophistici elenchi 33. 183 b 22f.: «Das Wichtigste ist vielleicht der Anfang von jeder Sache.» Durch Horaz ist das Wort auch im Lateinischen zum Geflügelten Wort geworden; vgl. Dimidium facti, qui coepit, habet, unten S. 56.
Αὐτὸς ἔφα (Autos epha). «Er selbst hat es gesagt.» Die alles bekräftigende oder auch widerlegende unwiderlegliche Formel, mit der die Mitglieder des Pythagoreischen Ordens, besonders die traditionalistischen «Akusmatiker», sich auch sachlichen Einwänden gegenüber auf die Autorität des Ordensgründers, des alten Pythagoras «selbst», zu berufen pflegten, so angeführt bei Clemens Alexandrinus, Stromata 2, 5, 24; vgl. Diogenes Laërtios, Leben und Lehre der Philosophen 8, 46. Cicero, De natura deorum 1, 5, 10, und Quintilian, Lehrbuch der Rhetorik 11, 1, 27, zitieren die Formel in der gleichbedeutenden lateinischen Version Ipse dixit.
Γηράσκω δ’ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος (Gerasko d’ aiei polla didaskomenos). «Ich werde alt und lerne stets noch vieles hinzu.» Ein vielfach – so in dem unter Platons Namen überlieferten Dialog «Amatores», 133 C, und bei Plutarch, Solon 2, 2 und 31, 7 – zitierter Vers aus Solons Elegien, in: Diehl, Anthologia Lyrica Graeca, Fragment 22, 7. Zitate in abhängiger Rede finden sich bereits bei Platon, Laches 188 B und 189 A; Staat 7. 536 D.
Γνῶϑι σεαυτόν (Gnothi seauton). «Erkenne dich selbst!» (in dem Sinne: «Erkenne, daß du ein Mensch bist!») Platon, Protagoras 343 Af. und Charmides 164 Dff. (vgl. auch Philebos 48 C), zitiert die knappe Mahnung neben Μηδὲν ἄγαν, «Nichts im Übermaß!» (unten S. 21), als Inschrift am Apollontempel in Delphi und schreibt sie den Sieben Weisen zu, als eine «gemeinsame Erstlingsgabe ihrer Weisheit» und Weihegabe an Apollon. Nach Pausanias, Reiseführer durch Griechenland 10, 24, 1, standen die beiden Inschriften in der Vorhalle des Tempels. Aristoteles, Rhetorik 2, 21. 1395 a 21f., nennt die Mahnung als ein Beispiel für «im Volk geläufige Worte» (δεδημοσιευμένα). Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 63, Zeile 25), eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Lakedämoniers Chilon. An der genannten Stelle des Platonischen «Charmides» wird die Kardinaltugend der σωϕροσύνη der «Besonnenheit», als ein «Sich-selbst-Erkennen» definiert und der Appell «Erkenne dich selbst!» als ein Aufruf zu solcher «Besonnenheit», das heißt zu maßvollem Denken, Reden und Handeln erklärt. Der alte Weisheitsspruch «Erkenne dich selbst!» erinnert im Sinne der delphischen Theologie an das allseits eng begrenzte Maß der Menschendinge; er fordert nicht etwa, im Sinne der modernen Psychoanalyse, zur Bewußtmachung und Verarbeitung persönlicher Erlebnisse auf. Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. hatte der Tragiker Ion die delphische Inschrift zitiert (bei Plutarch, Consolatio ad Apollonium 28. 116 D; in: Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Fragment 55): Τὸ Γνῶϑι σαυτόν, τοῦτ’ ἔπος μὲν οὐ μέγα,/ἔργον δ’ ὅσον Ζεὺς μόνος ἐπίσταται ϑεῶν, «Der Spruch: Erkenne dich selbst!, dieses Wort ist nicht groß, das Werk aber so groß, daß Zeus als einziger der Götter sich darauf versteht». Weitere Zitate der beiden anfangs genannten Inschriften bei Plutarch, De E apud Delphos 2. 385 D; De Pythiae oraculis 29. 408 E; De garrulitate 17. 511 B. Vgl. die lateinische Version Nosce te ipsum, unten S. 111.
Δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν (Dis kai tris to kalon). «Zweimal und dreimal das Schöne!» (in dem Sinne: «Nicht nur einmal, sondern vielmals das Richtige sagen und tun»). Platon, Gorgias 498 E und Philebos 59 Ef., zitiert die Aufforderung als «sprichwörtlich» geläufig; ein Scholion zu der erstgenannten Stelle führt das Sprichwort auf Empedokles zurück (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 25): Καὶ δὶς γάρ, ὃ δεῖ, καλόν ἐστιν ἐνισπεῖν, «Denn auch zweimal ist, was geboten ist, schön zu verkünden».
Δός μoι ποῦ στῶ, καὶ κινῶ τὴν γῆν (Dos moi pu sto kai kino ten gen). «Gib mir einen Ort, wo ich stehen kann, und ich bewege die Erde.» Archimedes bei Pappos, Collectio 8, 19, S. 1060, Zeile 3f. Hultsch, bei Simplicius zu Aristoteles, Physik (… πᾷ βῶ, καὶ κινῶ τὰν γᾶν, in: Commentaria in Aristotelem Graeca, Band 10, S. 1110, Zeile 5), und bei Tzetzes, Historiarum variarum chiliades 2, 35,130 (… πᾷ βῶ, καὶ χαριστίωνι τὰν γᾶν κινήσω πᾶσαν) und 3, 66, 62 (… ὅπα βῶ, καὶ σαλεύσω τὰν χϑόνα); vgl. Plutarch, Marcellus 14, 12. Mit der herausfordernd überhöhten Ankündigung, er werde die – im Weltmittelpunkt ruhend gedachte – Erde aus den Angeln heben können, wenn man ihm nur einen festen Standort, eine «zweite Erde», dazu biete, bekräftigt Archimedes seine These, jeder noch so schwere gegebene Körper müsse sich unter Zwischenschaltung einer entsprechenden Untersetzung durch jede noch so geringe gegebene Kraft fortbewegen lassen. Plutarch, Marcellus 14, 12ff., schildert eine spektakuläre Demonstration dieses später zur «Goldenen Regel der Mechanik» erhobenen Satzes vor König Hieron.
Δόσις δ’ ὀλίγη τε ϕίλη τε/γίνεται ἡμετέρη (Dosis d’ olige te phile te/ginetai hemetere).«(Denn von Zeus her sind sie alle, wie die Gastfreunde, so auch die Bettler;) und so gering sie auch ist, so lieb ist doch unsere Gabe» (in dem Sinne: «… so gern wird sie gegeben und genommen»). Homer, Odyssee 14, 58f., wo der treue Sauhirt Eumaios das Wort an den in Bettlergestalt heimkehrenden Odysseus richtet. Der erste Halbvers erscheint auch Odyssee 6, 208, wo Nausikaa ihre Mägde zur Hilfeleistung für den schiffbrüchigen Odysseus aufruft.
Εἶς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσϑαι πάτρης (Heis oionos aristos, amynesthai peri patres). «Ein einziges Vogelzeichen ist das beste: sich zu wehren um die väterliche Erde.» Homer, Ilias 12, 243; Hektor, der Vorkämpfer der Trojaner, zu seinem Landsmann Pulydamas, der ihn unter dem Eindruck eines unglückverheißenden Vogelzeichens (Vers 195ff.) aufgefordert hat, den Angriff auf das griechische Schiffslager abzubrechen. Aristoteles, Rhetorik 2, 21. 1395 a 14, zitiert den Vers als Beispiel für eine «allgemeine Sentenz» (κοινὴ γνώμη), die «bei allen Zustimmung findet»; Plinius der Jüngere, Briefe 1, 18, 3f., erinnert sich daran, wie er sich vor seinem Auftritt in einem heiklen Strafprozeß mit diesem Vers gegen einen unheilverheißenden Traum seiner Schwiegermutter wappnete, «denn Vaterland, und wenn etwas noch teurer ist als das Vaterland, schien mir die Treue». Bei dem Komödiendichter Metagenes, Fragment 18 (in: Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta, Band I, S. 709) ist der Homervers parodiert: … ἀμύνεσϑαι περὶ δείπνου, «… sich zu wehren um das (abendliche) Essen».
Ἔπεα πτερόεντα (Epea pteroenta). «Gefiederte Worte.» Aus dem vielfach wiederholten Homerischen Halbvers … ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, in Vossens Übersetzung: «… sprach er (sie) die geflügelten Worte», zur Einleitung einer wörtlich angeführten Rede, Ilias 1, 201 und öfter. Zugrunde liegt die bildhafte Vorstellung, daß die Worte wie auf Flügeln vom Mund des Sprechenden zum Ohr des Hörenden hinüber «fliegen». Die übertragene Bedeutung des «Geflügelten Wortes» im Sinne eines «geläufigen Zitates» geht auf Georg Büchmanns klassische Zitatensammlung «Geflügelte Worte. Der Citatenschatz des Deutschen Volkes» (1864) zurück.
(Νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν) ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς (Nyn gar de pantessin epi xyru histatai akmes …) «(Denn jetzt) steht es (für uns alle) auf Messers Schneide: (entweder ein sehr trauriges Verderben für die Achaier, oder daß wir leben).» Homer, Ilias 10, 173f.; Nestor zu Diomedes, mit Bezug auf das trojanische Biwak unmittelbar vor dem griechischen Schiffslager. Herodot, Geschichte 6, 11, 2, hat das Wort wiederaufgenommen; dort ruft der phokäische Heerführer Dionysios auf dem Höhepunkt des ionischen Aufstandes, vor dem Fall von Milet im Jahre 494 v. Chr., seine ionischen Landsleute zum Widerstand gegen die Perser auf: Ἐπὶ ξυροῦ γὰρ ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ πρήγματα … ἢ εἶναι ἐλευϑέροισι ἢ δούλοισι, «Denn auf Messers Schneide stehen für uns die Dinge, Männer Ioniens, ob wir freie Menschen bleiben oder zu Sklaven werden».
Ἐργον δ’ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δὲ τ’ ὄνειδος (Ergon d’ uden oneidos, aërgië de t’ oneidos). «Die Arbeit, die ist keine Schande; doch das Faulenzen, das ist Schande!» Hesiod, Werke und Tage 311. Plutarch, Solon 2, 6, zitiert den ersten Teil des Wortes.
Ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἵρη … (Essetai emar, hot’ an pot’ olole Ilios hire …). «Sein wird der Tag, da einst zugrunde geht die heilige Ilios (und Priamos und das Volk des lanzenguten Priamos).» Homer, Ilias 6, 448f.; der trojanische Vorkämpfer Hektor, ein Sohn des Königs Priamos, zu seiner Gattin Andromache, in der Abschiedsszene am Skäischen Tor. Vgl. Ilias 4, 164f., wo der griechische Heerführer Agamemnon diese gleichen Verse im entgegengesetzten Sinne der Siegeszuversicht an den verwundeten Menelaos richtet. Wie Polybios in seinem Geschichtswerk (38, 22) «als Ohrenzeuge» berichtet, hat Publius Cornelius Scipio Aemilianus, vom Untergang Karthagos im Jahre 146 v. Chr. tief erschüttert, angesichts des brennenden Karthago Hektors Worte zitiert und sie «ohne Rückhalt» auf seine eigene Vaterstadt Rom bezogen, «für die er demnach, auf das wechselnde Menschenlos hinblickend, fürchtete». Die Schilderung des Polybios ist bei Appian, Libyke 132, 628ff., überliefert; vgl. Diodor, Bibliothek 32, 24.
Εὕρηκα, εὕρηκα (Heureka, heureka). «Ich hab’s gefunden! Ich hab’s gefunden!» Der Entdeckerruf des Archimedes, bei Vitruv, Lehrbuch der Architektur 9, Einleitung 10: Auf eine Anzeige gegen den Lieferanten eines Weihekranzes hin habe König Hieron II. von Syrakus Archimedes aufgefordert, den Goldgehalt des bereits geweihten Kranzes zu überprüfen, ohne das Weihgeschenk selbst dabei im geringsten anzutasten. Archimedes habe die Lösung des Problems schließlich in einem öffentlichen Bad beim Einsteigen in eine bis zum Rand gefüllte Wanne gefunden: daß er durch Eintauchen des Kranzes in Wasser zunächst dessen Volumen und daraus das Verhältnis des Gewichts zum Volumen bestimmen könne. Glücklich über seine Entdeckung sei der Gelehrte darauf unverzüglich, nackt wie er war, mit dem wiederholten Freudenruf «Heureka! Heureka!» nach Hause gelaufen, um das so entdeckte spezifische Gewicht des zu dem Kranz verwendeten Edelmetalls zu bestimmen und mit dem spezifischen Gewicht reinen Goldes zu vergleichen. Plutarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum 11, 1094 C, zitiert den Ruf, um die Entdeckerfreude des Gelehrten gegen die Gaumen- und Liebesfreuden der Genießer abzusetzen: Kein Feinschmecker, kein Liebhaber werde doch je wie toll mit dem Ruf «Ich hab es geschlürft!» oder «Ich hab sie geküsst!» durch die Stadt laufen.
Ζῷον πολιτικόν (Zoon politikon): siehe Ὁ ἄνϑρωπος ϕύσει πολιτικὸν ζῷον, unten S. 22.
Θάλαττα, ϑάλαττα (Thalatta, thalatta). «Das Meer, das Meer!» Xenophon, Anabasis 4, 7, 24. Der Freudenruf der griechischen Söldner, die sich nach der Schlacht bei Kunaxa nördlich von Babylon im Jahre 401 v. Chr. an die Südostküste des Schwarzen Meeres durchgeschlagen hatten.
Καιρὸν γνῶϑι (Kairon gnothi). «Den (richtigen) Augenblick erkenne!» Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 64, Zeile 12), eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Pittakos von Mytilene. Der «Kairos» bezeichnet den flüchtigen richtigen Augenblick des Sprechens und Handelns, in dem für kurze Zeit möglich wird, was vorher noch nicht und nachher nicht mehr möglich ist. In Olympia war dem vergöttlichten Kairos ein Altar geweiht, wohl nicht zuletzt im Gedanken an die Olympischen Wettkämpfe. Die berühmte Statue des Lysipp stellte den Gott im Laufen dar, wie er mit Flügeln an den Füßen auf Zehenspitzen dahinfliegt, mit einem Haarschopf über der Stirn und einem kahlgeschorenen Hinterkopf (vgl. das Epigramm des Poseidippos, Anthologia Graeca 16, 275). Daher die Redensart «die Gelegenheit beim Schopfe packen»: Wer den Kairos einmal vorübergelassen hat, bekommt ihn von hinten nicht mehr zu fassen.
Κοινὰ τὰ (τῶν) ϕίλων (Koina ta ton philon). «Gemeinsames (Gut) ist das (Gut) von Freunden» oder «… der Freunde». Ein griechisches, in der Spätantike mehrfach den Pythagoreern zugeschriebenes Sprichwort, zuerst zitiert bei Platon, Phaidros 279 C (als das Schlußwort des Dialogs) und Gesetze 5. 739 C, dort herausgehoben als «altes Sprichwort» und maßgebendes, verpflichtendes Leitwort des besten Staates und der besten Verfassung. Weitere griechische Zitate finden sich bei Aristoteles, Nikomachische Ethik 8, 11. 1159 b 31; 9, 8. 1168 b 7f.; Menander, Adelphoi, Fragment 10 Körte. Über die lateinische Version der Menandrischen Komödie ist das griechische Sprichwort auch in Rom geläufig geworden; bei Terenz, Adelphoe 804, führt Micio gegen Demea das «alte Wort» ins Feld: … communia esse amicorum inter se omnia, «… daß alles (Gut) von Freun den unter ihnen gemeinsames (Gut) ist». Weitere lateinische Zitate finden sich bei Cicero, De officiis 1, 16, 51; 2. Rede gegen Verres 2, 36, 89, bei Seneca, De beneficiis 7, 4, 1; 7, 12, 1; Briefe an Lucilius 6, 3; 48, 2f., bei Symmachus, Briefe 9, 106, bei Ambrosius, De viduis 1, 4, und bei Hier onymus, Apologia adversus libros Rufini 3, 39. 485 B. Aristoteles, Politik 2, 5. 1263 a 30ff., bezieht das «Sprichwort» auf eine sinnvolle Verbindung von Gemeineigentum und Privateigentum.
Κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται (Ktema te es aiei mallon e agonisma es to parachrema akuein xynkeitai). «Als ein Besitz für jegliche künftige Zeit eher denn als ein Wettkampf-Glanzstück für den Ohrengenuß im Vorübergehen ist es geschrieben.» Thukydides, Peloponnesischer Krieg 1, 22, 4. Mit einem deutlichen Seitenhieb auf die Effekthascherei in den Redewettkämpfen seiner Zeit erklärt Thukydides am Schluß der Einleitung zu seinem Geschichtswerk: «Zum Zuhören wird vielleicht diese undichterische Darstellung minder ergötzlich scheinen; wer aber das Gewesene klar erkennen will und damit auch das Künftige, das wieder einmal, nach der menschlichen Natur, gleich oder ähnlich sein wird, der mag es so für nützlich halten, und das soll mir genug sein: Zum dauernden Besitz, nicht als Prunkstück fürs einmalige Hören ist es aufgeschrieben.» (Übersetzung: Georg Peter Landmann.) Plinius der Jüngere, Briefe 5, 8, 11, nimmt die Gegenüberstellung auf: Nam plurimum refert, ut Thukydides ait, κτῆμα sit an ἀγώνισμα, quorum alterum oratio, alterum historia est, «Denn es kommt sehr darauf an, wie Thukydides sagt, ob etwas ein Besitz oder ein Wettkampf-Glanzstück ist, wovon das zweite die Rede, das erste das Geschichtswerk ist».
Κύκλος τῶν ἀνϑρωπηων πρηγμάτων (Kyklos ton anthropeïon pregmaton). «Der Kreislauf der Menschendinge» (in dem Sinne: «Der ständige Wechsel von Aufstieg und Niedergang»). Nach Herodot, Geschichte 1, 207, 2, wo der anfangs sprichwörtlich glückliche, schließlich ins Unglück gestürzte Lyderkönig Kroisos zu dem jungen Perserkönig Kyros spricht: … ἐκεῖνο πρῶτον μάϑε, ὡς κύκλος τῶν ἀνϑρωπηίων ἐστὶ πρηγμάτων, περιϕερόμενος δὲ οὐκ ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς εὐτυχέειν, «… mache dir dieses als erstes klar: Es gibt einen Kreislauf der Menschendinge, der läßt mit seinem Umlauf nicht zu, daß immer dieselben im Glück sind». Der nach seinem Sturz am Perserhof verbliebene Kroisos äußert sich zu dem bevorstehenden Feldzug der Perser gegen die Massageten, in dem Kyros den Tod finden wird. Dem strategischen Rat stellt er eine menschliche Lehre voran: «Mein Leid, so unerfreulich es war, ist mir zur Lehre geworden (vgl. Παϑήματα μαϑήατα, unten S. 24). Wenn du meinst, unsterblich zu sein und über ein ebensolches Heer zu gebieten, so wäre es sinnlos, daß ich dir riete. Wenn du dir aber bewußt bist, selbst ein Mensch zu sein und über andere ebensolche Menschen zu gebieten, so mache dir dieses als erstes klar: Es gibt einen Kreislauf der Menschendinge, der läßt mit seinem Umlauf nicht zu, daß immer dieselben im Glück sind». Im lateinischen Mittelalter nimmt dieser Herodoteische «Kreislauf der Menschendinge» die Gestalt der Rota Fortunae, des «Rades der Glücksgöttin», an, so in den Carmina Burana, Nr. 16 und 17. Vgl. die Solonische, gleichfalls an Kroisos gerichtete Mahnung Nemo ante mortem beatus est, unten S. 103.
Λάϑε βιώσας (Lathe biosas). «Lebe zurückgezogen!» Epikur, Fragment 551 Usener. Ein Leitsatz der Epikureischen Ethik; im Unterschied zur Lehre der Stoa rät Epikur von jeglichem öffentlichen und zumal jeglichem politischen Engagement ab. Plutarch hat dem Leitsatz ein Essay gewidmet: «Ist die Maxime: Lebe zurückgezogen! richtig?» Vgl. die entsprechende lateinische Maxime Bene vixit, qui bene latuit, unten S. 44.
Λέγειν τὰ λεγόμενα (Legein ta legomena). «Berichten, was berichtet wird.» Herodot, Geschichte 7, 152, 3. Eine für die Zeitgenossen der Perserkriegszeit heikle Kontroverse – es geht um das Verhalten von Argos gegenüber den Feinden – veranlaßt den «Vater der Geschichtsschreibung» (vgl.Pater historiae, unten S. 123), sich grundsätzlich zur Verantwortung des Historikers gegenüber der Überlieferung zu äußern: Ἐγὼ δὲ ὀϕείλω λέγειν τὰ λεγόμενα, πείϑεσϑαί γε μὲν οὐ παντάπασιν ὀϕείλω, «Ich fühle mich verpflichtet zu berichten, was berichtet wird; alles und jedes zu glauben jedoch fühle ich mich nicht verpflichtet; (und diese Erklärung hier zu soll Geltung haben für meine ganze Darstellung)». – Vgl. die lateinischen Versionen Prodenda, quia prodita (unten S. 132 ) undRelata refero (unten S. 144).
Μέγα βιβλίον μέγα κακόν (Mega biblion mega kakon). «Ein großes Buch ist ein großes Übel.» Kallimachos bei Athenaios, Deipnosophisten, Auszug aus dem 3. Buch, 72 A (Fragment 465 Pfeiffer): … ὅτι Καλλίμαχος … τὸ μέγα βιβλίον ἔλεγεν εἶναι τῷ μεγάλῳκακῷ, «… daß Kallimachos … gesagt habe, das große Buch sei gleich dem großen Übel». Die alexandrinischen Dichter lehnten das Homerische Epos und überhaupt jedes voluminöse literarische Kunstwerk ab und bevorzugten stattdessen die weniger umfangreichen, dafür brillant geschliffenen kleinen Formen wie etwa die des Epigramms.
Μέτρον ἄριστον (Metron ariston). «Das Maß ist das Beste.» Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 63, Zeile 2), eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Kleobulos von Lindos. Vgl. den entsprechenden Weisheitsspruch Μηδὲν ἄγαν, «Nichts im Übermaß!», unten S. 21, und die Horazische Aurea mediocritas, unten S. 41.
Μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον (Me kinein kakon eu keimenon). «Ein Übel, das gut liegt, nicht bewegen» (in dem Sinne: «… nicht aufrühren»). Eine sprichwörtliche Mahnung, in dieser Fassung bezeugt bei Hypereides, Fragment 30 Jensen, zitiert in den Scholien zu Platon, Philebos 15 C. Neben der Anspielung in Platons «Philebos» vgl. die früheren Zitate bei Theognis, Elegische Verse 1, 423, und bei Sophokles, Ödipus auf Kolonos 510f., sowie die Abwandlung Μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα, «Das Unbewegliche nicht bewegen», bei Platon, Gesetze 11. 913 B. Vgl. die lateinische Version Quieta non movere, unten S. 138.
Μηδὲν ἄγαν (Meden agan). «Nichts im Übermaß!» Platon, Protagoras 343 Af., zitiert die knappgefaßte Mahnung neben Γνῶϑι σεαυτόν, «Erkenne dich selbst!» (oben S. 13), als Inschrift am Apollontempel in Delphi und schreibt sie den Sieben Weisen zu, als eine «gemeinsame Erstlingsgabe ihrer Weisheit» und Weihegabe an Apollon. Weitere Zitate bei Platon, Charmides 165 A; Menexenos 247 Ef.; Philebos 45 D. Aristoteles, Rhetorik 2, 21. 1395 a 21f., zitiert den Spruch als ein Beispiel für «im Volk geläufige Worte» (δεδημοσιευμένα. Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 63, Zeile 14) eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Solon von Athen. Vgl. die lateinische Version Ne quid nimis, unten S. 102, den entsprechenden Weisheitsspruch Μέτρον ἄριστον, «Das Maß ist das Beste», oben S. 21, und die Horazische Aurea mediocritas, unten S. 41.
Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος/οὐλομένην … (Menin aeide, thea, Peleïadeo Achileos/ulomenen …) «Den Zorn singe, Göttin, des Peleussohnes Achilleus, den verderblichen …» Homer, Ilias 1, 1f.; der Anfangsvers des ältesten Werkes der europäischen Literatur. Sogleich das erste Wort bezeichnet den Gegenstand des Epos, den Zorn des griechischen Vorkämpfers Achilleus, der im 1. Gesang im Streit mit dem Heerführer Agamemnon ausgelöst und im 24. Gesang in der Begegnung mit dem trojanischen König Priamos beigelegt wird. Die Anrede «Göttin» gilt der Muse; die Dreizahl und schließlich die Neunzahl der Musen ist erst später aufgekommen.
Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς ϑνατῶν τε καὶ ἀϑανάτων/ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον/ὑπερτάτᾳ χειρί (Nomos ho panton basileus thnaton te kai athanaton/agei dikaion to biaiotaton/hypertata cheiri). «Der (geltende, ordnende) Nomos, der König über alle, Sterbliche und Unsterbliche, führt mit sich, es rechtfertigend, das Gewalttätigste, in übermächtiger Hand.» Pindar, Fragment 169, 1ff. Snell, wörtlich zitiert bei Platon, Gorgias 484 B, bei Aelius Aristeides, Rede über die Rhetorik (2), 226, und in den Scholien zu Pindar, Nemeische Oden 9, 35 a. Der unübersetzbare griechische Grundbegriff «Nomos» bezeichnet alles, was allgemein in Geltung steht: Brauch und Sitte, Norm und Regel, Recht und Gesetz; vgl. auch Ἄγραϕος νόμος, «Ungeschriebenes Gesetz», oben S. 9. Im Anschluß an eine Gegenüberstellung griechischer und indischer Bestattungsbräuche erklärt Herodot, Geschichte 3, 38, 4: «… und Pindar scheint mir richtig zu dichten, wenn er sagt, daß der Nomos König über alle sei». In Platons «Gorgias», 484 Bff., sucht Kallikles, ein hitzköpfiger Anhänger des ruhigeren Gorgias, das Pindarwort in den Dienst seiner These vom unein geschränkten Faustrecht des Stärkeren als dem ursprünglichen, eigent lichen «Gesetz der Natur» zu stellen.
Ὁ ἄνϑρωπος ϕύσει πολιτικὸν ζῷον (ἐστίν) (Ho anthropos physei politikon zoon estin). «Der Mensch ist von Natur ein staatenbildendes Lebewesen.» Aristoteles, Politik 1, 2. 1253 a 1ff.: «Daraus ergibt sich nun deutlich, daß die Staatsgemeinschaft zu den naturgegebenen Dingen gehört und daß der Mensch von Natur ein staatenbildendes Lebewesen ist; wer aufgrund seiner inneren Anlage und nicht aufgrund äußerer Umstände außerhalb der Staatsgemeinschaft steht, der ist entweder mißraten oder aber ein Übermensch.» Vgl. Aristoteles, Politik 3, 6. 1278 b 19; Nikomachische Ethik 1, 5. 1097 b 11; 9, 9. 1169 b 18f.
Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνϑρωπος οὐ παιδεύεται (Ho me dareis anthropos u paideuetai). «Der Mensch, der nicht geschunden wird, wird nicht erzogen.» Menander, Sentenzen 573 Jäkel.
Οἶδα οὐκ εἰδώς (Oida uk eidos). «Ich weiß, daß ich nicht(s) weiß.» Nach Platon, Apologie des Sokrates 21 B: Ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοϕὸς ὤν, «Denn ich bin mir doch nicht bewußt, irgend etwas Großes oder Kleines zu wissen» (vgl. auch 21 D und 23 B). Sokrates stellt seine Einsicht in die Nichtigkeit alles menschlichen Wissens, diese spezifisch «menschliche Weisheit» (20 D; vgl. Γνῶϑι σεαυτόν, «Erkenne dich selbst!», oben S. 13), dem vermeintlichen, nicht stichhaltigen Wissen seiner Gesprächspartner gegenüber (21 D): «Im Vergleich zu diesem Menschen bin ich der Weisere. Denn es scheint ja keiner von uns beiden irgend etwas Schönes und Gutes zu wissen; dieser aber bildet sich ein, etwas zu wissen, obwohl er doch nichts weiß; ich dagegen, wie ich nun einmal nichts weiß, bilde mir auch nicht ein, etwas zu wissen. Offenkundig bin ich, verglichen mit diesem, um eben dieses kleine Bißchen weiser: daß ich, was ich nicht weiß, mir auch nicht einbilde zu wissen.»
Οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρνίαη · εἷς κοίρανος, ἔστω,/εἷς βασιλεύς (Uk agathon polykoiranie; heis koiranos esto,/heis basileus). «Nichts Gutes ist Vielherrscherei; einer sei Herrscher, einer König.» Homer, Ilias 2, 204f.; Odysseus zu den Männern aus dem Volk, die, in der Heeresversammlung von König Agamemnon auf die Probe gestellt, «mit wirrem Geschrei» zu den Schiffen davonstürzen. Aristoteles zitiert den Vers zweimal: in der «Politik», 4, 4. 1292 a 13ff., mit der Bemerkung, es sei unklar, welche «Vielherrscherei» Homer hier tadle: eine von Demagogen gelenkte «despotische» Herrschaft der Masse oder eine von gewählten Archonten geführte «demokratische» Herrschaft der Bürger; in der «Metaphysik», 11, 10. 1076 a 3f., zum Abschluß der Abhandlung über den ersten und höchsten Ursprung der Bewegung, den «unbewegten Beweger»: Τὰ δὲ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσϑαι κακῶς. Οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρανίη · εἷς κοίρανος ἔστω, «Das Seiende will keiner schlechten Verfassung gehorchen: Nichts Gutes ist Vielherrscherei; einer sei Herrscher». Plutarch, Antonius 81, 5, überliefert eine Parodie des Verses: Nach der Einnahme von Alexandria im Jahre 30 v. Chr. habe Areios Didymos dem Sieger, dem späteren Kaiser Augustus, mit dem Wortspiel: Οὐκ ἀγαϑὸν πολυκαισαρίη, «Nichts Gutes ist Vielcaesarei», die Beseitigung des jungen Kaisarion, eines Sohnes Gaius Julius Caesars und der Kleopatra, nahegelegt. Wie Sueton, Domitian 12, 3, berichtet, zitierte Kaiser Domitian den Homervers im griechischen Original, um damit seinen Unmut über herrscherliche Allüren eines Verwandten auszudrücken.
Οὔτοι σμνέχϑειν, ἀλλὰ συμϕιλεῖν ἔϕυν (Utoi synechthein, alla symphilein ephyn). «Nicht doch mitzuhassen, sondern mitzulieben bin ich geboren.» Sophokles, Antigone 523; die als Gefangene vorgeführte Antigone zu Kreon. Antigone rechtfertigt die kultische Bestattung ihres Bruders Polyneikes, den Kreon als Landesfeind geächtet hat; auf dem Höhepunkt des zugespitzten Wortstreits erwidert sie auf Kreons Wort, daß der Feind niemals, auch wenn er gefallen sei, zu einem Freunde werde.
Παϑήματα μαϑήματα (Pathemata mathemata). «Leiden sind Lehren.» Nach Herodot, Geschichte 1, 207, 1, wo der anfangs sprichwörtlich glückliche, schließlich ins Unglück gestürzte Lyderkönig Kroisos zu dem jungen Perserkönig Kyros spricht: Τὰ δέ μοι παϑήματα ἐόντα ἀχάριτα υαϑήματα γέγονε, «Meine Leiden, so unerfreulich sie waren, sind mir zu Lehren geworden». Kyros hat den alten Lyderkönig vor seinem Feldzug gegen die Massageten, in dem er den Tod finden wird, zu Rate gezogen; Kroisos erinnert, ehe er auf die strategische Frage zu sprechen kommt, an die «Lehren» seiner «Leiden» und illustriert sie mit dem einprägsamen Bild vom «Kreislauf der Menschendinge» (vgl. Κύκλος τῶν ἀνϑρωπηίων πρηγ μάτων, oben S. 19). Das Herodoteische Wortspiel zitiert ein entsprechendes Wortspiel bei Aischylos, Agamemnon 177, wo der tragi sche Chor die beiden Worte πάϑει μάϑος, «durch Leid Lehre», als das tragische Gesetz anführt, unter dem Zeus «die Sterblichen auf den Weg der Einsicht gebracht» habe. Offensichtlich im Anschluß an das Kroisoswort bei Herodot stellt die «Moral» der Äsopischen Fabel vom Hund und dem Koch (Nr. 254 Perry) fest, … ὅτι πολάκις τὰ παϑήματα τοῖς ἀνϑρώποις μαϑήματα γίνονται, «… daß vielfach die Leiden für die Menschen zu Lehren werden». Eine Anspielung auf das Wortspiel findet sich bei Dionysios von Halikarnass, Antiquitates Romanae 8, 33, 3, in einer Rede des Gnaeus Marcius Coriolanus: … καὶ τἀμὰ παϑήματα παιδεύματα γενήσεται τοῖς ἃλλοις;, «… und werden meine Leiden zu Lehren werden für die anderen?» Ein entsprechendes Wortspiel findet sich in dem neutestamentlichen Brief eines namenlosen Autors an die Hebräer 5, 8.
Πάντα ῥεῖ (Panta rhei). «Alles fließt» (in dem Sinne: «Alles ist im Fluß»). Nach verschiedenen Bezeugungen der Heraklitischen Lehre, so bei Aristoteles, De caelo 3, 1. 298 b 29f.: … τὰ μὲν ἄλλα πάντα πάντα γίνεσϑαί ϕασι καὶ ῥεῖν, «… die anderen Dinge alle seien beständig im Werden, sagen sie, und im Fließen», und Metaphysik 1, 6. 987 a 33f.: … ὡς ἁπάντων τῶν αἰϑητσῶν ἀεὶ ῥεόντων, «… da ja alle wahrnehmbaren Dinge beständig im Fließen seien», und bei Simplicius, Kommentar zu Aristoteles, Physik, in: Commentaria in Aristotelem Graeca, Band 10, S. 1313, Zeile 11: … ὅτι ἀεὶ πάντα ῥεῖ, «… daß beständig alles im Fließen sei». Die prägnante knappe Formel Πάντα ῥεῖ für die Vorstellung eines solchen beständigen Wandels und «Fließens» ist für Heraklit selbst nicht bezeugt; sie ist wohl erst in der Neuzeit aufgekommen. Platon, Kratylos 402 A, zitiert He raklit mit dem schlichten Wort Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, «Alles weicht, und nichts bleibt», und mit dem einprägsamen Bild «Zweimal kannst du wohl nicht in denselben Fluß steigen» (vgl. Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 12, B 49 a und B 91). Lateinische Versionen finden sich bei Ovid, Metamorphosen 15, 177f.: Nihil est toto, quod perstet, in orbe;/cuncta fluunt …, «Nichts ist auf der ganzen Welt, das Bestand hat; alles ist im Fluß …», und vorher, Vers 165: Omnia mutantur, nihil interit, «Alles verwandelt sich, nichts geht zugrunde» (vgl. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, unten S. 163).
(Νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ) πλέον ἥμισυ παντος (Nepioi, ude isasin, hoso pleon hemisy pantos). «(Die Toren! Und sie wissen nicht, um wieviel) die Hälfte mehr ist als das Ganze …» (in dem Sinne: «Weniger wäre mehr»). Hesiod, Werke und Tage 40. Hesiod richtet das Wort an seinen Bruder Perses, mit dem er in einem Rechtsstreit um das Erbe liegt; der Vorwurf der «Torheit» gilt den von Perses bestochenen willfährigen Richtern. Zitate des Wortes finden sich bei Platon, Staat 5. 466 C und Gesetze 3. 690 E.
Ποῖόν σε ἔπος ϕύγεν ἕρκος ὀδόντων (Poion se epos phygen herkos odonton?) «Was für ein Wort entfloh dem Gehege deiner Zähne?» Ein mehrfach wiederholter Homerischer Formelvers; Ilias 4, 350 und öfter.
Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς (Polemos panton men pater esti, panton de basileus). «Krieg ist Vater von allem, König über alles, (und die einen hat er zu Göttern bestimmt, die anderen zu Menschen; die einen hat er zu Sklaven gemacht, die anderen zu Freien).» Heraklit bei Hippolytos, Refutatio omnium haeresium 9, 9 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 53). Der «Krieg» und die Gegenüberstellung der Götter und der Menschen, der Freigeborenen und der Sklaven stehen hier bildhaft für die spannungsvolle «widersprüchliche Harmonie» (Fragment B 51), in der Heraklit das paradoxe, so offenbare wie verborgene Wesen der Welt gesehen hat. Vgl. Πάντα ῥεῖ, «Alles fließt», oben S. 25.
Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνϑρώπου δεινότερον πέλει (Polla ta deina k’ uden anthropu deinoteron pelei). «Viel Ungeheures ist, doch nichts so Ungeheures wie der Mensch». Sophokles, Antigone 332f., am Anfang eines Chorliedes, das die «ungeheuren» Kulturleistungen des Menschen von der Schifffahrt bis zur Heilkunst staunend aufführt, um schließlich vor «Ungeheuerlichkeit» dieses nicht nur zu vielem, sondern auch, wie man sagt, zu allem fähigen Menschen zu schaudern: «In dem Erfinderischen der Kunst eine nie erhoffte Gewalt besitzend, schreitet er bald zum Bösen, bald zum Guten …» (Übersetzung: Wolfgang Schadewaldt.) Das hier mit «ungeheuer» wiedergegebene Adjektiv δεινός (deinos) deutet mit seiner Doppelbedeutung «äußerst befähigt» und «äußerst gefährlich» auf die tragische Verblendung, die den Menschen immer wieder seine Grenzen überschreiten und in dieser Grenzüberschreitung scheitern läßt.
Πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί (Polla pseudontai aoidoi). «Vieles lügen die Dichter.» Der zumal gegen die Homerische Epik und die klassische Tragödie gerichtete Satz ist in dem unter Platons Namen überlieferten Dialog «De iusto», 374 A, und bei Aristoteles, Metaphysik 1, 2. 983 a 3, als ein «altes Sprichwort» angeführt; Plutarch, Quomodo adulescens poetas audire debeat 2. 16 A, zitiert ihn als ein Schlüsselwort für den Umgang mit der Dichtung. Ein Scholion zu der erstgenannten Stelle weist das Wort Solons Elegien zu (daher auch in: Diehl, Anthologia Lyrica Graeca, Solon, Fragment 21). Jedenfalls gehört der Satz in die im 6. Jahrhundert v. Chr. von Xenophanes eröffnete, im 4. Jahrhundert v. Chr. von Platon fortgeführte philosophische Kritik am Götter- und Menschenbild des alten Mythos und der frühen Dichtung, wie es der archaischen und der klassischen griechischen Zeit zumal durch die beiden Homerischen Epen und die Hesiodeische «Theogonie» vermittelt wurde. Vgl. Poetica licentia, unten S. 129.
Πολυμαϑίη νόον (ἔχειν) οὐ διδάσκει (Polymathie noon echein u didaskei). «Vielwisserei lehrt nicht Vernunft (haben), (denn sonst hätte sie Hesiod Vernunft gelehrt und Pythagoras und wiederum Xenophanes und Hekataios).» Heraklit bei Diogenes Laërtios, Leben und Lehre der Philosophen 9, 1, und bei Athenaios, Deipnosophisten 13, 91. 610 B (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 40). Demokrit hat die Kritik übernommen – Πολλοί πολυμαϑέες νοῦν οὐκ ἔχουσιν, «Viele Vielwisser haben keine Einsicht» – und der Heraklitischen «Vielwisserei» eine danach neugeprägte πολυνοίη (polynoïe), «Vieldenkerei», gegenübergestellt: Πολυνοίην, οὐ πολυμαϑίην ἀσκέειν χρή, «Viel zu denken, nicht viel zu wissen sollte einer sich bemühen» (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 64 und 65).
Πρῶτον ψεῦδος (Proton pseudos). «Erster Irrtum» (in dem Sinne: «grundlegender Irrtum»). Aristoteles, Erste Analytik 2, 18. 66 a 16: Ὁ δε ψευδὴς λόγος γίνεται παρὰ τὸ πρῶτον ψεῦδος, «Die irrige Schlußfolgerung ergibt sich entsprechend einem ersten Irrtum» (in dem Sinne: «… infolge eines Irrtums in einer der beiden Voraussetzungen»). Der «erste Irr tum» geht in alle unmittelbar oder mittelbar von ihm abgeleiteten Schlußfolgerungen ein; er kann damit – selbst bei einem völlig einwandfreien Schlußverfahren – zu zahlreichen weiteren Irrtümern führen.
(Ἐπάμεροι · τί δέ τις; τί δ’ οὔ τις) σκιᾶς ὄναρ/ἄνϑρωπος (Epameroi; ti de tis? ti d’ u tis? Skias onar/anthropos). «(Von Tag zu Tag Lebende: Was ist einer? Was ist einer nicht?) Eines Schattens Traum ist der Mensch» (in dem Sinne: «Ein Schatten im Traum ist der Mensch»). Pindar, Pythische Oden 8, 135f. Das griechische Adjektiv ἐπάμερος, attisch ἐϕήμερος, eigentlich: «auf den Tag gestellt», bezieht sich hier nicht wie das davon abgeleitete «ephemer» auf die Kürze des Lebens, sondern auf den Wechsel des Glücks von einem Tag zum anderen.
Τέτλαϑι δή, κραδίη · καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης … (Tetlathi de, kradie, kai kynteron allo pot’ etles …) «Halte denn aus, Herz! Noch Hündischeres anderes hast du schon ausgehalten, (an dem Tage, als mir der Kyklop … die trefflichen Gefährten verzehrte).» Homer, Odyssee 20, 18f.; der in Bettlergestalt heimgekehrte Odysseus zu sich selbst, angesichts der unverschämten Dienerinnen, die lachend an ihm vorübergehen, um mit den Freiern zu schlafen. Der Gedanke – die Erinnerung an überstandenes Ungemach zur Wappnung gegen gegenwärtiges – begegnet mehrfach wieder; so bei Horaz, Satiren 2, 5, 20f. (Fortem hoc animum tolerare iubebo;/et quondam maiora tuli); Oden 1, 7, 30f. (O fortes peioraque passi/mecum saepe viri); Vergil, Aeneis 1, 198f. (O socii …/o passi graviora); Ovid, Tristien 5, 11, 7 (perfer et obdura; multo graviora tulisti …) Vgl. das Vergilische Forsan et haec olim meminisse iuvabit, unten S. 73.
Τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν/ἀϑάνατοι … (Tes d’ aretes hidrota theoi proparoithen ethekan/athanatoi …), «Vor die Tüchtigkeit haben die Götter den Schweiß gesetzt, die unsterblichen …» Hesiod, Werke und Tage 289f. Hesiod stellt seinen Bruder Perses vor die Wahl zwischen Schlechtigkeit und Tüchtigkeit: «Ja, die Schlechtigkeit, die kann jeder glei ch haufenweise sich nehmen, ganz leicht: eben und glatt ist der Weg, ganz nahe bei wohnt sie; doch vor die Tüchtigkeit haben die Götter den Schweiß gesetzt, die unsterblichen; lang und steil ist der Weg zu ihr und rauh zu Anfang; doch wenn er die Höhe erreicht hat, fällt die Tüchtigkeit von da an leicht, so schwer sie sonst auch ist.» Der Sophist Prodikos von Keos hat Hesiods Bilder von dem ebenen, glatten Weg zur Schlechtigkeit und dem steilen, rauhen zur Tüchtigkeit zu der bekannten Erzählung von Herakles am Scheidewege ausgestaltet, die Xenophon, Memorabilien 2, 1, 20ff., im Anschluß an ein Zitat der sechs Hesiodverse in seinen eigenen Worten nacherzählt. Platon, Gesetze 4. 718 E, zitiert die sechs Verse, von dem «geflügelten» Vers 289 an wörtlich, als Zeugnis für die Weisheit des alten Dichters. – Vgl. Per aspera ad astra, unten S. 126.
Τίς πόϑεν εἶς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; (Tis pothen eis andron? Pothi toi polis ede tokees?) «Wer, woher bist du von den Menschen? Wo hast du Heimat und Eltern?» Ein Homerischer, in der «Odyssee» mehrfach wiederholter Formelvers; Odyssee 1, 170; 10, 325 und öfter. Der erste Teil der Frage erscheint auch schon in der «Ilias», 21, 150.
Χρύσεα χαλκείων, ἑκατόβοι’ ἐννεαβοίων (Chrysea chalkeion, hekatomboi’ enneaboion). «Goldene gegen bronzene, hundert-Rinder-werte gegen neun-Rinder-werte.» Homer, Ilias 6, 236. Auf dem Schlachtfeld vor Troja entdecken der lykische Heerführer Glaukos und der griechische Vorkämpfer Diomedes ihre einst von den Großvätern geschlossene, für die Enkel fortgeltende Gastfreundschaft und erneuern die Verbindung durch den Tausch von «Gastgeschenken»: Glaukos tauscht seine goldenen Waffen gegen die bronzenen des Diomedes. Das Wort gilt einem ungleichen Tausch: «Gold gegen Bronze» – so etwa bei Cicero, Briefe an Atticus 6, 1, 22, mit Bezug auf die gewechselten Briefe – oder auch umgekehrt: Χάλκεα χρυσείων, «Bronze gegen Gold».
Ψυχῆς ἰατρεῖον (Psyches iatreion). «Heilstätte für die Seele.» Diodor, Bibliothek 1, 49, 3. Diodor zitiert das Wort – in einer von ägyptischen Priestern übernommenen Beschreibung alter Königsgräber – als Inschrift an der «heiligen Bibliothek» eines legendären ägyptischen Königs Osymandyas. Die Inschrift ΨΥΧΗΣ IATPEION erscheint wieder über dem von Franz Anton Dirr gestalteten barocken Eingangsportal der Stiftsbibliothek St. Gallen aus dem Jahr 1781.
Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε/κείμεϑα τοῖς κείνων ῥήμασι πειϑόμενοι (O xein’, angellein Lakedaimoniois, hoti tede/keimetha, tois keinon rhemasi peithomenoi). «Fremder, melde den Lakedämoniern, daß wir hier liegen, ihren Befehlen gehorsam.» Die von den Amphiktyonen an den Thermopylen angebrachte, bei Herodot, Geschichte 7, 228, 2, ohne Nennung eines Autors angeführte, später dem Simonides zugeschriebene Inschrift zu Ehren der spartanischen Gefallenen. Das Epigramm ehrt den Opfermut der dreihundert Spartaner, die unter ihrem König Leonidas im Jahre 480 v. Chr. die Landenge der Thermopylen in Mittelgriechenland mehrere Tage lang gegen die persische Übermacht verteidigten und schließlich, nachdem eine persische Abteilung durch Verrat in ihren Rücken gelangt war, auf verlorenem Posten zuletzt «mit Händen und Zähnen kämpfend» bis auf den letzten Mann fielen. Das lakonisch knappe Epigramm fordert den Vorüberkommenden auf, den Ephoren in Sparta die Ausführung ihres Befehls zu melden. Weitere Zitate des griechischen Wortlauts finden sich bei Lykurgos, Rede gegen Leokrates 28, 109, bei Diodor, Bibliothek 11, 33, 2, und bei Strabon, Geographika 9, 4, 16 (jeweils mit dem Imperativ anstelle des militärischen Infinitivs und dem Schluß peiyÒmenoi nom€moiw, «ihren Gesetzen gehorsam»). Die Zuschreibung an Simonides erscheint zuerst bei Cicero, Tuskulanische Gespräche 1, 42, 101: In quos Simonides: Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes,/dum sanctis patriae legibus obsequimur, «Auf sie hat Simonides gedichtet: Sage, Fremder, in Sparta, du habest uns hier liegen gesehen, indem wir den heiligen Gesetzen des Vaterlandes Folge leisten». In der Anthologia Palatina, 7, 249, erscheint das Epigramm im Wortlaut Herodots und unter dem Namen des Simonides. Durch Friedrich Schillers Übersetzung in dem Gedicht «Der Spaziergang», Vers 97f., ist das klassi sche Epigramm auch im Deutschen zum Geflügelten Wort geworden: «Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest/uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.»