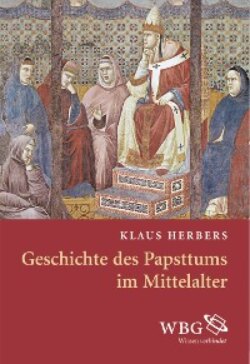Читать книгу Geschichte des Papsttums im Mittelalter - Klaus Herbers - Страница 44
Leo III. – Verfolgter und Coronator Karls des Großen
ОглавлениеAn den Jahren 795–800 lässt sich gut ablesen, wie verschiedene Orientierungen Roms aus dem Gleichgewicht geraten konnten. Der 795 erhobene, neue Papst Leo III. stützte sich auf andere Gruppen als Hadrian I. Als seine römischen Gegner ihn 799 amtsunfähig machen wollten, gelang ihm die Flucht ins Frankenreich. Das Bündnis mit den Karolingern musste seine erste große Bewährungsprobe bestehen. Für das Verhältnis der Päpste zur Stadt Rom zeigen diese Ereignisse, dass trotz aller vorherigen Besuche Karls die Grundstrukturen römischer Politik nicht ohne Weiteres außer Kraft gesetzt werden konnten. Nur ein geschicktes, auf die Führungsschichten Roms Rücksicht nehmendes päpstliches Handeln versprach Erfolg.
Mit Leo III. war ein Außenseiter Papst geworden. Schon früh wurde er in der päpstlichen Umgebung erzogen, stach durch Intelligenz und soziales Engagement hervor. Einen Tag nach dem Tod seines Vorgängers Hadrian I. soll er am 26. Dezember 795 von Klerus und Volk gewählt und am Fest des Evangelisten Johannes (27. Dezember) geweiht worden sein. Die schnelle Erhebung mag andeuten, dass seine Anhänger vielleicht die Gunst der Stunde nutzen wollten, um ihren Kandidaten mit einem Überraschungscoup durchzubringen.
Leo III. übermittelte kurz nach seiner Erhebung Karl dem Großen (768–814) die Schlüssel vom Petersgrab und das Banner der Stadt Rom. Diese Ehrengaben erinnerten Karl zugleich an Rechte und Pflichten für die römische Kirche und den römischen Dukat. Wegen dieser Bindungen des Empfängers bleibt fraglich, ob Leo damit eine „Oberherrschaft“ des Frankenherrschers anerkannte. Jedoch scheint der neue Papst die Anlehnung an die Franken gesucht zu haben, denn gleichzeitig bat er um die Entsendung eines Boten, der den Treueid abnehmen solle. In den – allerdings nicht häufigen – päpstlichen Urkunden und Briefen wurde außerdem zunehmend nach den Herrscherjahren Karls datiert.
Die verschiedenen Baumaßnahmen am Lateranpalast, vor allem am accubitum und am solarium, zeigen jedoch durchaus eigenständige und zugleich römische Impulse Leos III.36 Als programmatisch gelten die im Lateran (triclinium) wohl um 799/800 angebrachten Mosaikbilder, die in barocker Umgestaltung sowie in Nachzeichnungen erhalten sind. In der Apsis werden die Apostel zur Missionierung der Welt entsandt, rechts davon überreicht Christus an Petrus die Schlüssel und an Kaiser Konstantin die Fahne, jeweils Symbole für die geistliche und weltliche Gewalt; dies entsprach der Gelasianischen Zweigewaltenlehre. Links übergibt Petrus analog an Leo das Pallium, an Karl eine Fahne. Petrus selbst hatte demnach beiden, Leo und Karl, den Auftrag zur Herrschaft verliehen.
Die Entsendung der Apostel. Rechts neben der Apsis Christus, Petrus und Konstantin, links Petrus, Leo und Karl. Mosaik im triclinium des Lateran-Palastes, um 796.
Erscheint hier bildlich das päpstliche Programm zum Verhältnis beider Gewalten, das durchaus als konfliktbeladen gelten kann,37 so akzentuiert aus fränkischer Perspektive ein wohl von dem gelehrten Alkuin verfasster Brief Karls, den Abt Angilbert von St-Riquier übermittelte, das Verhältnis anders: „Unsere Aufgabe ist es, allenthalben mit Hilfe der göttlichen Liebe die heilige Kirche Christi gegen Angriffe der Heiden und gegen Verheerung durch Ungläubige mit den Waffen nach außen zu verteidigen und nach innen durch die Erkenntnis des katholischen Glaubens zu stärken. Euch aber, Heiligster Vater, kommt es zu, wie einst Moses, mit zu Gott erhobenen Händen unser Heer zu unterstützen, damit das Christenvolk dank des durch Eure Fürbitte erflehten Segens Gottes über die Feinde seines heiligen Namens immer und überall den Sieg davontrage und der Name unseres Herrn Jesus Christi auf der ganzen Welt verherrlicht werde“.38 In dieser Perspektive unterstützt der Papst vor allem den kaiserlichen Feldherren durch Gebet.
Schwierigkeiten in Rom blieben aber bestehen; ab 798 wird dies aus Briefen Alkuins und Arns von Salzburg besonders deutlich, die sich zu Leos Lebenswandel kritisch äußern. Bei der Letania Maior, der Bittprozession am Markustag (25. April 799), wurde der Papst schließlich von Gegnern überwältigt, wohl unter maßgeblichem Einfluss des primicerius Paschalis, eines Neffen des verstorbenen Papstes Hadrian I., und des Schatzmeisters, des sacellarius Campulus. Alte Netzwerke schienen weiterhin zu funktionieren. Die Reichsannalen und die ausführlichere Leovita im offiziösen Papstbuch berichten aus der Perspektive des Ergebnisses, der Kaiserkrönung Karls. Deshalb wird die Reise des Papstes ins Frankenreich unterschiedlich bewertet.
Nur die Leovita im Liber pontificalis deutet an, dass die Versuche der Gegner, Leo die Augen auszustechen und die Zunge auszureißen, eine wohl geplante Absetzung des Papstes symbolisierten. Die Rückgewinnung des Seh- und Sprechvermögens vermerkt die Vita entsprechend ausführlich als großes Wunder. Aus dieser Perspektive erhielt Leo durch Gott und durch die Fürsprache des hl. Petrus seine Legitimität als Bischof von Rom zurück.39 Erst dann entschied sich der so wieder gerechtfertigte Papst, ins Frankenreich zu reisen; in der päpstlichen Quelle als freier päpstlicher Entschluss, in den Reichsannalen als fränkische Fürsorge dargestellt.40
Leo III. gelangte Mitte September 799 nach Paderborn, das Epos Karolus Magnus et Leo Papa schildert den glänzenden Empfang.41 Auch Leos Gegner kamen dorthin. Jedoch unterscheiden sich die Berichte über die dortigen Verhandlungen. Offensichtlich war die Causa Leonis schwierig. Vielleicht hatten schon vorher karolingische Rechtskundige wie Alkuin und Arn Meinungen ausgetauscht. Zugunsten Leos geltend machen konnten sie vor allem die päpstliche Immunität, den Grundsatz, dass der oberste Stuhl Richter sei, aber nicht gerichtet werde: Prima sedes a nemine iudicatur, so lautete ein auf die Symmachianischen Fälschungen zurückgehender Satz.42
Vielleicht brachte Karl schon in Paderborn ein westliches Kaisertum zur Sprache. Traut man der „Kölner Königsnotiz“, so könnte sogar Byzanz, wo die Kaiserin Irene seit 797 die Herrschaft innehatte, Karl das Kaisertum angeboten haben.43 Die Reichsannalen erwecken den Eindruck von einer Vorbereitungszeit, die vielleicht erklärt, warum Karl erst ein Jahr später als Leo nach Rom zog. Er hatte erst noch zu tun, empfing zum Beispiel weit angereiste Gesandtschaften. Die Annalen zeichneten damit das Bild eines universalen Herrschers, dem nur noch der Kaisertitel fehlte.
Mit fränkischem Geleit gelangte Leo schließlich wohl Ende November 799 wieder nach Rom. Jedoch gab es ein Jahr später in den Wochen vor Karls Kaiserkrönung nochmals rechtliche Klärungen. Der Papst reinigte sich am 23. Dezember 800 durch einen (aus der Distanz betrachtet umstrittenen) Eid.44 Die Zeiträume der Beratungen deuten an, wie hart die vorangegangenen Verhandlungen gewesen sein müssen.
Als Karl im November 800 nach Rom kam, ließ ihn der Papst – in der Perspektive der Reichsannalen – wie einen Kaiser empfangen. Nicht nur im Umkreis Karls gab es Vorstellungen über ein westliches Kaisertum, sondern auch Leo III. hatte seine Sicht über das Verhältnis beider Gewalten zum Beispiel in den schon genannten bildlichen Darstellungen dokumentiert. Wessen Vorstellungen setzten sich schließlich durch, als Leo III. am Weihnachtstag Karl, nachdem dieser sich vom Gebet erhoben hatte, krönte? Die Antwort bleibt kontrovers. Die viel zitierte Bemerkung Einhards in seiner Vita Karls, der Herrscher hätte die Peterskirche an diesem Tag nicht betreten, wenn er von den päpstlichen Absichten gewusst hätte, mag andeuten, dass Form und Ausrichtung der Zeremonie eher der päpstlichen „Regie“ und byzantinischen Traditionen verpflichtet waren und weniger den Vorstellungen Karls und seiner Umgebung entsprachen.45
Leo scheint an diesem Tag bestimmend gewesen zu sein. Nach dem Liber pontificalis „machte“ der Papst den Kaiser, er krönte und salbte. Obwohl bis zum 23. Dezember 800 noch von Karl ausgesprochen abhängig, konnte Leo den Ablauf der Kaiserkrönung offensichtlich stark beeinflussen, obwohl sich die widersprüchlichen Quellen nicht zu einem völlig einheitlichen Bild fügen. Ob der Papst sogar einen neuen Kaiser brauchte, um seine Widersacher wirkungsvoll bestrafen zu können, hängt davon ab, wie verbindlich in Rom das Gesetz beachtet wurde, das um 740 der oströmische Kaiser Leon III. (717–741) und sein Sohn Konstantin V. (741–775) erlassen hatten: Nur der Kaiser dürfe Hochverräter richten. Die erste Amtshandlung des neuen Kaisers war jedenfalls der Prozess gegen die Majestätsverbrecher, die zum Tode verurteilt, aber auf päpstliche Fürsprache hin begnadigt wurden.46
Leo III. unterlag auch nach 800 einem anhaltenden karolingischen Einfluss. Die Verhandlungen über das Kaisertum mit Byzanz führten weitgehend die Karolinger (sogenanntes Zweikaiserproblem); seinen Sohn Ludwig ließ Karl 813 ohne päpstliche Beteiligung zum Mitkaiser erheben. Setzte der Papst aber in kirchlichen Fragen eigene Akzente? Nur bedingt, denn seit den Auseinandersetzungen um den Adoptianismus dominierten fränkische Theologen die Diskussionen des Westens. Karls Theologen blieben auch in der Entscheidung um das filioque, also über die Frage, ob der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgehe, bestimmend. Nach einem Streit im Ölbergkloster bei Jerusalem wandten sich die fränkischen Mönche an Leo III. mit der Frage, ob das filioque im Glaubensbekenntnis unverzichtbar sei. Der Papst hielt an der Tradition fest, das filioque im Glaubensbekenntnis wegzulassen. Für ihn war dies jedoch eine zweitrangige Frage, weil das Credo in Rom nur bei der Taufliturgie gesungen wurde, während es im Frankenreich zu jeder Sonntagsmesse gehörte. Karl der Große ließ von seinen Theologen auf einer Aachener Synode 809 die Verwendung des filioque als rechtmäßig bestätigen.47 Leo III. akzeptierte dies zwar, sprach sich aber gegen eine Einfügung in das Glaubensbekenntnis aus. Auf die Praxis im Frankenreich konnte Leo III. keinen Einfluss ausüben, wenngleich er seine Position deutlich machte, denn wohl schon vorher (wohl 807) hatte er das althergebrachte nicaeano-konstantinopolitanische Symbolum auf zwei Silbertafeln in Griechisch und Lateinisch in der Peterskirche anbringen lassen.48 Langfristig setzte sich dennoch die fränkische Entscheidung auch in Rom durch: Karolingische, nicht römische Festlegungen prägten somit die späteren Auseinandersetzungen zwischen Ost- und Westkirche. Eigenständiges päpstliches Handeln gelang am ehesten, wenn Streitfälle direkt an den Papst herangetragen wurden.
Über diese Entscheidungen wissen wir jedoch kaum etwas aus römischen Quellen, für die Leovita des Liber pontificalis blieb ein Papst vor allem Bischof von Rom. Sind hier Schwerpunkte erkennbar? Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem stadtrömischen Adel werden seine Fördermaßnahmen auf der rechten Tiberseite interessant. Die schon erwähnten scholae peregrinorum bildeten auch Verbindungsglieder zwischen dem orbis christianus und der Ewigen Stadt; ihre Kirchen und ihre Zentren lagen in der Nähe von St. Peter. Dieses Gebiet befestigte Leo III. erstmals mit Mauern und wertete damit einen Teil außerhalb der alten Stadt Rom auf, indem er ihn als eine päpstliche Einflusszone in das Ensemble der Stadt einbezog. Diese Politik setzte nach Leo III. vor allem Leo IV. (847–855) erfolgreich fort. Möglicherweise bezieht sich sogar der Name dieser 852 eingeweihten civitas Leoniana oder Leonina auf Leo III. und nicht auf Leo IV. Mit diesen Maßnahmen versuchte Leo III. vielleicht, alte Strukturen des römischen Stadtadels teilweise aufzubrechen. Von den Scholen der Fremden verweist die schola Saxonum auf Beziehungen zu den Britischen Inseln, die auch durch den sogenannten Peterspfennig unterstrichen werden. 797 soll Papst Leo III. König Offa II. von Mercien als Stifter der Jahresabgabe von 365 Mankusen an den Nachfolger Petri bezeichnet haben.49
Ansonsten berichtet die Leovita fast ausschließlich von Leos Bemühungen um die Kirchen Roms. Neuere Forschungen50 haben das System dieser Schenkungen genauer erfasst und sogar die beschriebenen Bildprogramme auf den Textilien analysiert, die vielleicht sogar theologisch-dogmatische Akzente setzten und diese visualisierten. Geschenke und Reisen banden Rom und das Patrimonium Petri enger an die Päpste; somit handelten diese wie viele andere lokale Machthaber in Italien. Aber der Papst war reicher als viele seiner Konkurrenten: Dies belegen viele Gaben, Kelche, liturgische Bücher oder wertvolle Stoffe. Dass Leo III. besonders großzügig schenken konnte, hing wahrscheinlich auch mit Karls großen Zuwendungen anlässlich der Kaiserkrönung zusammen, zu denen vielleicht Teile des von Karl erbeuteten Awarenschatzes gehörten. Das Bild des jeweiligen Papstes als oberster Schenker in Rom blieb in den Papstviten des Liber pontificalis bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts bestimmend.
Wie sehr der fränkische Einfluss in Rom von der Person Karls abhing, zeigen die Entwicklungen nach Karls Tod (28. Januar 814). Grundsätzlich gewann Leo nun an Bewegungsfreiheit. Als sich neue Adelsverschwörer gegen ihn verbanden, wurden diese 815 ohne kaiserliche Mitwirkung als Majestätsverbrecher verurteilt. Kein Karolinger, sondern der Papst selbst leitete nun den Prozess. Zwar untersuchte Karls Enkel Bernhard († 818), dem 812 die Königsherrschaft über Italien übertragen worden war, die Angelegenheit, und der Papst schickte Erklärungen an Kaiser Ludwig den Frommen (814–840), aber dabei blieb es.51 Diese letzte Episode zeigt zwar Leos Selbstbewusstsein, deutet allerdings auch an, dass der Papst am Ende seines Pontifikates immer noch nicht unangefochten in Rom regierte. Jedoch lag hier eher ein strukturelles Problem, das vor allem auf fehlende Netzwerke und konkurrierende römische Familien und Parteiungen verweist. Sein Nachfolger Stephan IV. (816–817), der wie die späteren Päpste Sergius II. und Hadrian II. einer sehr vornehmen römischen Familie entstammte, soll die Gegner Leos III. begnadigt haben.52
Der Streit des römischen Adels um die Cathedra Petri, die immer nur punktuelle Einflussnahme eines mächtigen oder profilierten patricius oder Kaisers deuten an, dass es noch lange dauern sollte, bis sich das päpstliche Amt aus diesen regionalen Bezügen befreien konnte, die im Übrigen nie ganz verschwanden. Gleichzeitig ordnet sich aber die Kaiserkrönung Karls in einen größeren Prozess ein, in die Lösung des Papsttums aus byzantinischen Bindungen und in die Hinwendung zu den Franken. Das Rom Leos III. verharrte in byzantinischen Traditionen bei den Bauten, im Zeremoniell, bei Absetzungsriten, Reinigungseid, Majestätsverbrecherprozess. Karolingische Formen ersetzten diese Prägungen nicht direkt, nicht ohne Widerstand oder ohne Brechungen; sie griffen eher manches auf oder veränderten es. Deshalb wurde Rom in dieser Zeit nicht nur ein besonders wichtiger Raum für kulturelle Aneignungs- und Abstoßungsprozesse, sondern auch für Misch- und Hybridformen.