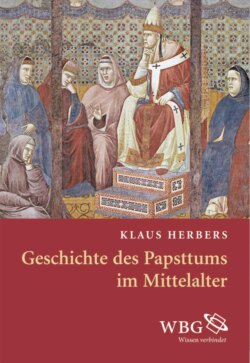Читать книгу Geschichte des Papsttums im Mittelalter - Klaus Herbers - Страница 31
Rom als politischer und sakraler Raum
ОглавлениеGregor I. predigte und schrieb nicht nur, sondern er kümmerte sich auch um die Belange der Stadt Rom. In einem seiner Briefe klagte er, dass nun der letzte noch in Rom tätige Geldwechsler seine Tätigkeit hatte aufgeben müssen. Wie sehr eine solche Notiz den Rückgang des „internationalen“ Handels in Rom belegt, ist strittig. Jedoch dürfte zur Versorgung der römischen Bevölkerung, für welche die Päpste zunehmend zuständig waren, vor allen Dingen auf griechische Getreidelieferungen zurückgegriffen worden sein. Die Verteilung dieser Lebensmittel und die Versorgung der Menschen vor Ort übernahmen inzwischen meist die Diakonien, die Sozialarbeit aus dem Geist christlicher Nächstenliebe leisteten. Die Diakonien lagen in der Regel an Orten, die seit der Spätantike ähnliche Aufgaben wahrgenommen hatten. Sie entwickelten sich erst später zu eigenen Kirchen. Eine befand sich zum Beispiel an der alten Stelle der Annona (Getreideration, abgeleitet von annus, Jahr, jährlicher Ertrag), wo heute die römische Kirche S. Maria in Cosmedin steht. Weil ursprünglich vor allem Griechen den Handel beherrscht hatten, waren viele der Diakonien griechischen Heiligen gewidmet.
Ähnlich wiesen zahlreiche Klöster griechischen Einfluss auf, denn besonders nach den Gotenkriegen hatte sich das monastische Leben in Rom verbreitet, und griechische Mönchsgemeinschaften „verwalteten“ ein Viertel der etwa zwei Dutzend Klöster in Rom. Das wichtigste war das Kloster S. Saba auf dem Aventin. Die lateinischen Klöster lagen meist bei den Basiliken und nahmen liturgische Aufgaben in den vier oder fünf Basilikalkirchen wahr (Lateranbasilika, St. Peter, S. Maria Maggiore, in geringerem Maße auch bei S. Lorenzo und St. Paul vor den Mauern). Berücksichtigt man diese Zuordnung wichtiger römischer Klöster zu den Basilikalkirchen, so dürfte sich die Zahl der stärker eigenständigen Klöster mit griechischer und römischer Besetzung sogar etwa die Waage gehalten haben.
Griechischer Einfluss ist schließlich in der Liturgie, allerdings verstärkt erst nach dem Pontifikat Gregors des Großen, während des 7. Jahrhunderts, deutlich. Dies betraf besonders den Marienkult. Nachdem in der Ostkirche nach den dogmatischen Streitigkeiten der ersten nachchristlichen Jahrhunderte die Vorstellung von Maria als Gottesgebärerin besonders wichtig geworden war, förderte der verstärkte griechische Einfluss in Rom die Einführung mehrerer Marienfeste samt Prozessionen. Dabei wurden manche Herrenfeste „marianisiert“. Dies betraf zum Beispiel die Darstellung im Tempel am 2. Februar: Mariä Lichtmess, sowie andere Marienfeste (Aufnahme Mariens am 15. August, Mariä Geburt am 8. September). Über die jeweilige „Einführung“ berichtet vor allem der Liber pontificalis.
Wenn zunehmend ehemals profane Gebäude zu Kirchen umgewidmet wurden, unterstrich dies die Bedeutung des inzwischen christlichen Rom. Mit Hilfe der „Stationsgottesdienste“ war es möglich, die verschiedenen alten und neuen Kirchen, Basiliken, Titelkirchen und Diakonien in ein umfassendes topographisch-liturgisches System zu integrieren. Dezentrale Gottesdienste waren schon seit dem 4. Jahrhundert in Jerusalem und an anderen Orten üblich gewesen. In manchen Städten der Spätantike, die noch nicht in Pfarreien unterteilt waren, versammelten sich die Gemeindemitglieder an Sonn- und Feiertagen zum Gottesdienst mit dem Bischof. Solche Feiern hießen Stationsgottesdienste, denn sie leiteten sich von statio (Versammlungsort) ab. In Rom entstand seit dem 5. Jahrhundert eine besondere Ordnung, bei der die einzelnen Teilgemeinden zu gewissen Anlässen in Prozessionen von einer Sammelkirche zur Stationskirche zogen. Der Papst feierte zum Beispiel an den Hauptfesten seine statio in einer der Basiliken, hingegen beging er die Sonn- und Wochentage, vor allen Dingen in der Fastenzeit, in Titel- und Diakoniekirchen. Auf diese Weise war der römische Bischof im Laufe des Kirchenjahres immer wieder an verschiedenen liturgischen Orten Roms präsent. Gleichzeitig wurde er damit zur herausragenden Person, die in den verschiedensten Regionen Roms durch liturgische Feiern auch Herrschaftsansprüche anschaulich machen konnte. Die Stadt als bischöflich-päpstlich dominierter Sakralraum wurde durch Umgänge und Prozessionen weiter konstituiert. Teilweise integrierte man Reste vorchristlicher Kulte, besonders an den Festen des 2. Februar (Lichterprozession), am 25. April (Markustag) sowie am 15. August (Mariä Himmelfahrt mit Bezügen zu Elementen eines alten Fruchtbarkeitsfestes).