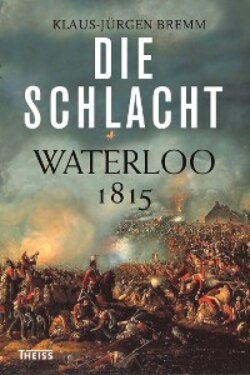Читать книгу Die Schlacht - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 9
1. Waterloo — Die letzte Schlacht des Ancien Régime
ОглавлениеAm 9. September 1709 kämpften in der Nähe des kleinen belgischen Weilers Malplaquet, südlich der Festung Mons, die verbündeten Armeen Englands, Österreichs, der Niederlande – die damals noch Generalstaaten hießen – sowie andere deutsche Kontingente in einer der größten und blutigsten Schlachten des 18. Jahrhunderts gegen das Aufgebot Frankreichs. An der Spitze dieser Truppen standen die renommiertesten Feldherrn ihrer Zeit, darunter John Churchill, der 1. Herzog von Marlborough, und Prinz Eugen von Savoyen, der Sieger von Zenta, Höchstädt und Turin. Auf der Gegenseite führte der Marschall Claude Louis de Villars den Oberbefehl über 100.000 Franzosen, das letzte Aufgebot einer längst ausgebluteten Großmacht am Ende eines halben Jahrhunderts voller Feldzüge und Belagerungen. Gemeinsam hatten Villars Gegner an diesem Tag etwa dieselbe Zahl von Soldaten aufgebracht.1
Die Infanterie beider Streitmächte kämpfte in dieser letzten großen Schlacht des Krieges um die spanische Erbfolge mit Steinschlossmusketen, an deren Mündungen erst seit Kurzem Bajonette befestigt waren. Unterstützt wurde sie von glattläufigen Feldgeschützen aus Bronze, die wie schon in den Schlachten des Dreißigjährigen Krieges vier-, sechs- oder achtpfündige Eisenkugeln auf bis zu 800 Meter Distanz verschießen konnten oder mit Blei- und Eisenteilen gefüllte Kanister, sogenannte Kartätschen, auf kurze Entfernungen ausspien. In beiden Fällen waren die Wirkungen für die in dichten Linien agierende Infanterie verheerend. Bei einer Mündungsgeschwindigkeit von 500 Meter je Sekunde rissen die Eisenkugeln blutige Schneisen in die Kolonnen des Gegners und der Kartätschenbeschuss hatte die Wirkung moderner Streubomben. Im richtigen Moment eingesetzt, konnte eine einzige Batterie von vier oder sechs Geschützen ein Bataillon von 800 Mann in Minuten auslöschen. Am Ende des Tages hatte der Zusammenprall bei Malplaquet beide Armeen mehr als 40.000 Tote und Verwundete gekostet. Eine militärische Entscheidung war jedoch nicht gefallen. Die Franzosen zogen sich halbwegs geordnet zurück.
Wenig mehr als ein Jahrhundert später traten am Nachmittag des 18. Juni 1815 südlich der Ortschaft Mont Saint Jean, nur einige Dutzend Kilometer von dem alten Kampfplatz des Erbfolgekrieges entfernt, erneut drei große Armeen gegeneinander an. Weder in ihrer Bewaffnung noch in ihrer Uniformierung unterschieden sich die Soldaten dieser Schlacht, für die sich außer in Preußen der Name Waterloo durchgesetzt hat, wesentlich von ihren Vorgängern. Immer noch prägten bunte Uniformen das Gefechtsfeld, das sich, eingehüllt in dichte Schwaden von Pulverdampf, den Soldaten und ihren Offizieren nur schemenhaft präsentierte. Wie in den Schlachten des Erbfolgekrieges griff die Infanterie hinter lockeren Schwärmen leichter Schützen in tiefen Kolonnen an oder verteidigte sich in langen Schützenlinien zu drei oder vier Gliedern. Generationen von Taktikern wie etwa der französische Baron François de Guibert hatten sich während des 18. Jahrhunderts über die Evolution der Gefechtsformationen den Kopf zerbrochen und komplexe Lösungen ersonnen. Doch im Prinzip blieb alles beim Alten.2
Auch bei Waterloo dominierte immer noch der Bajonettangriff der Infanteriekolonnen, in deren Lücken die Artillerie eingeschoben war. Mit ihrem Feuer sollte sie den Gegner an den Einbruchstellen dezimieren. Allein das entschlossene und gleichförmige Vordringen einer dichten Masse von Männern mit gefälltem Bajonett, idealerweise flankiert von der eigenen Kavallerie, die den Gegner zwang, sich in sogenannten Karrees einzuigeln, garantierte auch noch zu Zeiten Napoleons den militärischen Erfolg. Der grimmige Angriff mit der blanken Waffe verbreitete nach wie vor unter den Gegnern das größte Entsetzen und ließ deren Reihen oft noch vor dem tödlichen Anprall, dem sogenannten Schock, auseinanderbrechen. Als etwa Marschall Michael Ney in der Schlacht von Montmirail am 11. Februar 1814 seine Soldaten sogar die Feuersteine von ihren Musketen entfernen ließ, war dies vielleicht im Detail eine Übertreibung, vom Grundsatz her aber gängige Praxis und auch an diesem Tag von Erfolg gekrönt. Vor den Bajonetten ihrer Gegner ergriffen die verbündeten Russen und Preußen schleunigst die Flucht.3 Für die größte Wirkung auf den Schlachtfeldern des frühen 19. Jahrhunderts sorgte somit immer noch der kalte Stahl, nicht die heiße Kugel.
Wie schon bei Malplaquet standen an der Spitze der Armeen von 1815 Europas bedeutendste Befehlshaber, der Herzog von Wellington, der Sieger in Spanien, oder der preußische Marschall Fürst Blücher von Wahlstatt, dessen legendärer Elan angeblich ein ganzes Armeekorps ersetzte. Als unbestrittener Primus auf dem militärischen Olymp aber galt trotz seiner Niederlagen in Russland und Sachsen noch immer Napoleon Bonaparte. Schon im zehnten Jahr kämpfte er, wie Ludwig XIV. und seine Marschälle ein Jahrhundert zuvor, einmal mehr gegen eine feindliche Koalition aus Briten, Preußen, Niederländern und anderen deutschen Kontingenten. Es war genau jene Konstellation der Allianzen, die seit Englands Glorious Revolution im Jahre 1688 für mehr als ein Jahrhundert die Kriegführung des Ancien Régime geprägt hatte und während der Revolutionszeit noch einmal entschieden erneuert worden war. Im kurzen Feldzug von 1815 aber hatte sie zum letzten Mal in der europäischen Geschichte Gestalt angenommen. Vier Dekaden später kämpften Briten und Franzosen bereits gemeinsam auf der entlegenen Krim gegen die Armee des Zaren, und dem britischen Oberbefehlshaber General Fitzroy Somerset, den Zeitgenossen besser bekannt als Lord Raglan, dürfte das Vive l’Empereur seiner nunmehrigen Verbündeten noch einmal eine schaurige Erinnerung an seinen bei Waterloo verlorenen Arm verschafft haben.
Obwohl im Jahre 1815 schon die industrielle Revolution das Vereinigte Königreich sichtbar zu verwandeln begonnen hatte, von der Dampfkraft angetriebene Lokomotiven in den zahlreichen Zechen Englands keine Seltenheit mehr waren und neue Verfahren der Verhüttung sowie des Walzens den Ausstoß an Schmiedeeisen auf bisher nicht für möglich gehaltene Mengen steigen ließen, galten für die drei Armeen auf den regenfeuchten Feldern südlich von Brüssel noch annähernd die gleichen technischen Bedingungen wie zu Zeiten König Gustav Adolfs von Schweden. Zwar war die Zahl der Söldner, die das Erscheinungsbild sämtlicher Streitmächte des Ancien Régime so lange geprägt hatten, inzwischen deutlich zurückgegangen, doch hinsichtlich der Parameter Feuerkraft, Beweglichkeit und Kommunikation herrschte seit annähernd zwei Jahrhunderten ein bemerkenswerter Stillstand. Immer noch betrug die mittlere Feuergeschwindigkeit der Infanterie zwei bis drei Schuss pro Minute, wobei Zielgenauigkeit und Wirksamkeit der Geschosse schon nach 100 Metern rapide abnahmen. Immer noch marschierten die Armeen über oft Hunderte von Kilometern zu Fuß, wobei eine Strecke von 50 Kilometern pro Tag das erreichbare Maximum darstellte. Immer noch zogen Pferde die Geschütze oder Proviantkarren und immer noch überbrachten sogenannte Aide de Champs (Feldherrngehilfen) Befehle und Meldungen, die oft schon von den Ereignissen überholt waren, wenn sie denn überhaupt eintrafen.
Lange vor der industriellen Revolution hatten die Armeen Europas zu Beginn des 17. Jahrhunderts bereits eine Phase tiefer Umbrüche erlebt, für die britische Autoren den Begriff der „Militärischen Revolution“ geprägt haben.4 Aus den nur schwer zu kontrollierenden Söldnerheeren der Renaissance waren innerhalb eines halben Jahrhunderts die stehenden Heere des Ancien Régime hervorgegangen, die ständiger Drill und brutale Disziplin zu gefügigen Werkzeugen ihrer absolutistischen Souveräne geformt hatten. Kontinuierlich waren seither die Truppenstärken gestiegen. Militärische Operationen stützten sich nunmehr auf ein verzweigtes System von Magazinen. Vor allem aber verbesserte sich in diesem Zeitraum die Ausbildung der Offiziere, da fast sämtliche Großmächte im Laufe des 18. Jahrhunderts zentrale Militärakademien oder Kriegsschulen errichteten. Kenntnisse im Festungsbau, des Artilleriewesens, der Logistik und der Kriegsgeschichte zählten bald zum Handwerkszeug der militärischen Führer, auch wenn Adel und Anciennität weiterhin das innere Gefüge der Armeen prägten.
Doch alle organisatorischen Fortschritte wie auch die Verbesserungen der Schusswaffentechnik vollzogen sich noch innerhalb der seit zwei Jahrhunderten unverrückbar erscheinenden technischen Grenzen.5 So ließ sich zwar durch verbesserte Munition oder leichtere Lafetten das Gewicht von Musketen und Geschützen zum Teil deutlich verringern, doch eine ballistische Leistungssteigerung ergab sich daraus nicht.6 Optische Telegrafen und gepflasterte Chausseen lieferten die besten Beispiele für diese Optimierungsversuche der Militärs innerhalb des Systems. Dagegen war die schon in die Zukunft weisende Zugmaschine des französischen Hauptmanns Cugnot wieder im Arsenal von Vincennes verschwunden, nachdem sein durch Dampfkraft angetriebenes Gefährt 1775 auf einer Probefahrt eine Kasernenmauer gerammt hatte.7
Es war bezeichnend für Waterloo, diese Schlacht exakt am Vorabend des Maschinenzeitalters, dass der Bericht des Herzogs von Wellington über ihren Ausgang erst am 22. Juni 1815 in der Londoner Times erscheinen konnte. Major Henry Percy vom 14. Leichten Dragonerregiment war zwar schon am Mittag des 19. Juni mit der Siegesmeldung seines Oberbefehlshabers von Brüssel nach England aufgebrochen, doch eine Flaute im Ärmelkanal zwang ihn bald, in ein Ruderboot umzusteigen, mit dem er am 21. Juni nachmittags um 15 Uhr die englische Küste bei Brodstairs erreichte. Von dort benötigte er mit der Postkutsche noch weitere sechs Stunden, um schließlich am Abend in London einzutreffen. Somit erfuhren die hauptstädtischen Leser erst nach vier Tagen in einem Artikel der Times die ersten Details eines Ereignisses, das nur 300 Kilometer entfernt stattgefunden hatte.8 Kaum ein Jahr später hätte Major Percy schon mit einem Dampfschiff den Ärmelkanal überqueren können. Die erste Passage von New Haven nach Le Havre glückte einem auf den Namen Élise umgetauften Flussdampfer aus dem schottischen Dumbarton am 17. März 1816. Die Weiterfahrt des Schiffes auf der Seine nach Paris geriet schließlich zu einem Triumphzug. Das Maschinenzeitalter hatte damit unwiderruflich begonnen.
Als eine Generation später der nächste Krieg der Großmächte auf der fernen Krim ausgetragen wurde, waren die Flotten aller Großmächte zwar immer noch mit Segeln ausgestattet, doch verfügten die meisten alliierten Schiffe vor Sewastopol bereits über Dampfmaschinen als Hilfsantriebe und die Armeen des Zweiten Kaiserreiches waren auf den brandneuen Eisenbahnlinien zu ihren Einschiffungshäfen in Toulon und Marseille gelangt.
Trotz der erheblichen Distanzen waren das exotische „Kriegstheater“ am Schwarzen Meer und die heimischen Metropolen bereits durch Telegrafen enger miteinander verknüpft als noch vier Jahrzehnte zuvor Belgien mit dem benachbarten Inselreich. Vom Scheitern des gemeinsamen Angriffs der britischen und französischen Regimenter auf das Fort Malakow bei Sewastopol am 18. Juni 1855, auf den Tag genau 40 Jahre nach der Schlacht von Waterloo, erfuhr das nachrichtenhungrige Publikum in London und Paris schon am nächsten Tag aus den telegrafischen Depeschen der zahllosen Kriegskorrespondenten auf der Schwarzmeerhalbinsel.
Auch wenn die Revolution in Frankreich seit 1789 in raschen und drakonischen Schritten den alten Feudalstaat mit allen Privilegien abgeschafft hatte und später Napoleon mit seinem Zivilgesetzbuch sogar bereits der modernen Wettbewerbswirtschaft den Weg ebnete, war Waterloo 1815 nicht nur die letzte Schlacht des Ancien Régime. Sie war zugleich auch der letzte militärische Schlagabtausch, in dem die Innovationen der immerhin schon 30 Jahre währenden industriellen Revolution so gut wie keine Rolle gespielt hatten. So schenkte Napoleon den neuartigen Raketengeschossen des Briten William Congreve ebenso wenig Beachtung wie dem Heißluftballon der Brüder Montgolfier, obwohl Letzterer seinen militärischen Nutzen in der Schlacht von Fleurus 1794 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte.9 Darin unterscheid sich der Korse kaum von seinem Widersacher Wellington, der Congreves Raketen trotz ihrer viel beachteten Erfolge bei Leipzig als blanke Terrorwaffen betrachtete, mit denen sich höchstens Städte und Ortschaften in Brand schießen ließen.10 Obwohl es technisch auch bereits möglich war, die unzuverlässige Steinschlosszündung durch das Perkussionsprinzip zu ersetzen, blieb der Einsatz von Zündhütchen auf Basis von Chlorkalisalz in den ersten beiden Dekaden des 19. Jahrhunderts noch auf Jagdwaffen beschränkt. Erst in den 1830er-Jahren setzten sie sich nach umfangreichen Erprobungen auch bei den Militärwaffen durch.11
Während das blutige Vierteljahrhundert der Revolutionskriege noch einen militärischen Innovationsstau bewirkt zu haben schien, da den Kriegsherren kaum Zeit blieb, sich mit unerprobten Innovationen zu befassen, explodierte die Zahl der Neuerungen in der Militärtechnik nach 1815, obwohl die vier Dekaden nach dem Sturz Napoleons vergleichsweise friedlich verlaufen waren. Erst auf der Krim kämpften 1854 wieder drei der fünf europäischen Großmächte gegeneinander und in der Schlacht an der Alma dezimierte die britische Garde die dunkelgrünen Kolonnen ihres ehemaligen russischen Verbündeten mit dem weitreichenden Miniégewehr.12 Bereits ein Jahr zuvor hatte der russische Admiral Paul Nachimov die türkische Flotte im Schwarzmeerhafen von Sinope mithilfe der Sprenggeschosse des französischen Generals Henri Paixhans versenkt. Zehn Jahre später wiederum sicherte Nikolaus Dreyses revolutionäres Hinterladergewehr mit seinem Zündnadelsystem Preußens Sieg über den Erzrivalen Österreich und Henry Bessemers spektakuläre Methode der kostengünstigen Stahlerzeugung erlaubte endlich die massenhafte Herstellung weit reichender Geschütze.
Als Großbritannien fast genau 100 Jahre nach Waterloo wieder eine Armee nach Belgien schickte, gab es zwar noch wie bei Malplaquet die drei klassischen Truppengattungen der Infanterie, der Kavallerie und der Artillerie, doch während John Churchills Rotröcke sich durchaus noch in den Soldaten Wellingtons hätten wiedererkennen können, wären Letzteren wiederum wohl Herbert Kitcheners neue Armeen mit ihren erdgrauen Felduniformen, ihren Tellerhelmen und Gasmasken bereits wie eine Expedition von einem anderen Stern erschienen.