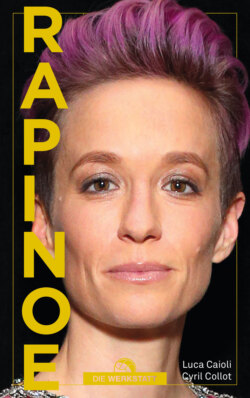Читать книгу Megan Rapinoe - Luca Caioli - Страница 5
ОглавлениеBORN IN THE U.S.A.
Born down in a dead man’s town
The first kick I took was when I hit the ground
End up like a dog that’s been beat too much
‚Til you spend half your life just covering up
Born in the U.S.A
I was born in the U.S.A
I was born in the U.S.A
Born in the U.S.A
Born in the U.S.A., Bruce Springsteen, 1984
2. Juli 2011. 18 Uhr. Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim. USA gegen Kolumbien, viertes Spiel der Frauenweltmeisterschaft. Zur Halbzeit steht es 1:0 für die Amerikanerinnen. In der 12. Minute hat Heather O’Reilly einen Patzer von Liana Salazar ausgenutzt und die Frauen in Weiß in Führung gebracht. Nach dem Vollspannschuss in den Winkel stellt sich die gesamte US-Mannschaft in einer Reihe vor der Tribüne auf und salutiert. Adressaten des militärischen Grußes sind 350 Soldaten und Offiziere aus der Kaserne „Coleman Barracks“ und deren Angehörige, die aus dem 50 Kilometer entfernten Mannheim angereist sind, um ihre Landsfrauen anzufeuern. Eine Geste der Dankbarkeit.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit wird Megan Rapinoe, Trikotnummer 15, für Amy Rodriguez eingewechselt. Vier Minuten später bekommt die US-Amerikanerin einen Einwurf in der Hälfte der Kolumbianerinnen zugesprochen und schleudert den Ball weit ins Feld zu Lauren Cheney. Die Mittelfeldspielerin aus Indianapolis steht mit dem Rücken zum Tor und schüttelt mit einem schnellen Antritt ihre kolumbianische Bewacherin Kelis Peduzine ab. Cheney orientiert sich kurz, und als wäre der Spielzug einstudiert, bedient sie, ohne aufzuschauen, mit einem klugen Pass Rapinoe, die im Sprinttempo in den Strafraum durchgelaufen ist. Die platinblonde Spielerin lässt zwei Gegnerinnen aussteigen und setzt mit rechts zum Schuss an. Sandra Sepúlveda, Kolumbiens Nummer 1, steht zu weit vor dem Tor, um den harten Schuss halten zu können, der unter der Latte einschlägt. Mit ausgebreiteten Armen strebt „Pinoe“ – so nennen sie ihre Freunde – der Eckfahne entgegen, neben ihr Cheney und O’Reilly. Sie schnappt sich ein dort stehendes Außenmikrofon, klopft ein paar Mal dagegen, um zu sehen, ob es funktioniert, und singt dann aus voller Kehle: „Born in the U.S.A“. Lori Lindsey begleitet ihre Mannschaftskollegin auf der Luftgitarre.
Schon immer hat Megan ihre Tore gefeiert. Das tat sie bereits, als sie noch nicht in ausverkauften Stadien spielte und sich vor laufenden Kameras in Szene setzte. Damals, als ihr noch keine Mas-sen zusahen, sondern nur ihre Eltern, die am Spielfeldrand standen. Das Zelebrieren von Toren ist Ausdruck ihrer Liebe zum Fußball, ihrer Leidenschaft im Spiel und des Spaßes, den sie daran hat. Es ist Teil ihres fröhlichen Wesens – halb Rampensau, halb Clown – und gehört irgendwie dazu; so dauert das Tor länger an und Megan tritt in Verbindung mit den Zuschauern, sie unterhält sie und lässt sie am Spiel teilhaben. Eine schöne Art, einen Höhepunkt des Spiels zu würdigen und ihm gleichzeitig den ernsten, gar heiligen Charakter zu nehmen. Die junge Frau mit der 15 auf dem Rücken hat im Lauf ihrer Karriere eine Vielzahl Siegergesten erfunden. Einige davon, wie der angedeutete, abgeschossene Pfeil oder die Bocksprünge über ihre Mitspielerinnen, sind bei den Fans inzwischen Kult. Doch dieses Mal ist Megan Rapinoe noch weiter gegangen. Mit ihrer Interpretation des Springsteen-Songs präsentiert sie sich der Welt. Spontane Improvisation oder lang gereifter Plan? Natürlich war dieser Schachzug im Vorhinein und mit großer Sorgfalt vorbereitet.
Die Idee stammte von Lori Lindsey, eine von Megans Freundinnen, die sie 2006 in Los Angeles während eines Trainingslagers der Nationalmannschaft kennenlernte. Damals machten sich die beiden über die mit Plüsch bezogenen Mikrofone an der Seitenlinie lustig, die wie Hunde oder irgendwelche fantastischen Wesen aussehen, jene seltsamen Teile, die man eigentlich immer zuerst umnietet, ehe man eine Ecke schießt. Schon damals meinten die zwei Frauen, es wäre doch lustig, eines Tages etwas in diese Außenmikros, die eigentlich zum Einfangen der Stimmung im Stadion bestimmt sind, hineinzurufen oder -zusingen. Und das taten sie. Das Timing hätte nicht besser sein können: Es ist zwei Tage vor dem 4. Juli, an dem Amerika seinen Unabhängigkeitstag feiert, den 235. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Es ist Megans erste Weltmeisterschaft und ihr erstes (und auch letztes) Tor in diesem Turnier.
Ein Tor, das allerdings weniger schwer wiegt, als Megans berühmte Hereingabe in der 122. Minute des WM-Viertelfinals gegen Brasilien in Dresden: Die Südamerikanerinnen führen 2:1 dank Marta, dem Star aus Rio de Janeiro. Cristiane, die Nummer 11 in Gelb, hält den Ball, weit weg vom eigenen Tor. Der Schiedsrichter kann jeden Augenblick abpfeifen und dem Abenteuer der USMannschaft so ein Ende bereiten, doch da gelingt es Ali Krieger, der gegnerischen Stürmerin den Ball abzunehmen. Krieger spielt zu Carli Lloyd, die Richtung Anstoßkreis läuft und nach links zu Megan Rapinoe passt. Die in der 55. Minute für Cheney eingewechselte Kalifornierin führt den Ball am Fuß, hebt den Kopf und schaut in die Hälfte der Brasilianerinnen. Sie sieht nur Gelb und das grüne Trikot der Torhüterin. Von dort aus, wo sie sich befindet, kann sie Abby Wambach unmöglich sehen. Aber Megan weiß, dass die Stürmerin mit der Nummer 20 irgendwo dort wartet und auf den Ball lauert. Also liefert Megan ihr mit links eine Vorlage aus über dreißig Meter Entfernung. Der Ball fliegt in die Richtung der Gegnerinnen, aber Wambach ist schneller. Sie hat das Missverständnis zwischen der brasilianischen Torhüterin und einer Verteidigerin antizipiert und erzielt per Kopf das 2:2! Eines der spektakulärsten und berühmtesten Tore in der Geschichte des amerikanischen Frauenfuß-balls, wodurch auch der Pass, der als Vorlage zu diesem Traumtor dient, entscheidend und unvergessen ist. Ein zentraler, magischer Moment, der das Schicksal, die Mentalität und die Geschichte der amerikanischen Nationalmannschaft für immer verändert. Im Elfmeterschießen besiegen die Amerikanerinnen die Brasilianerinnen mit 5:3. Im Halbfinale fegen sie Frankreich mit 3:1 vom Platz (mit zwei Torvorlagen von Megan) und stehen somit zum dritten Mal im Finale einer WM. Doch gegen Japan, das nur vier Monate zuvor von einem Tsunami heimgesucht und verwüstet worden ist, erlebt die amerikanische Frauennationalmannschaft eine bittere Enttäuschung: Die USA verlieren das Finale im Elfmeterschießen und reisen traurig aus Deutschland ab.
Trotzdem wird die Nationalmannschaft der Frauen bei ihrer Rückkehr begeistert empfangen. Millionen Fans haben die Erfolge der amerikanischen Fußballerinnen genau verfolgt. Jenes unvergessliche Tor und die Vorlage aus dreißig Metern Entfernung der platinblonden Mittelfeldspielerin, die ohne Scheu Born in the U.S.A. ins Mikro schmetterte, sind ihnen noch heute präsent.
DAS TRADITIONSBEWUSSTE AMERIKA
Achtung: Redding ist nicht gleich Kalifornien. Darauf hat Megan Rapinoe immer schon bestanden. Im Übrigen sagt sie von sich selbst nicht, dass sie aus Kalifornien kommt, sondern dass sie in Redding aufgewachsen ist, im Bundesstaat Kalifornien. Dieser feine Unterschied ist wichtig, denn ihr Geburtsort hat nichts mit dem Postkarten-Kalifornien zu tun, das wir aus Film und Fernsehen kennen: In der Gegend von Redding gibt es keine Strände, keine Surfer, keine Palmen wie in Los Angeles, auch keine Straßenbahnen wie in San Francisco. Redding ist der Teil Kaliforniens, den der „Golden State“ anscheinend vergessen hat. Die Sonne scheint dort aber genauso viel. Hinter Yuma in Arizona belegt Redding Platz zwei der sonnenreichsten Orte der USA. Doch hier findet man nicht die typische Landschaft der Westküste, sondern Berge, Flüsse, Seen, Wasserfälle, Grotten, Eichen- und Tannenwälder. Außerdem die Sundial Bridge, die Radfahrer und Fußgänger über den Sacramento River führt, das Gegenstück zur berühmten Golden Gate Bridge in San Francisco.
Dieses Bauwerk des spanischen Architekten Santiago Calatrava wurde 2004 eröffnet und sollte den Tourismus in Redding ankurbeln. Hier ist nämlich nichts zu sehen von jenen Besuchermassen, die tagtäglich in Hollywoods Universal Studios strömen. Redding liegt im Shasta County, 250 Kilometer nördlich von Sacramento, 370 Kilometer nördlich von San Francisco, und auf halber Strecke der 900 Kilometer langen Interstate 5, die Los Angeles im Süden und Seattle im Norden miteinander verbindet.
Dennoch ist Redding „das Kleinod Nordkaliforniens“, wenn man dem lokalen Tourismusbüro Glauben schenkt. Eine friedliche Stadt, landesweit für ihre „fesselnde Landschaft, die dynamische Wirtschaft, die freundlichen Einwohner, die Lebensqualität und die Sicherheit“ bekannt. Die Stadt wirbt damit, dass man hier sechzig Prozent günstiger als in San Francisco lebt. Kurz gesagt: Redding ist der perfekte Ort für Jugendliche und Rentner.
Natürlich übertreibt die Stadt mit ihren Lobeshymnen ein wenig, aber vollkommen abwegig sind die Angaben nicht: Redding liegt laut einer Studie der Walton Family Foundation und dem Forschungsinstitut Heartland Forward auf dem 29. Platz der dynamischsten urbanen Regionen Amerikas. Das Matador Network bezeichnet Redding als „one of the Coolest Towns in America“. Für das Time Magazine ist es die Kajak-Hauptstadt Amerikas. Forbes zählt Redding zu den zehn Orten in Nordamerika, an denen man am besten Forellen fangen kann. Die Los Angeles Times listet es unter den Top Ten der Picknickgegenden an der Westküste auf. Und laut dem National Public Radio ist Redding „ein Paradies unter freiem Himmel“. Ob nun Picknick, Forellenangeln, Lebenshaltungskosten oder Segelregatten im nahegelegenen Whiskey-town – das alles sind gute Gründe, Redding in den Augen von Touristen attraktiver erscheinen zu lassen und von seinem öden Ruf als Zwischenstopp an der Interstate 5 zu befreien.
Redding liegt mitten im Wilden Westen. Denn hier, im Sacramento Valley, lebten die Wintu, ein indigenes Volk, das sich vom Lachsfang ernährte, auf Jagd ging und wilde Beeren und Früchte sammelte. Die ersten Kontakte zum weißen Mann entstanden 1808, als die spanischen Eroberer in diese Gegend vordrangen, denen rund dreißig Jahre später die Trapper der Hudson Bay Company folgten. Die Heimat der Wintu, jene Territorien, in denen sie jagen und sammeln konnten, wurde nach und nach durch das Vieh der ausländischen Eroberer zerstört. Die Weißen bauten Staudämme und Kupferminen, wodurch die Gewässer zunehmend verschmutzten, die Wintu wurden beinahe durch Malaria ausgelöscht. Sie wurden gejagt und die Behörden, die das indigene Volk eigentlich schützen sollten, organisierten ein regelrechtes Massaker. „Unser Gouverneur, der Gouverneur von Kalifornien, hat eine Prämie in Höhe von fünf Dollar für jeden Skalp eines Wintu ausgerufen“, erinnerte sich Ende September 2019 Reddings Bürgermeisterin Julie Winter anlässlich der 32. Rede zur Lage der Stadt, „Friedensverträge sind Fackeln. Die indigenen Völker mussten aus ihren Dörfern fliehen, viele wurden gekidnappt und gezwungen, als Hausangestellte oder Sklaven zu arbeiten, während ihre Kinder in Internate gesperrt wurden mit dem Ziel, ihre Sprache und Kultur auszulöschen. Nur drei Prozent der Wintu haben dieses Massaker überlebt.“
Während dieser Veranstaltung lud Julie Winter die Vertreter des Stammes ein, auf die Bühne zu kommen. Sie entschuldigte sich – was bis dahin kein Bürgermeister aus der Gegend je getan hatte – „für die schweren Ungerechtigkeiten, die ihren Familien angetan wurden“. Bürgermeisterin Winter versprach ihnen, den heutigen Einwohnern von Redding die Geschichte, Traditionen, Kunst und Kultur der Wintu näher zu bringen. Zudem bedankte sie sich bei ihnen dafür, dass sie jahrhundertelang das Land bewahrt hat-ten, und verpflichtete sich öffentlich dazu, ihre heiligen Stätten zu schützen und sie von nun an bei Entscheidungen der Gemeinde zu berücksichtigen.
Das gibt Hoffnung für die Zukunft. Denn die Geschichte der Stadt und des County wurde in der Vergangenheit vom weißen Mann beherrscht: 1844 überschreibt der Gouverneur von Kalifornien, Manuel Micheltorena, dem Entdecker Pierson Barton Reading 10.778 Hektar mexikanischen Boden, die Rancho Buena Ventura. Ein Areal, das die heutigen Städte Redding, Anderson und Cottonwood umfasst. Der Name und Erfolg der Stadt kommen allerdings von einem anderen Pionier: Benjamin Barnard Redding.
Redding wird 1824 im kanadischen Yarmouth, Nova Scotia, geboren, und ihn erwartet ein außergewöhnliches Schicksal. Mit sechzehn Jahren wandert er aus und geht nach Boston. Zunächst arbeitet er als kleiner Angestellter, später versucht er sich im Einzelhandel, verkauft Nahrungsmittel und versorgt Schiffe mit Vorräten. Er heiratet und wird zum ersten Mal Vater. 1850 bricht Red-ding auf nach Kalifornien: Es ist die Zeit des Goldrausches. Er wird Minenarbeiter, Journalist, er setzt Beglaubigungsschreiben und Urkunden auf und wird schließlich Eigentümer einer Zeitung. 1856 wählt man ihn zum Bürgermeister von Sacramento, kurz darauf zum Staatssekretär Kaliforniens. Für die Central Pacific Railroad ist er als Grundstückverwalter tätig und findet ein Stück Land im Shasta County, wo er den Bau der nördlichen Endstation einer neuen Eisenbahnlinie veranlasst.
1872 benennt die Eisenbahnfirma den kleinen Flecken, der sich um den Bahnhof herum gebildet hat, als Zeichen der Anerkennung nach seinem kanadischen Entdecker. Am 4. Oktober 1887 wird Redding mit seinen 600 Einwohnern offiziell in den Bundesstaat Kalifornien eingegliedert. Zwanzig Jahre später leben dort bereits über 3.500 Menschen. Die Minenindustrie, der Abbau von Kupfer und Eisen, bildet das Grundgerüst der lokalen Wirtschaft. Hinzu kommt der Bau der Staudämme Shasta und Whiskeytown, der in den 1860er Jahren unzählige neue Arbeiter anzieht. Heute zählt Redding 91.772 Einwohner. 85,3 Prozent davon sind Weiße, 10,3 Prozent lateinamerikanischer Herkunft, 4,7 Prozent asiatischer Herkunft, 2,2 Prozent Native Americans und 1,5 Prozent Schwarze. Der Altersdurchschnitt liegt bei 38,5 Jahren, und das durchschnittliche Familieneinkommen bei über 50.000 US-Dollar (46.000 Euro) im Jahr. Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind heute der Tourismus, das Dienstleistungsgewerbe, die Holzindustrie, der Nahrungsmittelsektor und der Handel.
Eine große Rolle spielt auch die Religion, insbesondere die Bethel Church. Diese charismatisch-christliche Gemeinde, die der sogenannten Pfingstbewegung zugerechnet wird, predigt die Rückkehr zu den Ursprüngen. Ihre Einnahmen werden auf jährlich mehrere Millionen Dollar geschätzt. Der Pastor der wertkonservativen Kirche, Bill Johnson, ist ein einflussreicher Mann in der Stadt. Er schreckte 2016 nicht davor zurück, seine Gemeindemitglieder mittels Bibelzitaten dazu aufzurufen, bei der Präsidentschaftswahl für Donald Trump zu stimmen. Johnson wurde erhört: 63,9 Prozent wählten Trump und nur 23,7 Prozent die Demokratin Hillary Clinton.
Redding gehört zu den Red Towns, jenen Orten, die verlässlich die Republikaner wählen. Denn hier befindet man sich mitten im konservativen, traditionsbewussten, ländlichen Amerika. Redding ist, so Megan Rapinoe, „eine Art Außenseiter, bestehend aus fleißigen Fabrikarbeitern und Handwerkern“, eine Stadt, die sie immer mit sich trägt, egal, wohin sie geht. Die Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen ist, wo ihre Eltern wohnen, die sie regelmäßig besucht. Eine Stadt, die sie zur berühmtesten Sportlerin gewählt hat. Und eine Stadt, die es sich zugleich nicht nehmen lässt, Megans angeblichen Antiamerikanismus heftig zu kritisieren. Redding – die Stadt, die Megan nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 2019 gewürdigt hat: Auf Instagram zeigte man die Titelseite der Lokalzeitung Record Searchlight mit einem Rapinoe-Foto und dem Zusatz: „Heimatliebe ist die beste Liebe.“
EINE GROSSE FAMILIE
Denise ist 32 Jahre alt, James, ihr Ehemann, 37 Jahre, als sie am 5. Juli 1985 Zwillinge zur Welt bringt: Rachael Elisabeth, „die Große“, und Megan Anna, „die Kleine“, werden mit elf Minuten Abstand geboren. Das Paar hat bereits einen Sohn, Brian, und außerdem zwei große Kinder, Michael und Jenny, die aus Denise’ erster Ehe stammen. Denise ist die Zweitgeborene von insgesamt acht Geschwistern und hat 1981 nach dem Tod der Eltern ihre jüngere Schwester, CeCé, zu sich genommen.
Die Rapinoes sind eine große christliche Familie, die Eindruck macht, väterlicherseits ein Viertel italienisch, mütterlicherseits ein Viertel irisch (zurückgehend auf die Urgroßeltern). Der Familienname Rapinoe stammt offenbar aus den Abruzzen, der Region östlich von Rom zwischen Adria und dem Apennin. Dort gibt es viele Rapino (ohne das -e), und in der Provinz Chieti findet sich sogar ein Dorf mit 1.200 Einwohnern, das am Hang der Majella liegt, und Rapino heißt.
Die Rapinoes sind einfache Leute. James Michael, den alle nur Jim nennen, ist selbständig mit einem kleinen Bauunternehmen. Denise Ann kellnert in Jack’s Grill, einer Institution in Redding. Das Lokal eröffnete 1938, als die Innenstadt nur aus einer langen Straße mit Hotels, Clubs, Restaurants, Bars und Bordellen bestand. Lange Zeit war es der Lieblingstreffpunkt der Arbeiter von der Eisenbahn, den Staudämmen und den Minen. Zweiundachtzig Jahre später befindet sich das Lokal noch immer im selben Gebäude: 1734 California Street. Mit seinen zwei Etagen sieht die Fassade des Restaurants noch genauso aus wie damals, und die Steaks haben noch immer einen genauso guten Ruf.
Fast ihr ganzes Leben hat Denise in Jack’s Grill gearbeitet. Von 16 Uhr bis 22 Uhr ist sie unzählige Male zwischen dem Gastraum und der winzigen Küche des „House of choice steak“ hin- und hergelaufen, hat die Spezialitäten des Hauses beworben und serviert: das berühmte 16 oz. New York Strip, das Filet Mignon und das Top Sirloin. Natürlich haben die Stammgäste von den Erfolgen des Nesthäkchens gehört, und so wurde das Restaurant zum ersten Megan-Rapinoe-Fanklub. Die Einwohner aus der Gegend und auch Menschen auf der Durchreise gingen ein Steak essen und wechselten dabei ein paar Worte mit der Mutter der Weltmeisterin. In den letzten Jahren musste Denise mit den radikalen Standpunkten ihrer Tochter fertigwerden, die zu einigen hitzigen Diskussionen mit Gästen und auch den Eigentümern führten. Doch das ist ein anderes Thema …
Die Rapinoes lebten viele Jahre auf der anderen Seite des Sacramento River, im Osten, in Palo Cedro, sechzehn Kilometer außerhalb von Redding. Mit dem Auto waren es fünfzehn Minuten zu Jack’s Grill. Sie wohnten 21976 Oak Meadow Road, ein weitläufiges Grundstück umgeben von einem weißen Lattenzaun, mit Tannen, einer großen Eiche (die heute nicht mehr steht) und einer Allee, die über eine grüne Wiese zu einem einstöckigen Haus führt, an dem ein Basketballkorb angebracht ist. Megan und Rachael nutzten diesen Riesenspielplatz von über 4.000 Quadratmetern aus, bis sie dreizehn Jahre alt waren und ihre Familie gezwungen war, das Haus samt Grundstück zu verkaufen. Die Rapinoes zogen in ein Einfamilienhaus mit vier Zimmern am Eagle Parkway in Redding.
Die zwei „Nachzüglerinnen“ sind immer zusammen, unzertrennlich, klammern sich in den Babybetten aneinander. Doch wie bei Hund und Katze enden Spielereien meist böse. Sie sind zwar Zwillinge, haben aber sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Rachael ist der kleine Engel, den alle Welt bewundert. Megan der kleine Satansbraten. Rachael wird „Muffin“ genannt, Megan „Ma Baker“. Die Spitznamen verdanken die zwei kleinen Mädchen ihrem Großvater väterlicherseits, Granda Jack. Und als Megan ihn eines Tages fröhlich fragt, wer Ma Baker ist, überzeugt, dass es sich um eine Astronautin oder eine berühmte Anwältin handelt, muss sie sich anhören, dass Ma Baker eine berüchtigte Gangsterin der 1920er Jahre war. Deren Verbrechen im Übrigen der deutschen Musikband Boney M als Inspiration zu einem ihrer größten Hits dienten.
In der Oak Meadow Road wachsen die Zwillinge draußen auf. Denise lässt sie herumlaufen, sie dürfen kommen und gehen, wann sie wollen. Nur wenn es Zeit zum Essen ist, steckt ihre Mutter zwei Finger in den Mund und pfeift laut. Das klingt dann fast wie eine Feuerwehrsirene, und Megan und Rachael wissen, sie sollten innerhalb von zehn Minuten auftauchen, wenn sie keinen Hausarrest bekommen wollen.
Die zwei Schwestern, immer in Begleitung ihres Cousins Steven, verleben eine wunderbare Kindheit mit Ausflügen und Abenteuern à la Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Stundenlang fischen sie Flusskrebse in dem kleinen Bach nahe ihrem Haus, wobei Speckstücke oder Würstchenreste als Köder dienen. Die Technik zahlt sich aus: Eines Tages befinden sich siebzig Krebse in ihrem Eimer. Ein Rekord. Im Hühnerstall haben sie sich eine kleine Hütte gebaut; überall liegt Kot herum, und es riecht streng, aber das stört sie nicht sonderlich. Sie ziehen sich gern dorthin zurück, fernab von anderen Menschen.
Megan und Rachael sind nicht nur gern in der Natur, sie spielen auch begeistert Hockey und Flag Football1 mit den anderen Kindern des Viertels auf der Straße. Jede Aktivität nutzen sie, um sich zu messen: Rachael gegen Megan im Basketball, Megan gegen Rachael im American Football (wobei jede mal Quarterback, mal Receiver ist) und sogar eine gegen die andere im Baseball (oft mit imaginären Partnern) auf dem rautenförmigen Platz auf der anderen Seite der Straße, in der Nähe der Cow Creek Church. Baseball spielen sie auch zu Hause mit einem Mini-Schläger und zusammengerollten Socken als Bällen. Diese Duelle enden immer mit Gezanke wegen eines Punkts, eines Fehlers, eines nicht gegebenen Korbs, kurzum: Alles führt zu Unstimmigkeiten, nicht zuletzt das von Megan hinterlassene Chaos im gemeinsamen Zimmer, das in Rachaels Augen nie ausreichend aufgeräumt ist.
Brian, der fünf Jahre ältere Bruder, bleibt in der Familie der Experte in Sachen Angeln, Abenteuer und Sport. Megan und Rachael himmeln ihn an: Er ist ihr Vorbild, sorgt für Lacher, wenn er Steve Urkel2 oder Jim Carrey und dessen unmögliche Tanzbewegungen nachahmt. In gewisser Hinsicht ähneln sich Brian und Megan äußerlich, sie haben nahezu das gleiche Lächeln und den gleichen Blick. Auch ihre Persönlichkeiten weisen Gemeinsamkeiten auf: Beide sind extrovertiert, bringen andere gern zum Lachen, fühlen sich vor Publikum wohl. Die Zwillinge sehen in ihrem großen Bruder einen lieben, aufmerksamen Kerl. Begeistert folgen sie ihm auf seinen Abenteuern: Sie jagen Hühner, klettern auf Bäume, rennen durch Kornfelder, gehen angeln und machen, ganz klar, gemeinsam Sport. Brian weckt in Rachael und Megan die Leidenschaft fürs Fußballspielen. Als sie vier Jahre alt sind und er neun, sehen sie bei einem Turnier zu, an dem er mit der von Mutter Denise trainierten Mannschaft teilnimmt. Sofort sind die Mädchen fasziniert von dem Spiel und wollen es ihm gleichtun: In der Halbzeitpause rennen sie aufs Spielfeld und treten voller Begeisterung gegen den Ball. So kommt es, dass der große Bruder sich ihrer annimmt und ihnen auf dem Fußballfeld neben der Kirche die Grundlagen in Schießen und Ballführung beibringt.
Neben den Fußballpartien und den Abenteuern draußen spielt die Schule natürlich eine entscheidende Rolle im Leben der Zwillinge. Sie besuchen die Junction School von Palo Cedro, die vom „Kindergarden“ bis zur achten Klasse reicht. Rachael, genannt Waychy Wapinoe, weil sie noch nicht die richtige Aussprache des R beherrscht, ist der Liebling der Lehrer. Sie ist eine schüchterne, stille und fleißige Schülerin. Das genaue Gegenteil von Megan, die gern den Mund aufmacht, vor allem, wenn ihre Schwester ihr die richtige Antwort zugeflüstert hat.
Die zwei Mädchen sind die Pausenköniginnen. Auf ihren Dreirädern kommen sie als Schnellste durch den Slalomparcours, nehmen an sämtlichen Ballsportarten teil, ernten Bewunderung der anderen Kinder beim Double Dutch, einem Springseilspiel, das damals die Pausenhöfe eroberte. Mit fünf Jahren sind sie die Champions in ihrer Klasse.
Im Alter von sieben Jahren begreifen die Zwillinge nicht wirklich, was mit ihrem großen Bruder geschieht: Er raucht Marihuana. Drei Jahre später setzen sich die Eltern mit ihnen an den Esstisch und erklären ihnen, dass Brian festgenommen wurde, weil er Methamphetamin mit in die Schule gebracht hat. Mit achtzehn ist ihr Bruder drogenabhängig: Er nimmt Heroin. Er wird wegen Autodiebstahl, Fahrerflucht und Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt. Er kommt nicht in die Erziehungsanstalt, sondern direkt ins Gefängnis. Von da an ist Brian in weißen Gangs, er lässt sich das Hakenkreuz auf die Handinnenfläche und die Siegrune, das Symbol der SS, auf Finger, Hüften und Waden tätowieren. Um von den Bossen der Gangs akzeptiert und Teil einer „Familie“ zu werden, die ihn hinter Gittern beschützen soll, wird er zu einem weißen Suprematisten.
Denise ist verzweifelt. Sie hat ihre Kinder stets entsprechend dem christlichen Glauben und der christlichen Werte erzogen, ihnen Nächstenliebe statt Hass und Rassismus eingeschärft. Und sie war ihnen immer ein einwandfreies Vorbild: Neben ihren Aufgaben als Mutter engagierte sie sich ehrenamtlich für die Kirche, half Obdachlosen und bei der Tafel der Stadt. Nein, Denise hätte sich nie im Leben vorstellen können, dass Brian, jener brave, liebe kleine Junge eines Tages so enden würde. Doch Heroin ist grausam und niederträchtig, ein Blutegel, den man nicht mehr loswird. Brian wandert immer wieder ins Gefängnis, wird nach der ersten Entlassung erneut mehrfach verurteilt wegen seiner Drogensucht und seines Verhaltens im Gefängnis: Besitz von Rauschmitteln und Waffen sowie drei Übergriffe auf andere Häftlinge. Insgesamt verbringt er von sechzehn Gefängnisjahren acht in Isolationshaft. Heute, im Alter von vierzig Jahren, sieht Brian womöglich zum ersten Mal Licht am Ende des Tunnels: Nachdem er den Großteil seines Lebens als Erwachsener eingesperrt war, viel nachgedacht und seine Sucht überwunden hat, nachdem er die Nazi-Tätowierungen hat entfernen lassen und an einem Programm zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft teilgenommen hat, ist er auf Bewährung freigelassen worden. Er hofft nun auf ein neues Leben gemeinsam mit seinem Sohn Austin, der ebenfalls von Denise und Jim großgezogen worden ist. Brian möchte wieder Psychologie studieren und träumt davon, eines Tages zusammen mit Megan und der ganzen Rapinoe-Familie einen Titel feiern zu können.
Trotz der langen Jahre im Gefängnis, getrennt von seiner Familie, ist das enge Band zwischen Brian, Megan und Rachael nie abgerissen. Nur die Rollen sind nun anders verteilt. Während Brian früher das Idol von Megan war, schaut heute er zu seiner kleinen Schwester auf. Selbst hinter Gittern hat der große Bruder kein Spiel von „Pinoe“ bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften verpasst. Während der WM 2015 stand der Fernseher allerdings im Gang, mehr als vierzig Meter von Brians Zelle entfernt. Also hat er sechzig Bücher aufeinander gestapelt, mit Streifen abgerissener Bettlaken zusammengebunden und ist auf diese Behelfskonstruktion geklettert, um durch das kleine Fenster in der Tür seiner Zelle wenigsten einen Teil des Bildschirms zu sehen. Diese Anekdote zeugt von der Bewunderung für seine kleine Schwester, „eine Sportlegende, auf und neben dem Platz“, wie er sie nach dem Sieg der USA bei der WM in Frankreich auf Instagram beschrieben hat. Megan hat sich am 7. Juli 2019 im Fernsehen direkt an Brian gewandt, nachdem sie ihren zweiten Weltmeistertitel erobert hatte. Bei einem Interview unmittelbar nach dem Spiel hat sie die Gelegenheit genutzt und ihm gratuliert: „Just one thing: Happy birthday, Brian. I love you so much.“ Dazu schickte sie ihm einen Luft-kuss über die Kamera.
Die amerikanische Starfußballerin hat nie versucht, die Drogensucht ihres Bruders zu verheimlichen. Sie hat sogar offen erklärt, seine Geschichte habe sowohl ihre Sportkarriere als auch ihren Weg als Aktivistin beeinflusst. Sie führte unter anderem dazu, dass Megan sich ausführlich mit der Reform des amerikanischen Drogengesetzes auseinandersetzte und den Menschen in der Gesellschaft helfen will, die besonders verletzlich sind. Denn inhaftierte Drogenabhängige sind oft „nur ganz normale Leute, sie sind deine Brüder, deine Freunde und deine Familie“.
Ein langer Erkenntnisprozess für die junge Frau und eine schmerzhafte Erfahrung für ein zehnjähriges Kind. Wie konnte das sein: Der Bruder, den sie so anhimmelte und dem sie nacheiferte, mit seinem blonden Pilzkopf und der Nummer 7 auf dem Fußballtrikot, wie konnte er von einem Tag auf den anderen zum Bösewicht werden? Megan durchlief alle Phasen dieses Prozesses: von Schuldgefühlen (was sie hätte sagen oder tun können, um das ganze Drama zu verhindern) bis hin zu blinder Wut, angetrieben durch die Vorstellung, ihr Bruder habe sein Leben absichtlich weggeworfen, um der Familie zu schaden.
Auch Megan und Rachael erfahren Leid, sie spüren die Sorge und Ohnmacht ihrer Eltern, die Brian nicht retten können: Unsummen, die sie für Reha, Entzugskliniken, Militärschulen und die Verlegungen von einem Untersuchungsgefängnis ins andere ausgeben. All das war kaum aufzuhalten, doch am Ende dieser langen, schweren Prüfung sind die Schwestern noch enger zusammengewachsen, sie sind einander nähergekommen, und machen von da an einen noch größeren Bogen um Drogen und Ärger. Der Sport, insbesondere Fußball, ist zu ihrem Ausweg geworden.
_______________
1 Flag Football ist eine aus dem American Football entstandene Sportart, bei der die Defense den ballführenden Spieler der Offense stoppt, indem sie ihm eine Flagge („Flag“) aus dem Gürtel zieht, statt ihn körperlich zu tackeln wie im American Football.
2 Steve Urkel, gespielt von Jaleel White, war der zwölfjährige Held der TV-Serie Family Matters (dt: Alle unter einem Dach) in den 1990er Jahren.
TOMBOY
Mit sechs Jahren beginnen Megan und Rachael, in einer Fußballmannschaft von Palo Cedro zu kicken. Schon lange wollten sie es ihrem Bruder nachtun und wie die Großen Fußball spielen. Letztendlich haben die Zwillinge ihren Willen durchgesetzt, doch vor dreißig Jahren gab es in dieser ländlichen, konservativen Gegend der USA nur wenige Mädchen, die Fußball spielten, geschweige denn eine Mädchen- oder Frauenmannschaft. Daher war die Entscheidung schnell getroffen: Sie spielten bei den Jungs mit.
Die zwei Schwestern sind überhaupt nicht eingeschüchtert. Ganz im Gegenteil. Sie freuen sich und finden es lustig, in einer gemischten Mannschaft zu spielen. Schnell können die Mädchen sich behaupten und fallen bei lokalen Turnieren auf. Im Alter von zehn Jahren bestehen Megan und Rachael erfolgreich die Aufnahmetests für das „Class 1 Boys Team“, das höchste Niveau in ihrer Altersklasse. In Zukunft werden sie mit den besten Jungs aus der Region Redding und Nordkalifornien in der Meisterschaft von Sacramento spielen. Sie kennen den Trainer bereits: Jack, der auch Brian einige Jahre zuvor gecoacht hat. Die zwei fühlen sich sofort wohl in der U12-Mannschaft. Doch Denise und Jim, die mit ihren Töchtern durch ganz Kalifornien reisen, merken schnell, dass es so nicht weitergehen kann: In der folgenden Saison werden sie eine Frauenmannschaft auf die Beine stellen müssen.
Dass zwei Mädchen in der Mannschaft mitspielen, stößt im Süden des Bundesstaates auf Unbehagen. Einige Eltern heißen eine gemischte Gruppe nicht gut und scheuen sich keineswegs, dies am Spielfeldrand kundzutun. Sie sind verärgert, dass die zwei Mädchen ihren Söhnen zeigen, wo es langgeht, und verlangen, dass sie vom Spielfeld gehen. Sie ermutigen ihre Kinder sogar, sich das nicht gefallen zu lassen, sich diesen „Eindringlingen“ zu widersetzen, mit all ihrer Körpergröße, ihrer Muskelkraft und ihrer „Männlichkeit“ Auf einmal kommt es vor, dass die Gegner im direkten Zweikampf mit den zwei jungen Mädchen härter und aggressiver auftreten. Zum Glück sind Megan und Rachael innerhalb der eigenen Mannschaft sehr beliebt und geschätzt; ihre Teamkameraden bestehen darauf, dass sie weitermachen. Allerdings reicht die Unterstützung von Trainer und Mannschaft allein nicht aus. Die Zwillinge leiden zunehmend unter der Situation.
So kommt es, dass Jim Rapinoe drei Jahre lang seine Töchter trainiert. Der Vater übernimmt Verantwortung, denn: Wenn er es nicht macht, dann macht es niemand. Mutter Denise kümmert sich mit dem Rest der Familie darum, andere Mitspielerinnen zu finden, indem sie Eltern aus der ganzen Region zusammenrufen. Der Plan geht auf, und sie gründen die erste Frauenmannschaft: die Mavericks United. Die Mädchen trainieren in Redding und reisen bis Sacramento, um an Turnieren teilzunehmen. Aber aller Anfang ist schwer. Die Mannschaft muss einige Enttäuschungen wegstecken, bevor sie erste Siege erzielt.
Sommer 1996, Olympische Spiele von Atlanta. Megan verbringt ihre Tage vor dem Fernseher, sitzt stundenlang gebannt vor dem Bildschirm und begeistert sich für alle Disziplinen. Denise ist beeindruckt von dem Interesse ihrer elfjährigen Tochter. Jeden Abend beim gemeinsamen Essen berichtet Megan ihrer Familie detailliert von den Ergebnissen und Erfolgen des jeweiligen Tages – ihre Mutter ist von diesem Enthusiasmus überrascht. Nachdem Michael Johnson den Doppelsieg über 200 und 400 Meter erlangt hat, wird er zu Megans Lieblingssportler.
Herbst 1996, Junction School. In den Sommerferien hat sich die Einstellung der Schüler geändert; die sechste Klasse beginnt. Rachael und Megan sind inmitten der Jungs aus Palo Cedro aufgewachsen. Sie haben Sport mit ihnen getrieben, große Abenteuer erlebt. Doch der Schulbeginn bedeutet eine Zäsur, eine offensichtliche Änderung im Verhalten, in Megans Augen unverständlich und absurd: Auf einmal stehen die Jungs auf der einen Seite, die Mädchen quatschen auf der anderen und schwärmen plötzlich alle für Jonathan Taylor Thomas, den Jungschauspieler aus der Fernsehserie Hör mal, wer da hämmert. Beim Mittagessen sprechen die Mädchen nur noch über Jungs und darüber, wer der süßeste, lustigste oder netteste ist.
Bis zum Ende dieser besagten Sommerferien lief für Megan alles bestens. Sie hatte Freunde, wusste, wie sie sich zu verhalten hatte, und war mutig genug, um den älteren Jungs aus der Achten, die sich auf dem Pausenhof aufspielten, Kontra zu geben. Doch über Nacht war alles auf einmal anders. Ihre Welt stürzte zusammen, und sie fühlte sich ausgeschlossen.
Megan hat sich nie als Mädchen definiert, was sie auch nie sonderlich gestört hat. Doch auf einmal weiß sie nicht genau, wer sie ist und was mit ihr geschieht. Aus der Ferne beobachtet sie, wie ihre Klassenkameradinnen und auch ihre Zwillingsschwester einen Freund nach dem anderen haben, während sie sich immer mehr zurückzieht und sich vollkommen verloren fühlt.
Damals hört sie zum ersten Mal das seltsame Wort Tomboy. Es bezeichnet ein Mädchen, das sich sehr wild oder ungestüm verhält und somit nicht die typisch mädchenhaften Attribute aufweist. Oder eben auch ein junges Mädchen, das sich ein Poster von Michael Jordan an die Wand hängt, das überglücklich ist, wenn es „Jordan 11“-Baskettballschuhe geschenkt bekommt, das niemals sein Sweatshirt von den Cowboys, dem Footballteam aus Dallas, auszieht und die Atlanta Braves unterstützt, die in der Major League Baseball spielen. Jordan, die Cowboys und die Braves sind die Vorbilder dieses jungen Mädchens, das sich zunehmend über den Sport definieren wird. Obwohl Megan im Schulsport nie eine bessere Note als ein B bekommt, was einer Zwei minus im deutschen Notensystem entspricht. In der Schule kämpft sie nicht bis zum Umfallen.
Zum Glück ist Rachael während dieser Zeit an Megans Seite. Das stille, schüchterne und beinahe stumme Mädchen aus der Grundschule hat sich zu einer selbstsicheren, jungen Dame gemausert, die problemlos in Schule und Freizeit zurechtkommt. Megan folgt ihr auf Schritt und Tritt, wie ein Schatten, oder wie diese kleinen Pilotfische, die ständig neben Haien oder Mantarochen herschwimmen. „Ich war wie Nemo [der Held aus dem gleichnamigen Pixar-Film, der 2003 in die Kinos kam, Anm. d. A.], der immer fragt: Und was machen wir heute? Rachael hat mich gerettet“, gesteht sie später, als sie das Trauma jener zwei düsteren Jahre überwunden hat.
Seitdem ist Megan mehrere Male an die Junction School zurückgekehrt, um ihren ehemaligen Lehrkräften Hallo zu sagen oder auch, um einfach nur Schüler zu treffen, wie zum Beispiel Ende August 2011, nach der Weltmeisterschaft in Deutschland.
In der Schulsporthalle, wo noch immer ihre Urkunde als Sportlerin des Schuljahres 1999/2000 hängt, neben der von ihr erzielten Zeit im Shuttle-Run-Test 1998 und den Erfolgen von Rachael im 1-Mile-Run sowie auf 50 Metern, wurde Megan von Gekreische und Jubelrufen empfangen. Sie nahm sich Zeit, schoss drei Elfmeter auf einen jungen Torwart, kickte mit den kleinsten Schülern ein paar Bälle und erinnerte ihr Publikum daran, dass man immer an sich glauben muss. Auch die Lehrer teilten ihre persönlichen Erinnerungen mit. Susan Moreno, Megans ehemalige Englischlehrerin, zeigte einen Text von 1999. Damals hatte Megan geschrieben, eines der wichtigsten Ziele in ihrem Leben sei es, eines Tages für die USA an der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen teilzunehmen.
In der Tat stammt ihr Traum aus dieser Zeit, genauer gesagt entstand er am 4. Juli 1999, im Stadion von Stanford, Kalifornien, während des Halbfinales der Frauenweltmeisterschaft zwischen den USA und Brasilien. Unter den 73.123 Zuschauern sitzen auch Megan und Rachael. Megans blonde Haare sind am Hinterkopf zusammengebunden, auf ihrer Stirn steht in Rot, Blau und Weiß „USA“, die Wangen zieren zwei amerikanische Sterne, sie trägt ein T-Shirt der WM und lächelt unter der brennenden Sonne fröhlich in die Kamera. Am Tag vor ihrem vierzehnten Geburtstag gewinnen die USA mit 2:0 jene Partie, die Megans Leben für immer verändern wird. Denn an genau diesem Tag wird ihr klar: Amerika interessiert sich für Fußball, die Fans jubeln auch für die Frauennationalmannschaft. Sie begreift, Fußball ist nicht bloß ein Spiel für Kinder oder Mädchen, sondern man kann es zu seinem Beruf machen, wie die professionellen Spielerinnen auf dem Platz, die „99ers“, es getan haben. Megan beschließt: Sie wird den gleichen Weg gehen.
Sechs Tage später, am 10. Juli 1999, im Rose-Bowl-Stadion von Pasadena, holen die Amerikanerinnen den zweiten WM-Titel nach Hause, nach dem von 1991. Sie schlagen China im Elfmeterschießen (0:0, 5:4). Die Jubelgeste von Brandi Chastain geht um die Welt. Nachdem sie im Elfmeterschießen den entscheidenden Treffer erzielt hat, zieht die amerikanische Mittelfeldspielerin ihr Trikot aus und schwenkt es wie eine Flagge. Brandi, im schwarzen Sport-BH, wird von ihren Mitspielerinnen umarmt und bejubelt, 90.000 Menschen feiern den Sieg im Stadion. Vor dem Fernseher zu Hause applaudieren die Rapinoes den Weltmeisterinnen. Die Zwillinge sind große Fans von Chastain, Mia Hamm, Julie Foudy und Tiffeny Milbrett. Doch ihr größtes Vorbild und ihre absolute Lieblingsspielerin ist Kristine Lilly. Das Poster mit der Nummer 13 im Trikot der Nationalmannschaft hängt von da an im Kinderzimmer, gleich neben dem von Michael Jordan.
ELK GROVE
„Wenn wir Vollgas geben, kann uns nichts aufhalten. Wir sind nicht länger zehn Einzelpersonen, sondern eine Mannschaft.“
Diese Äußerung stammt aus dem Jahrbuch 2001/2002 der Foothill High School. Sie steht unter dem Foto einer lächelnden Megan Rapinoe, in einem Pullover mit Querstreifen, mit blonden, fast schulterlangen Haaren. Zwei Jahre zuvor sind die spätere Weltmeisterin und ihre Schwester an die Foothill High School gekommen. „A Californian Distinguished School“, lautet die Inschrift auf der Fassade des Hauptgebäudes. Die Schule liegt ungefähr vierzig Kilometer vom Haus der Rapinoes in Palo Cedro entfernt und verspricht, ihre Schüler zu „autonomen Menschen auszubilden, die in der Lage sind, ihren Beitrag zu einer sich ständig wandelnden Welt zu leisten“.
Auf dem Gymnasium besuchen die Mädchen die Oberstufe (von der neunten bis zur zwölften Klasse) und stillen in diesen drei Jahren ihre Gier nach Sport: Sie machen Leichtathletik, spielen Volleyball und vor allem Basketball. Ihre Noten sind ausgezeichnet, und Megan tut sich von Beginn an hervor. Jedes Semester wird sie lobend für ihre herausragenden Leistungen erwähnt. Ihre Klassenkameraden wählen sie zur Sportlerin des Schuljahres 2000/2001, und ihr Name erscheint in Who’s Who Among American High School Students1.
Die Rapinoes gehören in der neunten und zehnten Klasse zum Leichtathletikteam der Schule und spielen drei Jahre lang in der Basketballmannschaft der Mädchen. In dem Jahrbuch der Schule sieht man mehrere Aufnahmen der zwei Schwestern als Basketballspielerinnen: einerseits im weißen Trikot (Megan mit der Nummer 3, Rachael mit der 10), andererseits auch, den Ball in der Hand, in einem zweiten, rot-blauen Trikot, dem ihrer eigenen Mannschaft, den Cougars. Man erkennt sie außerdem auf Bildern, wie sie – in einer Reihe stehend – die Nationalhymne singen (Megan mit gesenktem Kopf), oder wie sie gerade dabei sind, eine ihrer Mitspielerinnen anzuspornen. In dem Buch gibt es auch ein Foto von ihnen beim NBA Day in Foothill: Megan und Rachael tragen Michael Jordans Trikot mit der Nummer 23 zur Schau, das er bei seinem zweiten Comeback am 25. September 2001 trug, als er Teilhaber der Washington Wizards war und beschlossen hatte, noch einmal selbst in die Basketballschuhe zu schlüpfen. Heiter lächeln die beiden und versuchen, die berühmten Posen von M.J. nachzustellen.
Sie lieben Basketball, auch wenn Megan mit ihrer stürmischen Art meistens fünf Fouls kassiert und das Match nicht beenden darf. Angefangen zu spielen haben die zwei Schwestern vor dem Basketballkorb, der an ihrem alten Haus in Oak Meadow hing, unter Anleitung ihres Bruders Brian. Das waren endlose, erbitterte Partien, Frau gegen Frau, in denen die Schwestern ihre Geschicklichkeit und Beharrlichkeit im Zweikampf schulten. In der dritten und vierten Klasse auf der Junction School ging ihr Training in der Sporthalle weiter; sie spielten in einer Jungenmannschaft und scheuten sich nicht, ältere Schüler herauszufordern.
Als sie im Jahr 2000 auf das Gymnasium wechseln, ziehen sie den orangfarbenen Ball mit der Aufschrift Spalding sogar dem schwarzweißen Fußball vor. Der Grund liegt auf der Hand: In der Region finden die Turniere und Meisterschaften im Fuß- und Basketball stets im Winter statt, und die Zwillinge wollen nicht draußen, in der Kälte, bei Wind, Regen und Schnee spielen. Sie tauschen die matschigen Fußballplätze gegen die angenehm temperierten Hallen ein, wo sie während der zweieinhalb Monate der Wintersaison das Körbewerfen trainieren können, und begnügen sich damit, im Sommer Fußball zu spielen, während sie auf den entscheidenden Moment warten.
Damals geht es Megan und Rachael in erster Linie darum, zu spielen und sich auszutoben. Denise und Jim haben ihre Töchter nie dazu gezwungen, sich für eine Sportart zu entscheiden, sie wollten, dass sie einfach Spaß haben. Vater und Mutter dienten lediglich als Fahrer, wenn es darum ging, die zwei Schwestern durch den ganzen Bundesstaat zu chauffieren, winters wie sommers, damit sie an den verschiedenen Partien der Mädchen- und Jungenmannschaften teilnehmen konnten. Nie mischten sie sich ein, sondern unterstützen die Entscheidungen von Megan und Rachael immer. Allerdings bestand Denise in ihrer überbehütenden Art darauf, dass die Mädchen schwimmen lernen und ein Musikinstrument spielen. Mit Erfolg: Megan spielt noch immer Gitarre und ist eine begeisterte Schwimmerin.
Die Zwillinge machten ihre ersten Erfahrungen als Sportlerinnen vollkommen unbeschwert, ohne Erwartungen, ohne Erfolgsdruck, auch wenn sie sich irgendwann entscheiden und sich auf ein Ziel festlegen mussten. Letztendlich fiel Megans und Rachaels Wahl auf Fußball – eine Entscheidung, die sie während ihres ersten Jahres an der Foothill High School trafen und, Ironie des Schicksals, dem Basketball zu verdanken haben.
Die Saison 2000/2001 ist gut gelaufen, die Ergebnisse sind erfreulich gewesen. Während der Play-offs treffen die Cougars in Palo Alto auf die Frauenmannschaft eines katholischen Gymnasiums aus der Region. Das Match zieht reichlich Publikum an: Scouts und Trainer der größten amerikanischen Universitäten, von Standford bis Berkeley, sind gekommen, um die ersten fünf aus nächster Nähe zu sehen. Zur Halbzeit sind die Cougars noch im Spiel und liegen nur zwei Punkte im Rückstand. Doch mit dem Schlusspfiff müssen sie eine herbe Niederlage mit sechsundzwanzig Punkten einstecken. Die Gegnerinnen waren zu stark. Die Basketballspielerinnen von Foothill waren machtlos, auch wenn sie sich die ersten zwanzig Minuten gut geschlagen haben.
Auf dem Rückweg fragt Denise ihre Töchter, ob sie trotz der Play-offs die Saison genossen haben, ob sie im nächsten Jahr weiter Basketball spielen und sich später an einer entsprechenden Universität bewerben wollen. Die Antwort der Zwillinge lautet in etwa: Lieber konzentrieren wir uns von nun an auf Fußball, denn wenn wir ein Stipendium für ein Studium an einer Uni der NCAA Division I2 ergattern wollen, haben wir damit die besseren Chancen.
Die zwei Mädchen sind intelligent und wissen schon jetzt, was sie wollen. Sie werden zwei weitere Saisons in der Basketballmannschaft der Schule spielen, denn dabei fühlen sie sich trotz ihrer Größe – Megan ist 1,68 Meter groß, Rachael 1,64 Meter – wohl, doch danach wird Fußball an erster Stelle stehen.
Der zweite Wendepunkt im Leben der Zwillinge folgt 2001, als der Trainer des Fußballklubs Elk Grove Pride die beiden bei einem Turnier in Redding spielen sieht. „Das Leistungsniveau war sehr bescheiden, und wir haben das Turnier schließlich gewonnen, nachdem wir insbesondere gegen die Mannschaft von Megan und Rachael gespielt hatten. Die zwei Schwestern waren zweifellos die besten Spielerinnen des Wettbewerbs. Sie haben als Trainerinnen auf dem Platz agiert, ihren Kameradinnen Anweisungen gegeben, wie sie sich aufstellen und bewegen sollten“, erinnert sich ihr zukünftiger Coach: Danny Cruz, einundsechzig Jahre alt, der vierzig davon als Trainer auf Fußballplätzen verbracht hat. „Nach dem Spiel habe ich zu den Zwillingen und ihren Eltern gesagt, sie müssten unbedingt bei uns mitspielen. Das war keineswegs eine sichere Sache, denn die zwei Städte liegen weit voneinander entfernt. Umso erstaunter war ich, als Megan und Rachael in der darauffolgenden Woche zum Training erschienen sind. So hat alles angefangen.“
Elk Grove hat 175.000 Einwohner und liegt im Sacramento County, 285 Kilometer von Redding entfernt. Die Fahrt Richtung Süden dauert etwa drei Stunden. 570 Kilometer auf der Interstate 5. Drei Jahre lang wird das zur Standardstrecke der Familie Rapinoe, wenn die Zwillinge im blauen Trikot für Elk Grove Pride, später umbenannt in Sacramento Pride, zu einem Spiel antreten.
Jeden Dienstag nutzt Denise ihren freien Tag, um Megan und Rachael von der Schule abzuholen und sie nach Elk Grove zu fahren, während die Mädchen auf der Rückbank ihre Hausaufgaben erledigen – anfangs noch mit einem einfachen Auto, das jedoch durch einen Van ersetzt wird, der komfortabler, ökonomischer und sicherer ist und die langen Strecken übersteht, ohne dass der Motor auf einmal heftig qualmt. Sobald sie in Elk Grove ankommen, setzt Denise ihre Töchter am Trainingsplatz ab und wartet. Aus den anderthalb Stunden werden häufig zwei, denn die beiden können gar nicht genug kriegen. Abgesehen von ihrer Pünktlichkeit streben Megan und Rachael vor allem nach Perfektion und üben ihre Spielzüge so lange ein, bis sie einwandfrei sitzen.
Danny Cruz ist überwältigt: „Die zwei Mädchen hatten so viel Talent und Fleiß, wie ich es selten gesehen habe. Megan war kreativ, geschickt, unvorhersehbar, sie führte Spielzüge aus, die nur sehr wenige fünfzehn- oder sechzehnjährige Spielerinnen beherrschen. Sie war schnell, hatte einen guten Blick fürs Spiel, konnte alle Positionen im Mittelfeld und im Angriff besetzen. Rachael war eine wahre Naturgewalt, spielte in der Verteidigung, aber, wenn nötig, auch ohne Probleme im Sturm. Die beiden zusammen zu sehen, war ein Hochgenuss, sie fanden sich mit geschlossenen Augen. Beide waren mit Ehrgeiz und Ernst dabei, immer hochkonzentriert. Außergewöhnlich motiviert. Sobald sie auf dem Spielfeld waren, dachten sie nur an eins – ans Gewinnen. Nicht mal im Training sparten sie Kräfte. Manchmal befanden sie sich im direkten Zweikampf, Stürmerin gegen Verteidigerin. Sie ließen einander nichts durchgehen, schrien sich an, kämpften erbittert um jeden Ball. Das zeigt, wie kompetitiv beide schon damals waren.“
Nachdem sie geduscht und sich umgezogen haben, geht es zurück nach Redding. Oft schlafen die Zwillinge auf der Rückfahrt ein. Denise konzentriert sich aufs Fahren, bis sie gegen elf Uhr abends zu Hause ankommen. Meistens fahren sie diese Strecke noch ein zweites Mal pro Woche, wenn eine Extra-Trainingseinheit auf dem Plan steht. Plus die zahlreichen Fahrten am Wochenende zu Spielen und Turnieren. So kommen die Rapinoes in Kalifornien gut herum und besuchen außerdem verschiedene Orte in anderen Bundesstaaten.
„Unsere Mannschaft war gut aufgestellt, neben den Rapinoe-Zwillingen war Verlass auf Stephanie Cox [ursprünglich aus Los Gatos in Kalifornien und Olympiasiegerin in Peking 2008, Anm. d. A.]. Mit ihnen sind wir vom 147. Platz landesweit auf den ersten gerutscht“, erzählt Danny Cruz, inzwischen Trainer bei den Folsom Earthquakes RDS, der immer wieder gern von Megans Erfolgen bei Elk Grove Pride berichtet. „Damals haben wir in der U17-Meisterschaft gegen eine der stärksten Mannschaften des Landes gespielt. Wir lagen zurück, als Megan sich gegen Spielende dazu entschied, die Dinge in die Hand zu nehmen. Sie war wütend auf den Rest ihres Teams, denn sie hatten keinen guten Tag. Sie zog sich also bis an unseren Strafraum zurück und rief der Torhüterin zu, sie solle ihr den Ball geben. Von dort aus lief sie über das ganze Feld, umspielte die Gegnerinnen, die sich ihr in den Weg stellten, eine nach der anderen, und schoss ein traumhaftes Tor, eines wie Maradona. Ein unvergesslicher Moment. 2003 haben wir sogar die regionalen Meisterschaften und die auf Bundesstaatsebene gewonnen und sind Vizelandesmeisterinnen geworden. Und dabei spielten wir nicht in unserer, sondern in einer höheren Altersklasse.“
Megan und Rachael leben für ihren Sport: Die meisten Einladungen zu Partys mit ihren Freunden müssen sie ablehnen. Familientreffen zu Thanksgiving oder gemeinsame Ferien werden oft wegen eines Turnieres in einem anderen Bundesstaat verschoben. Elk Grove ist die einzige Möglichkeit für sie, ihre einzige Chance, auf einem gewissen Level zu spielen und zu den Hoffnungsträgerinnen des Landes zu zählen. Megan hat man schon seit einiger Zeit im Auge: Zuerst nahm sie am Olympic Development Program (ODP) für Jugendliche unter vierzehn Jahren teil, anschließend, im Juni 2002, an einem Sichtungslehrgang in Houston, und reiste zudem mit der U17-Frauenmannschaft nach Frankreich. „Ich wusste, sie würde irgendwann ganz oben stehen, sie würde ein Star werden“, erklärt Cruz, „denn sie wusste schon damals, als sie in unserem Team anfing, ganz genau, wohin sie wollte; sie hat immer gesagt, dass sie eines Tages das Trikot der Nationalmannschaft tragen wird. Das war von Anfang an ihr Ziel …“
_______________
1 Who’s Who Among American High School Students ist eine Auflistung der amerikanischen Schüler und Studenten (in Buchform sowie als Internetseite, inzwischen allerdings wegen Insolvenz nicht mehr online), die sich durch besondere Leistungen oder andere Errungenschaften hervorgetan haben.
2 Die NCAA Division I (D-I) ist die höchste Stufe der Sportprogramme von vielen amerikanischen Universitäten, die von der National Collegiate Athletic Association (NCAA) in den USA anerkannt ist. An den D-I-Schulen besitzen die wichtigsten Hochschulsportarten größere Budgets, umfangreichere Einrichtungen und mehr Sportstipendien als in den Divisions II und III sowie an vielen kleineren Schulen, die sich für die höchste Ebene an interkollegialem Wettbewerb entschieden haben.