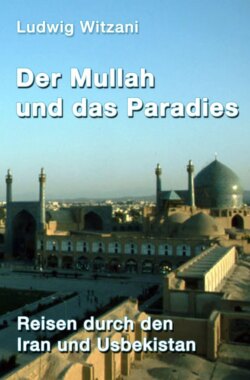Читать книгу Der Mullah und das Paradies - Ludwig Witzani - Страница 9
ОглавлениеDer Ayatollah
in der Einbahnstraße
Tage in Teheran
Als ich in den Iran aufbrach, stand die Welt an der Schwelle des dritten Jahrtausends. Die Erinnerung an den Sieg der Freiheit über den totalitären Sozialismus in Osteuropa war noch frisch, und noch vermochte sich niemand vorzustellen, welche Blutspur der Islamismus, diese Geißel des 21. Jahrhunderts, in den nächsten Jahren durch die ganze Welt ziehen würde. Der Islam war noch nicht der ungebärdige Aufwühler der Welt, sondern erschien dem oberflächlichen Blick noch immer als der milde, pittoreske Bruder des Okzidents, in dessen Städten sich der Reisende aus den kalten Gesellschaften des Westens eine Zeitlang an den Wonnen der Gemeinschaftlichkeit laben konnte. Selbst im Iran, der jahrzehntelang unter Revolution und Krieg gelitten hatte, schienen sich die Verhältnisse zu beruhigen. Eines der prachtvollsten und interessantesten Länder der Erde öffnete seine Pforten für die, die es sehen wollten. Ich besorgte mir ein Visum, packte meinen Rucksack, verstaute meine Kaffeevorräte und meine Bücher und brach auf.
*
Ich fuhr alleine zum Köln-Bonner Flughafen und checkte mein Gepäck am Schalter der Turkish Airlines ein. Zur Zeit gab es keine preisgünstigere Verbindung nach Teheran als einen Flug mit Turkish Airlines und einem Zwischenstop in Istanbul. Es war Wochenende, die Maschine war heftig überbucht, und es dauerte fast eine Stunde, ehe die Mitarbeiter der Fluggesellschaft genügend Passagiere überreden konnten, gegen üppige Kompensationen zurückzutreten.
Im Unterschied zu anderen Großraumflugzeugen war der Innenraum des Airbusses nicht unterteilt, so dass der gesamte Passagierraum von hinten nach vorne übersehbar war. Einen Moment lang erschienen mir die etwa dreihundert Passagiere, die vor mir saßen, wie die Besucher eines altertümlichen Kinos, die alle gebannt nach vorne starrten, obwohl es keine Leinwand gab. Bizarr wurde es, als die Maschine der Turkish Airlines beim Aufsteigen erschreckend ins Trudeln geriet und die Hinterköpfe der Passagiere allesamt in gleichen Takt hin- und her wackelten. Jeder Flug ist eine kleine Anfrage an den Tod, die gottlob meistens abschlägig beschieden wird.
Das Umsteigen in Istanbul ging problemlos vonstatten. Die Bombenanschläge späterer Jahre lagen noch weit in der Zukunft. Unbewacht lag das Gepäck in den Gängen, nirgendwo war Flughafenpolizei zu sehen. Auch der Anschlussflug von Istanbul nach Teheran war ruhig. Tief unter mir erkannte ich die Umrisse des Van Sees, aus der Höhe wirkte er wie ein seifiges Auge in einem zerklüfteten Gesicht. Heute tobt dort der türkisch-kurdische Bürgerkrieg. Es folgten die schneebedeckten Gipfel des türkisch-iranischen Grenzgebietes, schließlich die grünen Felder Iranisch-Aserbeidschans, dann Berge und Wüsten. Der größte Teil des Irans mit seinen immerhin 1,6 Millionen Quadratkilometern Fläche besteht aus Wüsten, Sandwüsten, Geröllwüsten, Steinwüsten, dann und wann einmal eine Oase, ein Bergzug, bis die nächste Wüste kommt. Kaum zu glauben, dass fast achtzig Millionen Menschen im Iran leben, wenngleich die überwiegende Mehrheit in den städtischen Ballungsräumen, deren größter die Hauptstadt Teheran ist. Ich schloss die Augen und versuchte mir vorzustellen, was mich erwartete. Auf jeden Fall ein lebhaftes Straßenbild, denn wenn man den Statistiken glauben durfte, lag das Durchschnittsalter der Bevölkerung inzwischen unter zwanzig Jahren, und unglaubliche vierzig Prozent der Iraner waren nicht einmal 14 Jahre alt. Kein Land für flächendeckende Kita-Betreuung.
Kaum war das Flugzeug auf dem Ajatollah Chomeini Airport in Teheran gelandet, griffen alle weiblichen Passagiere wie auf Kommando zum Tschador. Graue, schwarze, blondierte, rote, lange oder kurze Haare verschwanden unter dunklen Tüchern. Bildschöne Iranerinnen, die soeben noch mit dem Steward geflirtet hatten, junge Mädchen und ehrwürdige Großmütter, sogar die Touristinnen legten Kopftücher an und traten sorgfältig verschleiert vor die Passkontrolle als näherten sie sich einem Beichtstuhl. Doch die Einreisekontrollen verliefen locker und entspannt. Wo man Horden schiefmäuliger Tugendwächter erwartet hatte, die nur darauf warteten, jeden Ungläubigen bei der Einreise zu drangsalieren, knallte mir ein freundlicher Beamter ohne große Umstände den Stempel in den Pass. Lässig an seinem Tee nippend, winkte mich der Zollbeamte durch. Ich war im Iran.
Vor dem Flughafen stürzte sofort ein halbes Dutzend Taxifahrer auf mich ein. Alle bestürmten mich mit den unterschiedlichsten Angeboten, denen nur eines gemeinsam war, ein unglaublich niedriger Preis. Der fortdauernde Wirtschaftsboykott der westlichen Staaten gegen den Iran hatte dem Rial, der iranischen Währung, übel mitgespielt, so dass die Kaufkraft von Euro und Dollar innerhalb des Irans geradezu unglaublich war. Ich wählte den zurückhaltendsten Anbieter, verfrachtete mein Gepäck im Kofferraum und nannte den Namen meines Hotels. Der Taxifahrer war tadellos gekleidet, duftete nach einem dezenten Herrenparfum und trug seinen pechschwarzen Haare wie angeklebt an seinem langgezogenen Kopf. Ich notierte: Der Iraner als Angehöriger eines alten Kulturvolkes zeigt seinen Rang in der Akkuratesse seiner Frisur. Aber welcher Bevölkerungsgruppe mochte er angehören? Nur die Hälfte der Iraner waren ethnische Perser. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung waren türkischstämmige Aserbaidschaner, knapp zehn Prozent Kurden, und der Rest teilte sich auf in Araber, Tadschiken, Belutschistanis und andere Minderheiten. Die Gesichtszüge des Taxifahrers waren europid, er besaß einen messerscharfen Nasenrücken, einen geschmäcklerischen Mund und dunkle, ausdrucksstarke Augen unter dichten Augenbrauen. Wahrscheinlich war er ein Perser.
Auf halber Strecke zwischen Flughafen und Innenstadt stoppte der Taxifahrer am Straßenrand und verwies auf einen großflächigen Kreisverkehr, in dessen Mitte sich ein riesenhaftes Steingebilde auf einer weitflächigen Verkehrsinsel befand. Es handelte sich um das sogenannte Azadi-Monument, ein 45 Meter hohes altorientalisches Portal, das so weiß und vereinzelt in der Mitte des Kreisverkehrs stand, als sei es geradewegs aus dem Reich der Achaimeniden in die Gegenwart geflogen. In seiner Größe und mit seiner breiten Basis glich es einem überdimensionalen Christbaumständer ohne Baum. Niemand geringeres als Schah Muhammed Reza Pahlavi hatte das Azadi-Riesentor im Jahre 1971 zur Erinnerung an die Gründung des persischen Weltreiches vor 2500 Jahren errichten lassen, ein beachtliches Jubiläum, das nicht nur weit hinter die Entstehung des Islams, sondern auch bis hinter die Anfänge Europas zurückging. Schah Reza Pahlavi griff wahrscheinlich deswegen so weit in die Vergangenheit zurück, um dazulegen, dass der Islam nur eine Episode in der Jahrtausende langen Geschichte des Irans gewesen sei. Ich rechnete zweieinhalbtausend Jahre zurück und kam auf das Jahr 529 vor der Zeitrechnung, auf das Jahr, in dem Kyros der Große, der Gründer des persischen Weltreiches, in Zentralasien im Kampf gegen die Skythen den Tod gefunden hatte. Ein schlechtes Omen für das Monument, wie sich bald zeigen sollte, denn der moderne, verwestlichte Iran mit seinen Jahrtausende alten Wurzeln in der vorislamischen Zeit erwies sich als eine Schimäre. Nur acht Jahre nach der Fertigstellung des Azadi-Monuments erhoben sich die verarmten Massen in der Teheraner Südstadt unter der Führung der Mullahs gegen den Schah und fegten sein modernistisches Regiment hinweg.
Azadi-Monument / Teheran
Die Dämmerung brach über Teheran herein, als wir weiterfuhren, und als mich der Taxifahrer vor dem Hotel absetzte, war es schon dunkel. An der Rezeption erfuhr ich, dass mein Zimmer nicht frei war. Der Gast, der heute morgen hatte auschecken sollen, war einfach im Zimmer geblieben, weil er erst in der Nacht weiterfliegen würde. „Aber das macht doch nichts“, versicherte mir der Empfangschef in gutturalem Englisch, ein gertenschlanker Iraner mit einer langen Hakennase, die ihm wie eine immerwährende Verneinung im Gesicht stand. Er führte mich in einen Nebenraum, in dem zwei Sofas standen. „Hier können Sie sich ausruhen, bis ihr Zimmer frei wird“. Ich tat, wie mir geheißen und schlief sofort ein. Mitten in der Nacht wurde ich geweckt, mein Vormieter war endlich ausgezogen. Ich stolperte ins Zimmer, knallte meinen Rucksack in die Ecke und schlief wieder ein.
*
Am nächsten Morgen lag über Teheran der milde Glanz einer herbstlichen Sonne. Was sie beschien, war weniger erbaulich. Vom sechsten Stock meines Hotels aus überblickte ich ein graubraunes Häusermeer ohne jede markante Silhouette, eine fragmentierte Steppdecke aus Beton, die sich bis zum Horizont erstreckte. Es war gerade Frühstückszeit, doch schon drang der Verkehrslärm wie eine Heimsuchung in mein Zimmer, eine kakofone Morgensinfonie aus Hupen, Bremsen, Quietschen und dem eigentümlichen Rauschen, das die Fortbewegung abertausender Fahrzeuge erzeugt. Teheran, eine Stadt, mehrfach so groß wie München mit einem Straßennetz, das kleiner ist als das von Köln und der zehnfachen Menge an Autos. Das konnte heiter werden.
Der Frühstücksraum befand sich im ersten Stock des Hotels. Es war ein langgezogener, schmuckloser Saal mit hässlichen Gardinen vor einer trüben Fensterfront. Etwa ein Dutzend Iraner saßen an Tischen ohne Tischdecken, tranken Tschai und aßen Fladenbrot mit Konfitüre und Ziegenkäse. Die Männer sahen aus wie orientalische Scheichs, die man in zu enge Anzüge gesteckt hatte, ihre Bewegungen waren langsam und würdevoll, selbst wenn sie zum Fladenbrot griffen. Die Frauen trugen körperverhüllende Kleider und schwarze Kopftücher, hatten aber jede Menge Rouge aufgelegt. Ich setzte mich zu zwei deutschen Touristen an den Tisch. Sie stellten sich als Johannes und Lothar aus dem Rheinland vor und waren natürlich Lehrer, was mich nicht überraschte, weil man kein asiatisches Land bereisen kann, ohne nicht auf Schritt und Tritt auf Lehrer zu treffen. Johannes hatte große, kreisrunde Augen, die nicht zu seinem wetterzerfurchten Gesicht passen wollten, er war eine offenherzige und freundliche Natur, die mich gleich in das Gespräch einbezog. Lothar schien etwas jünger zu sein, ein Schlaumeier mit Pausbacken, der sich gerade über asiatische Hauptstädte ausließ. „Denk doch mal, welch traditionsreiche Städte Indien besaß, doch die Briten machten das geschichtslose Kalkutta zu ihrer Hauptstadt. Und in Thailand war es ganz ähnlich. Bangkok ist gerade mal erst zweihundert Jahre alt. Und genauso verhält es sich auch im Iran. Isfahan, Schiras, Maschad, alles ehrwürdige Städte, aber die Hauptstadt des Landes wurde Teheran, ein unscheinbarer Ort am Rande des Landes.“
Sprach´s und biss in sein Fladenbrot und blickte fragend in die Runde, als hätte er ein Rätsel formuliert, das sofort gelöst werden musste.
„Ist wie bei meinem Nachbarn“, meinte Johannes und grinste, „Der hat seine altehrwürdige Gattin auch in die Wüste geschickt und sich was Frisches genommen.“
Ich hatte mir inzwischen einen Tschai besorgt und trank einen Schluck. Der Tee war stark, mit einer Spur Ingwer gewürzt und vorgezuckert. Ich fragte die beiden, wie lange sie schon in der Stadt seien.
„Viel zu lange“, antwortete Lothar, „denn in Teheran gibt es kaum was zu sehen.“
Zwei junge westliche Frauen betraten den Raum. Man erkannte sie an der legeren Kleidung, auch wenn beide ein Kopftuch trugen, allerdings weniger als Verhüllung, sondern als modisches Accessoire. Dass sie in dem gleichen Raum wie die Männer frühstücken durften, wollte ich als Zeichen des liberalen Wandels deuten, von dem überall behauptet wurde, dass er im Iran in vollem Gange sei. Doch als die beiden jungen Frauen zu uns kommen wollten, verwies der Ober sie rigoros die Ecke des Raumes, die für allein reisende Frauen vorgesehen war. Die beiden nahmen es mit Humor, winkten kurz zu uns herüber und gingen ans Buffet.
„Kennt ihr die?“ fragte ich.
„Nein“, gab Johannes zurück. „Alleinreisende Frauen kennenzulernen ist im Iran etwas schwierig.“
„Wieso das?“
„Du wirst schon sehen.“
Da das Hotel relativ zentral lag, verzichtete ich auf ein Taxi und lief nach dem Frühstück zu Fuß durch die Stadt. Viel langsamer als die Fahrzeuge war ich auch nicht, denn überall verstopften regelrechte Blechlawinen Straßen und Kreuzungen. Es gab zwar Ampelanlagen und jede Menge Einbahnstraßen, doch die Befolgung der Verkehrsregeln schien Ansichtssache zu sein. Ampeln bei rot zu überfahren– die normalste Sache der Welt, in die Einbahnstraße verkehrt herum hineinzufahren – offenbar kein großes Ding. Selbst die Abbilder grimmig dreinblickender Ajatollahs, oft direkt neben den Verkehrsschildern postiert, vermochten nur wenige Verkehrssünder abzuschrecken. Auch auf den Bürgersteigen herrschte Hektik. Im Unterschied zu Karachi oder Marrakesch, wo sich die meisten Fußgänger im Slow-Motion-Modus über die Straßen bewegen, schien an diesem Morgen in Teheran jedermann etwas Dringliches vorzuhaben. Armeschlenkern, Tunnelblick, scharfe Kurven und immer wieder ein „Bebakhshid“ (Entschuldigung) wenn sich jemand an mir vorbeidrängte. Ich befand mich in einer merkwürdig unprägnanten orientalischen Metropole - ohne das malerische Ambiente von Kairo oder Istanbul, aber mit erheblich mehr Verkehr und einer Bevölkerung, deren männliche Hälfte in Turnschuhen und Jeans durch die Gegend lief, während der weibliche Teil sich komplett verschleiert durch die Straßen bewegte. „Wenn eine Iranerin in den Raum kommt, kann man die Lichter löschen“ hatte der persische Dichter Hafiz geschwärmt – eine charmante Lobpreisung vergangener Tage, die in der frommen Gegenwart allerdings bedeutete, dass man sich noch eine Zeitlang mit der Zimmerbeleuchtung würde behelfen müssen. Immerhin konnte man auf der Motahhari-Avenue oder der Teleghani-Street beobachten, dass auch bei den Damen die Dinge in Bewegung gerieten. Rot wie die Rosen von Schiras leuchteten die Lippen mancher Iranerinnen, die mir entgegenkamen, immer mehr kesse Locken lugten unter den Kopftüchern der jungen Frauen scheinbar beiläufig hervor, und sogar die langen schwarzen Umhänge, ursprünglich zur ästhetischen Nivellierung alles Weiblichen entworfen, hatten sich zu Ausgangspunkten modischer Gestaltung entwickelt. Kein Wunder, dass ich bei diesen Begegnungen an Azila denken musste, an ihre tiefdunklen Augen, die bronzefarbene Haut, das üppige, schwarze Haar und ihre blitzweißen Zähne. Hier in Teheran würde man von Azilas Reizen nichts sehen, sie wären verhüllt unter schwarzem Tuch, und nur der Ehemann würde sich, wann immer es ihn danach verlangte, an ihnen laben dürfen. Die andere, die männliche Hälfte der Bevölkerung, kam in trister Maskulinität daher. Die Polizisten liefen über die Straßen, als hätten sie ein Brett im Kreuz, die jungen Männer präsentierten ihre blanken Oberarme in gefaketen westlichen Muskel-Shirts, und die älteren Herren bewegten sich mit ihren Bäuchen wie mobile Schaukelstühle über die Straße.
Eine weitere Besonderheit des Straßenbildes, das ich in dieser Form noch nirgendwo gesehen hatte, bestand in der flächendeckenden Plakatierung des öffentlichen Raumes mit den Konterfeis von Märtyrern oder heiligen Männern. Wo in unseren Breitengraden Figuren mit lachenden Gesichtern für Automobile oder Handys werben, blickten in Teheran an jeder Ecke Krieger oder Ayatollahs mit Leichenbittermienen auf das Volk hernieder, allen voran natürlich Ayatollah Chomeini, der Revolutionsführer und Staatsgründer, der auf der nach oben offenen Verehrungsskala des Normaliraners gleich hinter dem Propheten rangiert. So viele Haken ich auch auf den Straßen schlug, so viele öffentliche Plätze und Parks ich auch besuchte, immer begrüßte mich ein Bild des großen Ayatollahs, der mit einem solchen Trauerblick auf die Angehörigen seines Volkes nieder blickte, dass ich mich unwillkürlich fragte, ob die Iraner darüber nicht depressiv werden müssten. So mein erster Eindruck, der sich bald als falsch herausstellen sollte. Denn im weiteren Verlauf meiner Reise sollte ich lernen, dass sich der grimmige Gesichtsausdruck des Ayatollahs und das Lebensgefühl des Iraners ebenso umgekehrt proportional zueinander verhielten wie die öffentliche Parteipropaganda der SED und das alltägliche Leben der Menschen in der ehemaligen DDR. Während die flächendeckend eingesetzten kommunistischen Mobilisierungsparolen in Berlin oder Leipzig den Eindruck erweckten, das Volk hätte nichts anderes zu tun als 24 Stunden am Tag für das Gemeinwohl zu rackern, ließ es sich, wie man heute weiß, im Schatten dieser Parolen recht gemütlich leben. Mit der Leichenbittermiene des Ayatollahs und der Befindlichkeit seines Volkes verhielt es sich ebenso. Würde man im Angesicht der Trauerfalten des hochverehrten Staatsgründers mutmaßen, das ganze Volk greine von morgens bis abends, wurde unterhalb der großen Chomeini-Plakate genauso gelacht wie anderswo. Spricht man die Iraner direkt an (natürlich nur die Männer) erwiesen sie sich als freundlich und hilfsbereit, waren aber nicht immer in der Lage, mir bei der Orientierung in Teheran weiterzuhelfen. Denn die siegreichen Revolutionäre hatten mit der Umbenennung von Straßen und Plätzen derart vollständige Arbeit geleistet, dass selbst die Einheimischen ins Schleudern gerieten. Auch die Namen der Sehenswürdigkeiten waren verändert worden, von der Tendenz der Präsentationen ganz zu schweigen. Die Paläste des Schah waren längst in „Museen des Despotismus“ umfunktioniert worden, und die ehemalige amerikanische Botschaft, die während der Geiselnahme im Jahre 1979 im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gestanden hatte, firmierte heute als „Museum der US-Spionage“. Nur das Iranische Nationalmuseum hatte seinen Namen behalten, war aber wegen Umbauten geschlossen. Das war ärgerlich, denn es handelte sich zweifellos um die größte kulturelle Attraktion, die die Stadt zu bieten hatte. Die Exponate des Museums deckten einen Zeitraum von über achttausend Jahren ab, und sie waren in zwei Hauptgebäuden, je einem für die vorislamische und die islamischen Periode, untergebracht. Das hörte sich nicht besonders aufregend an, und doch waren diese Exponate Zeugnisse einer Hochkultur, die vom Anfang der Zeiten an in der allerersten Liga der Weltgeschichte mitgespielt hatte. Selbst innerhalb der altorientalischen Geschichte war der Iran mit dem Reich Elam bereits mit von der Partie gewesen, das hätte ich mir im Museum gerne angeschaut. Wie stellte sich die Überwindung der altiranischen Hochkultur durch die arabischen Eroberer im Spiegel der Baukunst dar? Und vor allem: wie wurde dieser Wandel von den neuen Herren präsentiert? In der Kulturgeschichte hieß es, dass der Iran durch den Einfall der Seldschuken und Mongolen zwischen dem zehnten bis fünfzehnten Jahrhundert rebarbarisiert worden war. Konnte man das an den Exponaten sehen?
Ich blickte mich um, ein junger Mann kam vorbei und blieb vor mir stehen. „Museum“, sagte er und wies auf den Eingang. Er trug eine modische Jeans und ein kurzärmliges Hemd. In seinen Augen flackerte es, als überlege er fieberhaft, wie er diese Begegnung auswerten könne. „Stimmt“, antwortete ich. „Closed“, fügte hinzu und verführte mit der rechten Hand eine wischende Handbewegung. „Stimmt auch“, gab ich zurück. „Cigarette?“ fragte er. „No smoking“, antwortete ich. Er nickte, als hätte er so etwas schon erwartet, drehte sich um und ging weiter.
*
Nach einigen Stunden des Flanierens setzte ich mich in ein kleines Garküchenrestaurant, bestellte einen Tee und aß drei Spieße, einen vom Lamm, einen vom Rind und einen von der Ziege. Alle drei Spieße sahen identisch aus und schmeckten auch so, was mich zu der Frage führte, ob sich die Einheit der Schöpfung nicht darin erweise, dass alles tierische Fleisch, einmal gut durchgebraten, gleich schmeckte. Ich beobachtete, wie meine Tischnachbarn den Zucker nicht im Tee verrührten, sondern in den Mund nahmen, um dann erst den Tee zu trinken. Ich tat es ihnen gleich und spürte, wie sich der bittere Tee im Kontakt zu dem Zucker in meinem Mund süßte, allerdings in einer Zeitverzögerung, deren Intervalle ich selbst bestimmen konnte. Die kleine Freiheit des Orientalen, da sieh mal einer an. Mir wurde sogar eine Wasserpfeife angeboten, was ich so freundlich wie möglich ablehnte. Schade war, dass sich im ganzen Raum keine Frau befand. Dafür roch es sehr würzig, nach deftigem Männerschweiß mit einem Schuss Gehacktem.
Nach dem Essen wurde ich müde und entschloss mich, einen Taxifahrer anzuheuern, um mit ihm in die Innenstadt zu fahren. Kaum hatte ich die Hand gehoben, hielt auch schon ein Taxi neben mir, dessen Fahrer so spontan aus dem Wagen sprang, als begrüße er in meiner Person einen alten, lang gesuchten Bekannten. Er war behaart wie ein kaukasischer Urmensch, klein, gedrungen und ungemein muskulös, doch unter seinen buschigen Augenbrauen blickte er mit den Augen eines Kindes in die Welt. Er stellte sich als Anatol vor und behauptete in einem passablen Englisch, als armenischer Taxifahrer die Stadt besser zu kennen als die Teheraner selbst, weil die nie über ihr Viertel hinauskämen. Ich nannte ihm die Sehenswürdigkeiten, die ich besuchen wollte, und er nickte eifrig, als wären es genau diese Orte gewesen, die er mir im Rahmen seiner idealen Stadtrundfahrt hatte zeigen wollen. Ich wurde auf die Rückbank verfrachtet und kam auf eine alte Pferdedecke zu sitzen, von der ich gar nicht wissen wollte, was schon alles unter ihr gelegen hatte. Dann ging es los, und ich merkte schnell, dass Autofahren in der Innenstadt von Teheran bedeutet, sich in einer Abart eines mobilen catch-as-catch-can gegenseitig über die Straße zu jagen. Es wurde gehupt, geschnitten, gebremst, geflucht, als verwandele sich der Iraner hinter dem Steuer in einen wilden Krieger. Gerade mal ein paar Cent bezahlt der iranische Autofahrer übrigens in seinem ölreichen Heimatland für einen Liter Benzin, und niemand würde sich unter diesen Umständen wundern, dass im Land der Ayatollahs sowohl die Ökosteuer wie das Drei-Liter-Auto noch lange auf sich warten lassen werden. Warum bei diesen Ölpreisen überhaupt Atomkraftwerke im Iran gebaut werden mussten, war immer schon ein Rätsel gewesen. Aber das war wieder eine ganz andere Geschichte.
Fast eine dreiviertel Stunde benötigte das Taxi, ehe es die Motahhari-Moschee erreichte. Sie wurde in allen Reiseführer als die älteste und größte Moschee Teherans gerühmt, und wenn ich schon mal vor Ort war, wollte ich sie mir auch ansehen. Was mir als erstes auffiel, war, dass sie acht Minarette besaß, was mich verwunderte, da im Islam nur die Kaaba-Moschee in Mekka mehr als sechs Minarette besaß. Wie ich außerdem bald feststellen musste, erschienen in Teheran nicht alle Tage Einzelreisende am Eingang der Motahhari-Moschee, so dass unter Türstehern und Offiziellen eine große Konfusion ausbrach, wie mit mir als unerwartetem Besucher zu verfahren sei. Der Iraner im Zustand der Ratlosigkeit war zweifellos ein sehenswerter Anblick, manche schauten mich neugierig an, andere beäugten mich nicht ohne Misstrauen, denn zweifellos war ich ein Ungläubiger, dem man schon aus Prinzip nicht über den Weg trauen durfte. Alle aber legten Wert darauf, ihre Meinung kundzutun, so dass ein minutenlanges Palaver einsetze, ohne dass etwas geschah. Ich wollte schon aufgeben, da erschien ein Amtmann im langen schwarzen Kaftan mit weißem Käppi, der mich an zwei schwer bewaffneten Soldaten vorbei in das Büro des örtlichen Mullahs führte, um mir ein Formular in Iranisch vorzulegen, von dem ich kein Wort verstand. Dass ich als Tourist so großen Wert darauf legte, ihre Moschee zu besuchen, schien die frommen Herren für mich einzunehmen, dass ich das Formular aber nicht ausfüllen konnte, verursachte ihnen Bauchschmerzen. Schließlich musste ich meinen Pass abgeben und durfte an der Seite des Amtmannes durch die Moschee spazieren. Auch wenn ich heute weiß, dass die Motahhari-Moschee im Vergleich zu den großen Bauwerken in Isfahan, Schiras oder Maschad architektonisch nichts Besonderes darstellt, erblickte ich an diesem Tag zum ersten Mal eine iranische Moschee von innen und war sofort hingerissen. Was mich in besonderer Weise ansprach, war der iranische Iwan, ein dreiseitig eingefasster überwölbter Torbogen, der viel höher als breit ist und der oben in einer Art Spitzbogen abschließt. Im Unterschied zum arabischen, maghrebinischen oder türkischen Kulturraum waren im Iran die Wände der Moscheen mit Fayencen bedeckt, meistens stellten sie Girlanden, Koranverse oder abstrakte Mustern dar, die in ihrer blauen Grundfarbe den Gebäuden eine Farbigkeit verleihen, mit der die Moscheen im übrigen moslemischen Kulturkreis nicht aufwarten können. Die Motahhari-Moschee besaß in ihrem Innenhof einen gepflegten kleinen Garten mit einem Brunnen in der Mitte und zahlreichen Studierstuben im hinteren Teil des Gebäudes. Offenbar war der Moschee eine Medrese, eine islamische Lehranstalt, angeschlossen. Junge Männer mit langen Kaftanen und Bärten liefen über den Innenhof und verschwanden in den kleinen Studierzellen. Ich fragte mich, was sie hier lernen würden. Mathematik, Philosophie, Geschichte? Oder ausschließlich die Suren des Korans, weil es nichts Wichtigeres gab als das einmal und für alle Zeiten geweissagte Wort Gottes? Wilde Rosen glänzten in der Sonne, das Brunnenwasser plätscherte, und ich hörte die Stimmen einer leisen Disputation. Worüber sprachen die jungen Männer? Über den Koran? Den Stundenplan oder die Brotpreise? Gerne hätte ich im Innenhof der Moschee noch ein wenig verweilt, nachgedacht oder geschrieben, doch dem Ungläubigen war an diesem Tag nur ein kurzer Besuch gestattet. Schon nach einer Viertelstunde wurde ich wieder vor die Türe gesetzt. Anatol hielt die Türe zu seinem Taxi auf, die Pferdedecke lockte, und der Straßenverkehr hatte mich wieder.
Mein nächstes Ziel war der große Bazar von Teheran, der vermeintlich größte überdachte Bazar der Welt, in dem sich auf einem etwa zweihundert Hektar großen Gelände nicht weniger als 25.000 Geschäfte befinden sollen. Eindringlich warnte mich Anatol vor Neppern und Schleppern, vom denen es im Bazar angeblich nur so wimmeln sollte. Sein Angebot mich durch den Bazar zu begleiten, lehnte ich ab, denn ich hatte kein Interesse daran, in einem Teppichladen seines Cousins oder Bruders zu landen.
So bunt und farbenfroh wie die orientalischen Bazare, die ich bereits besucht hatte, war der Bazar von Teheran nicht, allein schon deswegen, weil er überdacht war und nur ein funzeliges Licht an den Ständen das Warenangebot beleuchtete. Jede Produktgruppe besaß ihre eigenen Straßen und Bezirke, es gab eine Gasse der Teppichhändler, der Fleischer, der Parfümeure, der Lederhändler oder der Holzverkäufer, die im Halbdunkel allesamt durcheinander wuselten, als sei jede Sekunde kostbarer als Gold. Manche Bazargassen waren so voll, dass kein Durchkommen war, andere präsentierten sich in friedlicher Abgeschiedenheit, in der die Inhaber der Geschäfte bei einem Tschai vor ihren Läden saßen. Ich musterte die einzelnen Bazaris und suchte nach äußerlich erkennbaren Gemeinsamkeiten, konnte aber keine feststellen. Es gab dicke und dünne, große und kleine Bazaris, und noch nicht einmal der Bart war bei allen anzutreffen. Das einzige gemeinsame Merkmal, das allerdings nicht sichtbar war, soll in ihrem Konservatismus bestehen, denn im Unterschied zum westlichen Händler, der immer auf der Suche nach Neuem ist, liebt der Bazari die Beständigkeit. Zwei Dinge hasst er besonders: Steuern und Konkurrenz. Dass der Schah in den stürmischen Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts den iranischen Inlandsmarkt für ausländische Waren geöffnet und damit die Bazari-Kartelle ausgehebelt hatte, dass er immer entschiedener daran ging, Wucher zu bekämpfen und ausstehende Steuern einzutreiben, hatte die Bazaris n die Arme der radikalen religiösen Opposition getrieben. Nicht zuletzt ihre Finanzkraft hatte es den Mullahs unter der Führung des damals noch exilierten Ayatollah Chomeini ermöglicht, weitgehend unbemerkt von der Geheimpolizei des Schah ein effektives Widerstandsnetz aufzubauen, das im entscheidenden Moment der Revolution zur Stelle war. Kein Wunder, dass die Moschee, die sich mitten im Bazarviertel befand, nach dem Revolutionsführer und Staatsgründer Ayatollah Chomeini benannt war.
Unvermittelt stand ich vor dem Eingang zur Ayatollah Chomeini-Moschee. Das Gebäude besaß keinen freien Vorplatz, von dem aus man die Moschee in aller Ruhe hätte betrachten können, sondern war regelrecht in das Gewirr der Bazargassen eingeklemmt. In ihrem Innenhof wirkte sie weniger imposant als die Motahhari-Mochee, doch das Fieberthermometer der Gläubigkeit erreichte in der Ayatollah Chomeini Moschee erheblich höhere Werte. Pausenlos betraten Männer und Frauen das Gotteshaus, wuschen sich an separaten Plätzen und verrichteten ihre Gebete. Obwohl die Moschee voller Menschen war, gab es keinen Lärm. Jeder schien eine inwendige Zwiesprache mit Allah zu halten und sich wenig um das zu kümmern, was um ihn herum geschah. Von sich selbst geißelnden schiitischen Glaubensfanatikern, wie man sie in manchen Gegenden des Libanon oder Pakistans antrifft, war im Innenhof der Ayatollah Chomeini-Moschee nichts zu sehen, doch die Intensität des Glaubens war fast körperlich zu spüren. „Islam“, die Hingebung an Gott, war in dieser Moschee nicht nur Programm, sondern Wirklichkeit. Jedem dieser Männer und Frauen bedeutete ihre Religion etwas ganz Anderes, Existentielleres als den Kirchenbesuchern im modernen Westen. Einen Moment lang erfüllte mich ein kurioser Gedanke: Würden religiös ergriffene Menschen leuchten, dann wäre der Iran eine gleißende, funkelnde Gesellschaft im Vergleich zu den westlichen Gesellschaften, in denen die stockdunkle Finsternis von Gräbern herrschte. war fast körperlich zu spüren. „Islam“, die Hingebung an Gott, war in dieser Moschee nicht nur Programm, sondern Wirklichkeit. Jedem dieser Männer und Frauen bedeutete ihre Religion etwas ganz Anderes, Existentielleres als den Kirchenbesuchern im modernen Westen. Einen Moment lang erfüllte mich ein kurioser Gedanke: Würden religiös ergriffene Menschen leuchten, dann wäre der Iran eine gleißende, funkelnde Gesellschaft im Vergleich zu den westlichen Gesellschaften, in denen die stockdunkle Finsternis von Gräbern herrschte.
Ayatollah Chomeini Moschee in Teheran
Diesmal gab es bei meinem Eintritt auch keinerlei Probleme, ungehindert durchschritt ich das Eingangstor und setzte mich in der Nähe der Waschvorrichtungen in den Schatten. Ein großes Plakat mit einem Ayatollah Chomeini in seiner Gestalt als Weltenrichter prangte über dem rückwärtigen Eingang der Moschee. Herb, voller Bitterkeit und bereits vom Tod gezeichnet, blickte der große Mann auf die Besucher nieder. Eine biblische Gestalt von erratischer Selbstgewissheit und erschütternder Intoleranz blickte mich an, aber wer wollte ihm das ankreiden? Einem Religionsführer Intoleranz vorzuwerfen ist das gleiche, als klage man darüber, dass ein Vogel fliegt. Für die meisten Iraner war Chomeini ein von Gott gesandter Imam, dessen Auftrag es gewesen war, die Epoche des Unglaubens zu beenden und einen Gottesstaat zu gründen. Für die westliche Welt aber wurde er spätestens nach seiner Todesfatwa gegen den Schriftsteller Salman Rushdie zum Inbegriff des religiösen Fanatikers. Über seine Jugend ist wenig bekannt. Ruhollah Chomeini wurde im Jahre 1902 als Sohn eines schiitischen Geistlichen geboren, der nur wenige Monate nach seiner Geburt bei Auseinandersetzungen mit Großgrundbesitzern ermordet wurde. Der junge Ruhollah erhielt eine Ausbildung zum Mullah und erwies sich schnell als Rechtgläubiger der allerhärtesten Sorte, als ein verbissener Beter, der an seinem Glauben nagte wie ein Verhungernder an einem Knochen. Landesweit bekannt wurde er erstmals, als er in den Neunzehnhundertsechziger Jahren den Modernisierungskurs des Schahs als unislamisch anprangerte. In aller Öffentlichkeit bekämpfte er die Landreform, die die Enteignung geistlicher Latifundien zugunsten armer Bauern vorsah. Auch die Vergabe des Wahlrechts an Frauen und das Verbot der Kinderheirat wurden von ihm als unislamisches Teufelswerk gebrandmarkt. Hatte denn der Prophet nicht höchst selbst ein neunjähriges Kind geheiratet? Chomeinis Protest fand jedoch nur wenig Widerhall, er wurde verhaftet, entging mit knapper Not der Todesstrafe und wurde des Landes verwiesen. Im Nachbarstaat Irak, im Umkreis des schiitischen Heiligtums von Kerbela, ließ er sich als Lehrer nieder und entwickelte die Lehre vom islamischen Staat. Nach dieser Lehre sollten Staat und Gesellschaft auf nichts anderes ausgerichtet sein, als auf die Wiederkehr des Erlösers, des letzten Imams, der am Ende aller Zeiten erscheinen und die Welt aus Sünde und Elend erretten wird. Gegenüber dieser endzeitlichen Heilserwartung kam der Staat nur ein abgeleitetes Existenzrecht zu, schlimmstenfalls war er die große Peitsche in der Hand eines Tyrannen und die Geißel der Gläubigen. Gegen solche Herrscher, mit anderen Worten: gegen den Schah, waren Widerstand und Märtyrertum die Pflicht jedes Gottesfürchtigen - mehr noch: alle Mittel bis hin zu Mord, Totschlag und Verstellung (Taqiya) waren zur Erreichung des guten Zweckes erlaubt.
Doch über ein Jahrzehnt lang nahm die Welt vom großen Lehrer keine Notiz. Erst als der Iran in eine wirtschaftliche Krise geriet und sich die Bazaris gegen die Modernisierungspolitik des Schah wandten, schlug seine Stunde. Eine weitverzweigte und kompliziert zusammengesetzte Oppositionsbewegung trat plötzlich in das Licht der Öffentlichkeit und rief unter der Führung des exilierten Ayatollah Chomeini die Revolution aus. Das ganze Jahr 1978 stand im Zeichen eines eskalierenden Bürgerkrieges, der in den westlichen Medien so dargestellt wurde, als kämpfe in Gestalt Chomeinis ein iranischer Gandhi gegen einen gnadenlosen Despoten. Der amerikanische Präsident Jimmy Carter, von der Idee der Menschenrechte durchdrungen, hinderte den Schah an der vollen Entfaltung seiner Machtmittel - und ließ ihn schließlich, als die Revolution immer mehr an Boden gewann, einfach fallen. Schah Muhammed Reza Pahlavi musste das Land verlassen, und von Millionen bejubelt kehrte der Ayatollah im Februar 1979 aus seinem Exil nach Teheran zurück. Der „Honeymoon der Revolution“ schien ausgebrochen zu sein, die Sehnsucht nach Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit ließ unzählige neue politische Gruppierungen entstehen, und selbst verweltlichte Exiliraner wie Azilas Vater Farid wurden vom revolutionären Rausch ergriffen. Doch innerhalb kürzester Zeit fegten die von den Mullahs straff geführten revolutionären Garden alle Institutionen des alten Regimes ebenso zur Seite wie überall aufkeimenden Ansätze einer Demokratisierung und Parlamentarisierung. Die scharfe Sense des revolutionären Terrors fegte über den Acker der Revolution, und innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich der Iran in einen schiitischen Gottesstaat, regiert von einer steinzeitkonservativen Theokratie, die mit ihren Gegnern kurzen Prozess machte.
Als die revolutionäre Aktivisten schließlich die amerikanische Botschaft stürmten und unter Bruch sämtlicher Regeln des Völkerrechts die Diplomaten als Geiseln nahmen, hetzten die Amerikaner die Armeen des Irak gegen den Iran. Ein Riss brach auf, der bis heute nicht verheilt ist, denn der Blutzoll, den der Iran zur Abwehr der irakischen Aggression entrichten musste, war ungeheuer. Eine ganze Generation junger Iraner wurde geopfert, um die technologische Unterlegenheit gegenüber dem Irak auszugleichen. Am Ende waren im sogenannten Ersten Golfkrieg (1981-1988) eine Million Menschen umgekommen, ohne dass eine Seite den Sieg hätte erringen können. Aber die iranische Revolution hatte sich behauptet, auch um den Preis, dass sie zur Diktatur erstarrt war. Die linken Studentinnen, die dereinst in einem Akt szenischen Protests den Tschador angelegt und gegen den Schah demonstriert hatten, waren längst von der Universität verwiesen worden. Die politischen Gegner saßen in den Gefängnissen, und wer konnte, war längst außer Landes geflohen.
Im Jahre 1989, kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, war Chomeini im Alter von 87 Jahren gestorben, von einer Million Menschen bei dem größten Begräbnis der Weltgeschichte betrauert. Zwei Jahrzehnte nach seinem Tod war seine Gestalt zur politischen Ikone geworden, zu einer nachwirkenden Inspiration eines neuen globalen Dschihad, der die gottlose Welt des Westens in die Schranken fordert.
Als ich am Abend ins Hotel zurückkehrte, traf ich in der Lobby die beiden Europäerinnen wieder, die ich schon beim Frühstück gesehen hatte. In ihrem Zimmer war der Strom ausgefallen, und sie warteten in der Rezeption, während der Schaden behoben wurde. Ihre Namen waren Jackie und Sue, sie mochten Ende zwanzig, Anfang dreißig Jahre alt sein und trugen ihre Kopftücher noch immer wie einen Kopfschmuck über ihren Haaren. So gut sie aussahen, so schlecht war die Stimmung. Sue erzählte, dass sie sich auf einer Eisenbahnreise von London nach Delhi befanden, für die sie ein halbes Jahr veranschlagt hatten und dass sie wegen unvorhergesehener Probleme in Türkisch-Kurdistan enorm viel Zeit verloren hätten. Außerdem hätten sie gehört, dass die Route vom Ostiran nach Pakistan zur Zeit geschlossen sei, weil Banditen das Land unsicher machten. Ich besorgte uns Tee, den wir zusammen in der Lobby tranken, was dem Rezeptionisten mit der langen Hakennase überhaupt nicht zu gefallen schien. Erkennbar ungehalten blickte er in unsere Richtung, als vollzöge sich vor seinen Augen eine moralische Ungehörigkeit ungeheuren Ausmaßes. Weil sie so viel Zeit verloren hatten, würden sie schon morgen weiterfliegen, erklärte Jackie, was schade sei, sonst hätte man sich gemeinsam die Stadt ansehen können. Jackie gefiel mir gut, sie hatte eine kleine, freche Nase, runde Kinderaugen mit langen Wimpern und ein herzhaftes Lachen. Sue war zurückhaltender, aber nicht unfreundlich, so dass die Idee aufkam, wenigstens gemeinsam zu Abend zu essen.
„Komm uns doch abholen“, schlug Jackie vor und zwinkerte mir zu. „Wir haben noch eine Flasche Whisky in Petto und könnten zur Feier des Tages ja ein Glas trinken.“
Eine Insel der Gottlosigkeit und Libertinage im hyperfrommen Iran, das hörte sich gut an. Der Rezeptionist trat heran und verkündete, dass der Schaden im Zimmer behoben sei, die beiden Damen könnten nun heraufgehen. Mich blickte er unfreundlich an, vor allem, als er hörte, wie mir Jackie ihre Zimmernummer im achten Stock des Hotels mitteilte.
Doch aus diesen Plänen wurde nichts. Als ich eine Stunde später frisch geduscht mein Zimmer verließ und in den achten Stock gehen wollte, traf ich im Treppenhaus auf einen rustikalen alten Kerl, der mir mit einem großen Knüppel den Zugang zum Zimmerkorridor verwehrte. Er hatte kein Gramm Fett auf den Rippen, besaß aber so kräftige Knochen, als hätte er sein Leben lang steinige Felder beackert. Seine Unterarme wiesen so kräftige Adern auf, dass es für jede Krankenschwester eine Freude sein müsste, ihm Blut abzuzapfen. Groß und knochig wie alles an ihm war auch sein Kopf, auf dem ihm die Haare wie alter Ginster nach allen Seiten abstanden. Ohne die Miene zu verziehen, hob er die Hand und verwehrte mir den Durchgang. Ich konnte es erst gar nicht glauben und wollte ihn beiseite schieben, doch der Alte griff mich mit erstaunlicher Behändigkeit am Hemdkragen und hob so überzeugend seinen Knüppel über meinem Kopf, dass ich ein Einsehen hatte und kehrt machte. Als ich mich nach der Telefonnummer der beiden an der Rezeption erkundigte, wurde mir die Auskunft verweigert.
Da aus dem Drink und dem Abendessen mit Ines und Sue nichts wurde und ich keine Lust hatte, alleine in die Stadt zu gehen, besorgte ich mir einen Snack in der Hotelbar und las auf meinem Zimmer den ganzen Abend über Teheran. Lektüre statt Liebe, das hatte ich schon oft erlebt und mittlerweile kam ich damit zurecht. Außerdem hätten die beiden auch bei mir vorbeischauen oder wenigstens anrufen können. Oder wurden sie ebenso daran gehindert wie ich?
Was ich an diesem Abend über Teheran erfuhr, war aber auch nicht zu verachten. Kein Isfahan, kein Delhi, kein Xian, sondern eine junge Frucht der Geschichte, die der Wille der Herrscher zum Zentrum des Landes gemacht hatte. Jahrhundertelang war Teheran nichts weiter als eine ärmliche Siedlung gewesen, in deren Umkreis die Bauern wie die Wilden in Höhen lebten. . Erst als die Mongolen im 13. Jahrhundert die benachbarte Metropole Ray in Schutt und Asche gelegt hatten, entwickelte sich Teheran zu einer prosperierenden Siedlung am Schnittpunkt der Handelswege zwischen Anatolien und der Seidenstraße. Die schiitischen Safaviden, die im 16. Jahrhundert von Anatolien aus den Iran eroberten, befestigten die Stadt als einen ihrer wichtigsten Stützpunkte. Im 18. Jahrhundert, als die die türkischstämmige Khadscharendynastie über den Iran herrschte, wurde Teheran schließlich zur Hauptstadt des Landes erhoben, nicht zuletzt, weil sie in der Nähe der Siedlungsgebiete der Khadscharen lag. Und für Reza Pahlawi (1921-1955) und seinen Sohn Muhammed Reza Pahlawi (1953-1979), die wie Kemal Atatürk in der Türkei das Land modernisieren wollten, war Teheran als Experimentierfeld weit besser geeignet als Isfahan, Schiras oder Maschad. Ich las solange, bis mir die Bücher aus der Hand fielen und zwischen Schlaf und Wachen Erinnerungen aus meiner Kindheit einstellten, als sich persische Männer und Frauen, wohlbeleibt und reich, im komplett assimilierten West-Look wie selbstverständlich in meiner Verwandtschaft bewegten. Zeitweise war meine Schwester mit einem Mann verheiratet gewesen, dessen Schwester einen Iraner geheiratet hatte und die sich sofort nach der Hochzeit genauso so dick schminkte wie ihre neue iranische Verwandtschaft. Ich hatte keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Auch wie es Azilas Verwandten in den Umwälzungen der islamischen Revolution ergangen ist, wusste ich nicht. Dann erschien Azilas Bild vor meinem inneren Auge, und ich schlief ein.
*
Am nächsten Morgen waren Jackie und Sue abgereist. Die Frage, ob sie eine Nachricht für mich hinterlassen hatten, wurde verneint. Auch die beiden Lehrer waren nicht mehr da, ich war der einzige Tourist im Frühstücksraum.
Über Nacht hatten die Temperaturen in Teheran einen rasanten Sprung nach oben gemacht. Plötzlich war es in den Straßen drückend heiß, die Luft schien zwischen den Hochhäusern regelrecht zu stehen, und die komplettverhüllten Iranerinnen taten mir von Herzen leid, denn sie würden schwitzen wie in einer Sauna, und niemand würde ihre Schweißperlen sehen. Anatol, der mich im kurzen Khaki Hemd und einer luftigen Sporthose vor dem Hotel mit seinem Pferdecken-Taxi erwarte, tröstete mich. Das ist noch gar nichts, sagte er in seinem gutturalen Englisch. „In the Summertime it is so hot, that the Water is cooking in your underware.“ Zur Begrüßung hatte Anatol neben der geöffneten Wagentüre seines Taxis einen kleinen Campingkocher in Schwung gebracht, mit dessen Hilfe er einen Instant-Kaffee aufbrühte. Als ich einen Becher annahm, hielt er die Hand auf und wollte Bargeld sehen. Auch das sollte ich auf diese Reise noch lernen. Armenier wissen ihr Schäfchen immer ins Trocken zu bringen.
Die Hitze des Tages kam mir gerade recht für einen Ausflug in den Norden der Stadt zur Tochai- Talstation, von der aus eine Seilbahn in die kühle Bergwelt führte. Auf diese Tochai-Bergbahn halten sich die Iraner viel zugute, denn wenn man ihrer Tourismuswerbung glauben konnte, war sie mit über sieben Kilometern die längste und mit ihrer Endstation auf fast viertausend Metern auf dem Mount Tochai auch die höchste Seilbahn der Welt. Das war die gute Nachricht. Die schlechte war, dass die Seilbahn wegen Reparaturarbeiten geschlossen war. Anatol zuckte mit dem Schultern und sagte, in Teheran sei alles Interessante entweder zu teuer oder geschlossen. Er konnte sogar mit einem Witz aufwarten. „Was haben die Tochai-Bahn und die U-Bahn von Teheran gemeinsam?“ fragte er. „Sie werden erst fertig, wenn der letzte Imam erscheint. Hahaha.“
Ich blickte mich um und sah von der Talstation am Rande der Berge auf ein Häusermeer, das den gesamten Horizont erfüllte und dessen südliche Ränder im Dunst verschwammen Ein Tal aus Stein, ein Kessel voller Lebensdampf, der das ganze Land in Atem hält. Irgendwann werde ich diese Stadt auch einmal von den Höhen des Tochai-Berges aus sehen, dachte ich, wenngleich nicht heute.
Wieder holte Anatol seinen Campingkocher aus dem Wagen und bereitete neben der geöffneten Wagentüre einen Instantkaffee zu. Ich blickte auf meine Stadtkarte und beschloss, in das Grabmal Ayatollah Chomeinis im Süden der Stadt zu besuchen.
Anatol winkte ab. „Zu weit“, sagte er.
„Na und?“ fragte ich. „Ich habe Zeit.“
„Außerdem nicht fertig“, fügte er hinzu. Er hatte erkennbar keine Lust, in den Süden zu fahren.
„Davon will ich mich selbst überzeugen.“
„Kein Benzin mehr.“
„Dank tank doch“, gab ich zurück. Gottlob hatte ich die Tagestour nicht im voraus bezahlt.
Tatsächlich benötigte Anatol mit seinem altertümlichen Taxi eine geschlagene Stunde, ehe er den Süden der Stadt erreichte. Mehrfach verfuhr er sich, passierte zweimal eine Einbahnstraße und zeigte deutliche Zeichen von Ungehaltenheit. Ich notierte: Der Armenier ist nicht unbedingt der geborene Dienstleister. Aus dem Radio erklang iranische Popmusik, ein sehr rhythmisches Lied mit hammerartiger Schlagzeugbegleitung und einer Frauenstimme, die sich so schrill anhörte, als würde die Sängerin während ihres Vortrages gewürgt. Im Unterschied zum Norden boten die Straßen im Süden Teherans einen heruntergekommenen Anblick. Viele Häuser wirkten baufällig, selbst wenn sie erkennbar neu waren. An den Straßenrändern türmte sich der Abfall neben ärmlichen Märkten, immer wieder behinderten große Schlaglöcher den Verkehr. Wir durchfuhren die Armenviertel der Stadt, jene Bezirke, aus denen im Revolutionsjahr die notleidenden Massen aufgebrochen waren, um die Mullahs im Kampf gegen den Schah zu unterstützen. Wenn man sich heute auf den Straßen umsah, hatte es ihnen wenig genutzt.
Die Mittel, die man für die Sanierung des Südens hätte aufwenden können, hatte die Stadtverwaltung in das Ayatollah Chomeini-Grabmal investiert. Für umgerechnet nicht weniger als zwei Milliarden Dollar war in der Nachbarschaft des Teheraner Friedhofs Behescht-e Zarcs ein gewaltiger Baukomplex entstanden, der neben der Grabmoschee mehrere Innenhöfe, Einkaufszentren, Hospitäler und Tagungsstätten für Zehntausende Besucher täglich umfassen sollte– wenn er denn endlich fertig würde. Immerhin war das Konzept bemerkenswert: ein Ort des Todes und des Lebens zugleich, was für das Weltverständnis der Schia charakteristisch ist. Denn kaum eine andere Religion leitet ihre Lebensregeln derart ausschließlich aus der Erinnerung an Tote ab wie der schiitische Islam, was ihn von der Sunna, der Mehrheitsrichtung des weltweiten Islam, unterscheidet.
Sunna (Überlieferung) und Schia (Partei), die beiden großen Glaubensrichtungen des Islams, unterschieden sich anders als Katholizismus und Protestantismus im Christentum oder Hinayana und Mahayana im Buddhismus in theologisch-liturgischen Fragen kaum voneinander. Für beide Richtungen ist der Koran das geoffenbarte Wort Gottes, an dem kein Jota geändert werden darf. Beide Richtungen orientieren sich an den fünf Geboten des Islam (Anrufung Allahs, Pilgerfahrt nach Mekka, Mildtätigkeit gegen Arme, das fünfmalige tägliche Gebet und die Feier des Ramadan). Abgesehen von rituellen Kleinigkeiten trennt Sunna und Schia allein die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Nachfolge Mohammeds.
Die Sunniten, zu denen 90 % der Mohammedaner gehören, orientieren sich in dieser Frage an der Überlieferung. Alle strittigen Fragen sollen durch Schriftgelehrte entscheiden werden, die ihren Rang allein durch Weisheit und ein vorbildliches Leben erhalten. Was die Nachfolge des Propheten betrifft, so soll der „Würdigste“ zum Führer, zum Kalifen („Stellvertreter“) , ernannt werden. Diese Methode der Designation ist dem arabischen Denken tief verwurzelt. Eine Ernennung allein aufgrund von Blutsverwandtschaft ist dem Araber fremd.
Die Schia ist die „Partei“ Alis, des Schwiegersohns des Propheten. Ali hatte Fatima, die Tochter des Propheten geheiratet und mit ihr zwei Söhne, Hassan und Hussain, gezeugt. Nach der Lehre der Schia kann nur ein Verwandter beziehungsweise ein Nachfolge Mohammeds Kalif werden. Trotzdem wurden die ersten drei Kalifen Abu Bakr, Omar und Uthman per Wahl bestimmt. Ali, der Schwiegersohn des Propheten, kam erst als vierter Kalif im Jahre 656 zum Zuge, wurde aber schon kurz darauf ermordet. Alis jüngerer Sohn Hussain unterlag 680 dem Omayyaden Yazid in der berühmt-berüchtigten Kamelschlacht von Kerbela. Sein Kopf wurde auf eine Lanze gespießt und in Damaskus zur Schau gestellt. Allen Schiiten gemeinsam ist, dass sie seitdem dieser märtyrerhaften Ursprünge, vor allem dem Tod Hussains, in aufwendigen Formen gedenken. So entstand ein Kult des Todes, den man im Dienst der richtigen Sache mit Freuden auf sich nehmen sollte, außerdem eine Geringschätzung des Staates, der gegenüber den Weisungen der Imame (in der Schia immer ein Nachfolger des Propheten) keine eigene Wertigkeit besitzt.
Innerhalb der Schia unterscheidet man zwei Hauptgruppen, die sich beide auf Hussain, den dritten Imam, zurückführen und sich allein der Auffassung unterscheiden, wann der vorletzte Imam verschwand. Nach der Lehre Siebener Schia oder der Ismaeliten starb Ismael, der Sohn des 6. Imam, vor seinem Vater. Damit endete die Zählung der Siebener Schia- Die Zwölfer- Schia erkannte dagegen Ismaels jüngeren Sohn Mohammed als 7. Imam an und führte die Linie weiter bis zum Jahre 873, dem Todesjahr des 11. Imams. Seitdem warten die Schiiten dieser Glaubensrichtung auf den Imam Mahdi, den 12. Imam, der im Verborgenen weilt und eines Tages wie ein Messias wiederkehren wird, um die Welt zu retten.
Die Stunde der Siebener-Schia schlug, als sie das Kalifat der Fatimiden in Ägypten gründeten und den Maghreb missionierten. Die Zwölfer-Schia betrat die Bühne der Weltgeschichte, als es den Safaviden am Beginn des 16. Jahrhunderts gelang, von der Osttürkei aus den Iran zu erobern und die Lehre der 12er Schia zur Staatsreligion zu erheben. So kompliziert sich diese Vorgeschichte und Terminologie auch anhört, ohne die Mythen vom Märtyrertod Hussains, vom Kampf gegen den ungerechten Kalifen Yazid und der Lehre vom letzten Imam, ist der spirituelle Hintergrund der iranischen Revolution nicht zu verstehen.
Als mich Anatol vor dem Mausoleum Imam Chomeinis auslud, befand sich der Komplex noch im Bau. Überall ragten Baukräne in den Himmel, zwei der vier Minarette waren von Gerüsten umgeben. Aber der Grundriss der Anlage war bereits erkennbar. Zwischen den vier je 91 Meter hohen Minaretten erhob sich die 68 Meter hohe Grabkuppel. 91 Meter hoch waren die Minarette, weil diese Zahl dem Alter des Chomeinis in Mondjahren entsprach, und die die Höhe der 68 Meter hohen Kuppel bezog sich aus das Jahr 1368 der islamischen Zeitrechnung, das dem Jahr 1989 entsprach, in dem der Imam kurz nach dem Ende des iranisch-irakischen Krieges gestorben war. Ganz im Unterschied zu dem gnadenlosen Image, das Chomeini im Westen besitzt, hatte sich der Ayatollah eine Grabstätte gewünscht, an der es den Menschen möglich sein solle, sich zwanglos zu treffen und zu entspannen. Und wirklich saßen auf den Wiesen rund um das Mausoleum Familien vollkommen ungezwungen beim Picknick, hier und da hörte ich iranische Popmusik aus Kassettenrecordern, diesmal allerdings kämpferische Männergesänge zum Rhythmus stampfender Soldatenschritte. Sogar im marmorausgeschlagenen Innern des Chomeini-Grabmals spielten die Kinder Nachlaufen und liefen kreischend über die Teppiche, während ihre Mütter in den kleinen Nischen der großen Halle saßen und ein wachsames Auge auf den Nachwuchs hatten. Den Jungen war anzumerken, wie verwöhnt sie wurden, aber die kleinen Mädchen, die noch nicht verschleiert waren, hielten kräftig mit. Der Zugang zum eigentlichen Schrein war nach Männern und Frauen getrennt. Die sterblichen Überreste des Ayatollahs ruhten in einem bescheidenen Grab, das durch ein Gitter von der großen Halle abgetrennt war. Bündel voller Banknoten, die die Pilger durch die Gitterstreben auf das Grab warfen, lagen neben dem Sarg. Große Kühlvorrichtungen an der Decke erzeugten eine so angenehme Temperatur, dass sich Dutzende Männer nach dem Besuch des Grabes auf die Teppiche legten und schliefen. Ein unablässiges Kommen und Gehen beherrschte die Halle, ein Tuscheln und Wispern, halb erregt, halb begeistert, das wie das Rauschen eines Baches durch die Halle tönte. Hier lag der große Tote, der die Welt verändert hatte und dessen Bewertung die Menschen bis auf den heutigen Tag entzweit. Mir imponierte die alttestamentarische Wucht, mit der er seine Ziele unbeirrt verfolgt hatte, seine Bedenkenlosigkeit und unmenschliche Konsequenz aber stießen mich ab. Vielleicht musste man den Ayatollah, um ihn moralisch richtig einzuordnen, mit anderen großen Figuren seiner Zeit in Beziehung setzen. Auch Nelson Mandela hatte unter dem Apartheidsregime in Südafrika schwer gelitten, doch als er die Macht übernahm, wurde er zu einem Gnadenmann, dem es gelang, das alte und das neue Südafrika so miteinander ins Gespräch zu bringen, dass die Ströme von Blut vermieden wurden, die allseits erwartet worden waren. Auch der Dalai Lama saß nun schon über ein halbes Jahrhundert im indischen Exil und sollte er jemals in Tibet die Macht übernehmen, wären keine Gemetzel zu erwarten, wie sie die Machtergreifung der Mullahs begleitet hatten. Chomeinis Anhänger würden solche Vergleiche unpassend erscheinen. Mandela und der Dalai Lama waren für sie nur „Kuffar“, Ungläubige, deren Geschick sie nicht interessierte. Ihnen ging es nur um ihre eigene Wahrheit, und dieser monumentalen Gestalt, die dieser einen Wahrheit mit Gewalt gegen alle andern Auffassungen zum Sieg verholfen hatte, gehörte ihre ganze Liebe.
Sonnenuntergang am Grabmal Ayatollah Chomeinis im Süden Teherans