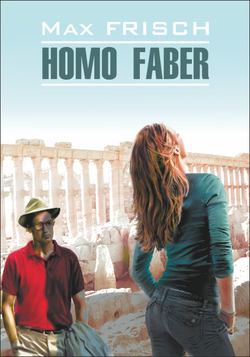Читать книгу Homo Faber / Хомо Фабер. Книга для чтения на немецком языке - Макс Фриш, Макс Фриш - Страница 1
Erste Station
ОглавлениеWir starteten in La Guardia1, New York, mit dreistündiger Verspätung infolge Schneestürmen. Unsere Maschine war, wie üblich auf dieser Strecke, eine Super-Constellation2. Ich richtete mich sofort zum Schlafen, es war Nacht. Wir warteten noch weitere vierzig Minuten draußen auf der Piste, Schnee vor den Scheinwerfern, Pulverschnee, Wirbel über der Piste, und was mich nervös machte, so dass ich nicht sogleich schlief, war nicht die Zeitung, die unsere Stewardess verteilte, First Pictures Of World’s Greatest Air Crash In Nevada, eine Neuigkeit, die ich schon am Mittag gelesen hatte, sondern einzig und allein diese Vibration in der stehenden Maschine mit laufenden Motoren – dazu der junge Deutsche neben mir, der mir sogleich aufiel, ich weiß nicht wieso, er fiel auf, wenn er den Mantel auszog, wenn er sich setzte und sich die Bügelfalten zog, wenn er überhaupt nichts tat, sondern auf den Start wartete wie wir alle und einfach im Sessel saß, ein Blonder mit rosiger Haut, der sich sofort vorstellte, noch bevor man die Gürtel geschnallt hatte. Seinen Namen hatte ich überhört, die Motoren dröhnten, einer nach dem andern auf Vollgasprobe —
Ich war todmüde.
Ivy hatte drei Stunden lang, während wir auf die verspätete Maschine warteten, auf mich eingeschwatzt, obschon sie wusste, dass ich grundsätzlich nicht heirate.
Ich war froh, allein zu sein.
Endlich ging’s los —
Ich habe einen Start bei solchem Schneetreiben noch nie erlebt, kaum hatte sich unser Fahrgestell von der weißen Piste gehoben, war von den gelben Bodenlichtern nichts mehr zu sehen, kein Schimmer, später nicht einmal ein Schimmer von Manhattan, so schneite es. Ich sah nur das grüne Blinklicht an unsrer Tragfläche, die heftig schwankte, zeitweise wippte; für Sekunden verschwand sogar dieses grüne Blinklicht im Nebel, man kam sich wie ein Blinder vor.
Rauchen gestattet.
Er kam aus Düsseldorf, mein Nachbar, und so jung war er auch wieder nicht, anfangs Dreißig, immerhin jünger als ich; er reiste, wie er mich sofort unterrichtete, nach Guatemala, geschäftlich, soviel ich verstand —
Wir hatten ziemliche Böen.
Er bot mir Zigaretten an, mein Nachbar, aber ich bediente mich von meinen eignen, obschon ich nicht rauchen wollte, und dankte, nahm nochmals die Zeitung, meinerseits keinerlei Bedürfnis nach Bekanntschaft. Ich war unhöflich, mag sein. Ich hatte eine strenge Woche hinter mir, kein Tag ohne Konferenz, ich wollte Ruhe haben, Menschen sind anstrengend. Später nahm ich meine Akten aus der Mappe, um zu arbeiten; leider gab es gerade eine heiße Bouillon, und der Deutsche (er hatte, als ich seinem schwachen Englisch entgegenkam mit Deutsch, sofort gemerkt, dass ich Schweizer bin) war nicht mehr zu stoppen. Er redete über Wetter, beziehungsweise über Radar, wovon er wenig verstand; dann machte er, wie üblich nach dem zweiten Weltkrieg; sofort auf europäische Brüderschaft. Ich sagte wenig. Als man die Bouillon gelöffelt hatte, blickte ich zum Fenster hinaus, obschon nichts andres zu sehen war als das grüne Blinklicht draußen an unsrer nassen Tragfläche, ab und zu Funkenregen wie üblich, das rote Glühen in der Motor-Haube. Wir stiegen noch immer —
Später schlief ich ein.
Die Böen ließen nach.
Ich weiß nicht, warum er mir auf die Nerven ging, irgendwie kannte ich sein Gesicht, ein sehr deutsches Gesicht. Ich überlegte mit geschlossenen Augen, aber vergeblich. Ich versuchte, sein rosiges Gesicht zu vergessen, was mir gelang, und schlief etwa sechs Stunden, überarbeitet wie ich war – kaum war ich erwacht, ging er mir wieder auf die Nerven.
Er frühstückte bereits.
Ich tat, als schliefe ich noch.
Wir befanden uns (ich sah es mit meinem rechten Auge) irgendwo über dem Mississippi, flogen in großer Höhe und vollkommen ruhig, unsere Propeller blinkten in der Morgensonne, die üblichen Scheiben, man sieht sie und sieht hindurch, ebenso glänzten die Tragflächen, starr im leeren Raum, nichts von Schwingungen, wir lagen reglos in einem wolkenlosen Himmel, ein Flug wie hundert andere zuvor, die Motoren liefen in Ordnung.
„Guten Tag!“ sagte er —
Ich grüßte zurück.
„Gut geschlafen?“ fragte er —
Man erkannte die Wasserzweige des Mississippi, wenn auch unter Dunst, Sonnenglanz drauf, Geriesel wie aus Messing oder Bronze; es war noch früher Morgen, ich kenne die Strecke, ich schloss die Augen, um weiterzuschlafen.
Er las ein Heftlein, rororo.
Es hatte keinen Zweck, die Augen zu schließen, ich war einfach wach, und mein Nachbar beschäftigte mich ja doch, ich sah ihn sozusagen mit geschlossenen Augen. Ich bestellte mein Frühstück… Er war zum ersten Mal in den Staaten, wie vermutet, dabei mit seinem Urteil schon fix und fertig, wobei er das eine und andere (im ganzen fand er die Amerikaner kulturlos) trotzdem anerkennen musste, beispielsweise die Deutschfreundlichkeit der meisten Amerikaner.
Ich widersprach nicht.
Kein Deutscher wünsche Wiederbewaffnung, aber der Russe zwinge Amerika dazu, Tragik, ich als Schweizer (Schwyzzer, wie er mit Vorliebe sagte) könne alldies nicht beurteilen, weil nie im Kaukasus gewesen, er sei im Kaukasus gewesen, er kenne den Iwan3, der nur durch Waffen zu belehren sei. Er kenne den Iwan! Das sagte er mehrmals. Nur durch Waffen zu belehren! sagte er, denn alles andere mache ihm keinen Eindruck, dem Iwan —
Ich schälte meinen Apfel.
Unterscheidung nach Herrenmenschen und Untermenschen, wie’s der gute Hitler meinte, sei natürlich Unsinn; aber Asiaten bleiben Asiaten —
Ich aß meinen Apfel.
Ich nahm meinen elektrischen Rasierapparat aus der Mappe, um mich zu rasieren, beziehungsweise um eine Viertelstunde allein zu sein, ich mag die Deutschen nicht, obschon Joachim, mein Freund, auch Deutscher gewesen ist… In der Toilette überlegte ich mir, ob ich mich nicht anderswohin setzen könnte, ich hatte einfach kein Bedürfnis, diesen Herrn näher kennen zu lernen, und bis Mexico-City, wo mein Nachbar umsteigen musste, dauerte es noch mindestens vier Stunden. Ich war entschlossen, mich anderswohin zu setzen; es gab noch freie Sitze. Als ich in die Kabine zurückkehrte, rasiert, so dass ich mich freier fühlte, sicherer – ich vertrage es nicht, unrasiert zu sein – hatte er sich gestattet, meine Akten vom Boden aufzuheben, damit niemand drauf tritt, und überreichte sie mir, seinerseits die Höflichkeit in Person. Ich bedankte mich, indem ich die Akten in meine Mappe versorgte, etwas zu herzlich, scheint es, denn er benutzte meinen Dank sofort, um weitere Fragen zu stellen.
Ob ich für die Unesco arbeite?
Ich spürte den Magen – wie öfter in der letzten Zeit, nicht schlimm, nicht schmerzhaft, ich spürte nur, dass man einen Magen hat, ein blödes Gefühl. Vielleicht war ich drum so unausstehlich. Ich setzte mich an meinen Platz und berichtete, um nicht unausstehlich zu sein, von meiner Tätigkeit, technische Hilfe für unterentwickelte Völker, ich kann darüber sprechen, während ich ganz andres denke. Ich weiß nicht, was ich dachte. Die Unesco, scheint es, machte ihm Eindruck, wie alles Internationale, er behandelte mich nicht mehr als Schwyzzer, sondern hörte zu, als sei man eine Autorität, geradezu ehrfürchtig, interessiert bis zur Unterwürfigkeit, was nicht hinderte, dass er mir auf die Nerven ging.
Ich war froh um die Zwischenlandung.
Im Augenblick, als wir die Maschine verließen und vor dem Zoll uns trennten, wusste ich, was ich vorher gedacht hatte: Sein Gesicht (rosig und dicklich, wie Joachim nie gewesen ist) erinnerte mich doch an Joachim. —
Ich vergaß es wieder.
Das war in Houston, Texas.
Nach dem Zoll, nach der üblichen Schererei mit meiner Kamera, die mich schon um die halbe Welt begleitet hat, ging ich in die Bar, um einen Drink zu haben, bemerkte aber, dass mein Düsseldorfer bereits in der Bar saß, sogar einen Hocker freihielt – vermutlich für mich! – und ging gradaus in die Toilette hinunter, wo ich mir, da ich nichts anderes zu tun hatte, die Hände wusch.
Aufenthalt: 20 Minuten.
Mein Gesicht im Spiegel, während ich Minuten lang die Hände wasche, dann trockne: weiß wie Wachs, mein Gesicht, beziehungsweise grau und gelblich mit violetten Adern darin, scheußlich wie eine Leiche. Ich vermutete, es kommt vom Neon-Licht, und trocknete meine Hände, die ebenso gelblich-violett sind, dann der übliche Lautsprecher, der alle Räume bedient, somit auch das Untergeschoss: Your attention please, your attention please! Ich wusste nicht, was los ist. Meine Hände schwitzten, obschon es in dieser Toilette geradezu kalt ist, draußen ist es heiß. Ich weiß nur soviel: – Als ich wieder zu mir kam, kniete die dicke Negerin neben mir, Putzerin, die ich vorher nicht bemerkt hatte, jetzt in nächster Nähe, ich sah ihr Riesenmaul mit den schwarzen Lippen, das Rosa ihres Zahnfleisches, ich hörte den hallenden Lautsprecher, während ich noch auf allen vieren war —
Plane is ready for departure.
Zweimal:
Plane is ready for departure.
Ich kenne diese Lautsprecherei.
All passengers for Mexico-Guatemala-Panama, dazwischen Motorenlärm, kindly requested, Motorenlärm, gate number five, thank you.
Ich erhob mich.
Die Negerin kniete noch immer —
Ich schwor mir, nie wieder zu rauchen, und versuchte, mein Gesicht unter die Röhre zu halten, was nicht zu machen war wegen der Schüssel, es war ein Schweißanfall, nichts weiter, Schweißanfall mit Schwindel.
Your attention please —
Ich fühlte mich sofort wohler.
Passenger Faber, passenger Faber!
Das war ich.
Please to the information-desk.
Ich hörte es, ich tauchte mein Gesicht in die öffentliche Schüssel, ich hofte, dass sie ohne mich weiterfliegen, das Wasser war kaum kälter als mein Schweiß, ich begriff nicht, wieso die Negerin plötzlich lachte – es schüttelte ihre Brust wie einen Pudding, so musste sie lachen, ihr Riesenmaul, ihr Kruselhaar, ihre weißen und schwarzen Augen, Großaufnahme aus Afrika, dann neuerdings: Plane is ready for departure. Ich trocknete mein Gesicht mit dem Taschentuch, während die Negerin an meinen Hosen herumwischte. Ich kämmte mich sogar, bloß um Zeit zu verlieren, der Lautsprecher gab Meldung um Meldung, Ankünfte, Abflüge, dann nochmals:
Passenger Faber, passenger Faber —
Sie weigerte sich, Geld anzunehmen, es wäre ein Vergnügen (pleasure) für sie, dass ich lebe, dass der Lord ihr Gebet erhört habe, ich hatte ihr die Note einfach hingelegt, aber sie folgte mir noch auf die Treppe, wo sie als Negerin nicht weitergehen durfte, und zwang mir die Note in die Hand.
In der Bar war es leer —
Ich rutschte mich auf einen Hocker, zündete mir eine Zigarette an, schaute zu, wie der Barmann die übliche Olive ins kalte Glas wirft, dann aufgießt, die übliche Geste: mit dem Daumen hält er das Sieb vor dem silbernen Mischbecher, damit kein Eis ins Glas plumpst, und ich legte meine Note hin, draußen rollte eine Super-Constellation vorbei und auf die Piste hinaus, um zu starten. Ohne mich! Ich trank meinen Martini-Dry, als wieder der Lautsprecher mit seinem Knarren ein-setzte: Your attention please! Eine Weile hörte man nichts, draußen brüllten gerade die Motoren der startenden Super-Constellation, die mit dem üblichen Dröhnen über uns hinwegflog – dann neuerdings:
Passenger Faber, passenger Faber —
Niemand konnte wissen, dass ich gemeint war, und ich sagte mir, lange können sie nicht mehr warten – ich ging aufs Observation-Dach, um unsere Maschine zu sehen. Sie stand, wie es schien, zum Start bereit; die Shell-Tanker waren weg, aber die Propeller liefen nicht. Ich atmete auf, als ich das Rudel unsrer Passagiere über das leere Feld gehen sah, um einzusteigen, mein Düsseldorfer ziemlich voran. Ich wartete auf das Anspringen der Propeller, der Lautsprecher hallte und schepperte auch hier:
Please to the information-desk!
Aber es geht mich nicht an.
Miss Sherbon, Mr. and Mrs. Rosenthal —
Ich wartete und wartete, die vier Propellerkreuze blieben einfach starr, ich hielt sie nicht aus, diese Warterei auf meine Person, und begab mich neuerdings ins Untergeschoß, wo ich mich hinter der geriegelten Tür eines Cabinets versteckte, als es nochmals kam:
Passenger Faber, passenger Faber.
Es war eine Frauenstimme, ich schwitzte wieder und musste mich setzen, damit mir nicht schwindlig wurde, man konnte meine Füße sehen.
This is our last call.
Zweimal: This is our last call.
Ich weiß nicht, wieso ich mich eigentlich versteckte. Ich schämte mich; es ist sonst nicht meine Art, der letzte zu sein. Ich blieb in meinem Versteck, bis ich festgestellt hatte, dass der Lautsprecher mich aufgab, mindestens zehn Minuten. Ich hatte einfach keine Lust weiterzufliegen. Ich wartete hinter der geriegelten Tü r, bis man das Donnern einer startenden Maschine gehört hatte – eine Super-Constellation, ich kenne ihren Ton! – dann rieb ich mein Gesicht, um nicht durch Blässe aufzufallen, und verließ das Cabinet wie irgendeiner, ich pfiff vor mich hin, ich stand in der Halle und kaufte irgendeine Zeitung, ich hatte keine Ahnung, was ich in diesem Houston, Texas, anfangen sollte. Es war merkwürdig; plötzlich ging es ohne mich! Ich horchte jedes Mal, wenn der Lautsprecher ertönte – dann ging ich, um etwas zu tun, zur Western Union: um eine Depesche aufzugeben, betreffend mein Gepäck, das ohne mich nach Mexico flog, ferner eine Depesche nach Caracas, dass unsere Montage um vierundzwan-zig Stunden verschoben werden sollte, ferner eine Depesche nach New York, ich steckte gerade meinen Kugelschreiber zurück, als unsere Stewardess, die übliche Liste in der andern Hand, mich am Ellbogen fasste:
„There you are!“
Ich war sprachlos —
„We’re late, Mister Faber, we’re late!“
Ich folgte ihr, meine überflüssigen Depeschen in der Hand, mit allerlei Ausreden, die nicht interessierten, hinaus zu unsrer Super-Constellation; ich ging wie einer, der vom Gefängnis ins Gericht geführt wird – Blick auf den Boden beziehungsweise auf die Treppe, die sofort, kaum war ich in der Kabine, ausgeklinkt und weggefahren wurde.
„I’m sorry!“ sagte ich, „I’m sorry.“
Die Passagiere, alle schon angeschnallt, drehten ihre Köpfe, ohne ein Wort zu sagen, und mein Düsseldorfer, den ich vergessen hatte, gab mir sofort den Fensterplatz wieder, geradezu besorgt: Was denn geschehen wäre? Ich sagte, meine Uhr sei stehengeblieben, und zog meine Uhr auf.
Start wie üblich —
Das Nächste, was mein Nachbar erzählte, war interessant – überhaupt fand ich ihn jetzt, da ich keine Magenbeschwerden mehr hatte, etwas sympathischer; er gab zu, dass die deutsche Zigarre noch nicht zur Weltklasse gehört, Voraussetzung einer guten Zigarre, sagte er, sei ein guter Tabak.
Er entfaltete eine Landkarte.
Die Plantage, die seine Firma auszubauen hoffte, lag allerdings, wie mir schien, am Ende der Welt, Staatsgebiet von Guatemala, von Flores nur mit Pferd zu erreichen, während man von Palenque (Staatsgebiet von Mexico) mit einem Jeep ohne weiteres hinkommt; sogar ein Nash, behauptete er, wäre schon durch diesen Dschungel gefahren.
Er selbst flog zum ersten Mal dahin.
Bevölkerung: Indios.
Es interessierte mich, insofern ich ja auch mit der Nutzbarmachung unterentwickelter Gebiete beschäftigt bin; wir waren uns einig, dass Straßen erstellt werden müssen, vielleicht sogar ein kleiner Flugplatz, alles nur eine Frage der Verbindungen, Einschiffungen in Puerto Barrios – Ein kühnes Unternehmen, schien mir, jedoch nicht unvernünftig, vielleicht wirklich die Zukunft der deutschen Zigarre.
Er faltete die Karte zusammen —
Ich wünschte Glück.
Auf seiner Karte (1:500000) war sowieso nichts zu erkennen, Niemandsland, weiß, zwei blaue Linien zwischen grünen Staatsgrenzen, Flüsse, die einzigen Namen (rot, nur mit der Lupe zu lesen) bezeichneten Maya-Ruinen —
Ich wünschte Glück.
Ein Bruder von ihm, der schon seit Monaten da unten lebte, hatte offenbar Mühe mit dem Klima, ich konnte es mir vorstellen, Flachland, tropisch, Feuchte der Regenzeit, die senkrechte Sonne.
Damit war dieses Gespräch zu Ende.
Ich rauchte, Blick zum Fenster hinaus: unter uns der blaue Golf von Mexico, lauter kleine Wolken, und ihre violetten Schatten auf dem grünlichen Meer, Farbspiel wie üblich, ich habe es schon oft genug gefilmt – ich schloss die Augen, um wieder etwas Schlaf nachzuholen, den Ivy mir gestohlen hatte; unser Flug war nun vollkommen ruhig, mein Nachbar ebenso.
Er las seinen Roman.
Ich mache mir nichts aus Romanen – sowenig wie aus Träumen, ich träumte von Ivy, glaube ich, jedenfalls fühlte ich mich bedrängt, es war in einer Spielbar in Las Vegas (wo ich in Wirklichkeit nie gewesen bin), Klimbim, dazu Lautsprecher, die immer meinen Namen riefen, ein Chaos von blauen und roten und gelben Automaten, wo man Geld gewinnen kann, Lotterie, ich wartete mit lauter Splitternackten, um mich scheiden zu lassen (dabei bin ich in Wirklichkeit gar nicht verheiratet), irgendwie kam auch Professor O. vor, mein geschätzter Lehrer an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, aber vollkommen sentimental, er weinte immerfort, obschon er Mathematiker ist, beziehungsweise Professor für Elektrodynamik, es war peinlich, aber das Blödsinnigste von allem: – Ich bin mit dem Düsseldorfer verheiratet! … Ich wollte protestieren, aber konnte meinen Mund nicht aufmachen, ohne die Hand davor zu halten, da mir soeben, wie ich spürte, sämtliche Zähne ausgefallen sind, alle wie Kieselsteine im Mund —
Ich war, kaum erwacht, sofort im Bild:
Unter uns das offene Meer —
Es war der Motor links, der die Panne hatte; ein Propeller als starres Kreuz im wolkenlosen Himmel – das war alles.
Unter uns, wie gesagt, der Golf von Mexico.
Unsere Stewardess, ein Mädchen von zwanzig Jahren, ein Kind mindestens ihrem Aussehen nach, hatte mich an der linken Schulter gefasst, um mich zu wecken, ich wusste aber alles, bevor sie’s erklärte, indem sie mir eine grüne Schwimmweste reichte; mein Nachbar war eben dabei, seine Schwimmweste anzuschnallen, humorig wie bei Alarm-Übungen dieser Art —
Wir flogen mindestens auf zweitausend Meter Höhe.
Natürlich sind mir keine Zähne ausgefallen, nicht einmal mein Stiftzahn, der Vierer oben rechts; ich war erleichtert, geradezu vergnügt.
Im Korridor, vorn, der Captain:
There is no danger at all —
Alles nur eine Maßnahme der Vorsicht, unsere Maschine ist sogar imstande mit zwei Motoren zu fliegen, wir befinden uns 8,5 Meilen von der mexikanischen Küste entfernt, Kurs auf Tampico, alle Passagiere freundlich gebeten, Ruhe zu bewahren und vorläufig nicht zu rauchen.
Thank you.
Alle saßen wie in einer Kirche, alle mit grünen Schwimmwesten um die Brust, ich kontrollierte mit meiner Zunge, ob mir wirklich keine Zähne wackelten, alles andere regte mich nicht auf.
Zeit 10.25 Uhr.
Ohne unsere Verspätung wegen Schneesturm in den nördlichen Staaten wären wir jetzt in Mexico-City gelandet, ich sagte es meinem Düsseldorfer – bloß um zu reden. Ich hasse Feierlichkeit.
Keine Antwort.
Ich fragte nach seiner genauen Zeit —
Keine Antwort.
Die Motoren, die drei anderen, liefen in Ordnung, von Ausfall nichts zu spüren, ich sah, dass wir die Höhe hielten, dann Küste im Dunst, eine Art von Lagune, dahinter Sümpfe. Aber von Tampico noch nichts zu sehen. Ich kannte Tampico von früher, von einer Fischvergiftung, die ich nicht vergessen werde bis ans Ende meiner Ta g e .
„Tampico“, sagte ich, „das ist die dreckigste Stadt der Welt. Ölhafen, Sie werden sehen, entweder stinkt’s nach Öl oder nach Fisch —“
Er fingerte an seiner Schwimmweste.
„Ich rate Ihnen wirklich“, sagte ich, „essen Sie keinen Fisch, mein Herr, unter keinen Umständen —“
Er versuchte zu lächeln.
„Die Einheimischen sind natürlich immun“, sagte ich, „aber unsereiner —“
Er nickte, ohne zu hören. Ich hielt ganze Vorträge, scheint es, über Amöben, beziehungsweise über Hotels in Tampico. Sobald ich merkte, dass er gar nicht zuhörte, mein Düsseldorfer, griff ich ihn am Ärmel, was sonst nicht meine Art ist, im Gegenteil, ich hasse diese Manie, einander am Ärmel zu greifen. Aber anders hörte er einfach nicht zu. Ich erzählte ihm die ganze Geschich-te meiner langweiligen Fischvergiftung in Tampico, 1951, also vor sechs Jahren – Wir flogen indessen, wie sich zeigte, gar nicht der Küste entlang, sondern plötzlich landeinwärts. Also doch nicht Tampico! Ich war sprachlos, ich wollte mich bei der Stewardess erkundigen.
Rauchen wieder gestattet!
Vielleicht war der Flughafen von Tampico zu klein für unsere Super-Constellation (damals ist es eine DC-4 gewesen) oder sie hatten Weisung bekommen, trotz der Motorpanne nach Mexico-City durchzufliegen, was ich allerdings angesichts der Sierra Madre Oriental, die uns noch bevorstand, nicht begriff. Unsere Stewardess – ich griff sie am Ellenbogen, was sonst, wie gesagt, nicht meine Art ist – hatte keine Zeit für Auskünfte, sie wurde zum Captain gerufen.
Tatsächlich stiegen wir.
Ich versuchte an Ivy zu denken —
Wir stiegen.
Unter uns immer noch Sümpfe, seicht und trübe, dazwischen Zungen von Land, Sand, die Sümpfe teilweise grün und dann wieder rötlich, Lippenstiftrot, was ich mir nicht erklären konnte, eigentlich keine Sümpfe, sondern Lagunen, und wo die Sonne spiegelt, glitzert es wie Lametta beziehungsweise wie Stanniol, jedenfalls metallisch, dann wieder himmelblau und wässerig (wie die Augen von Ivy) mit gelben Untiefen, Flecken wie violette Tinte, finster, vermutlich ein Unterwassergewächs, einmal eine Einmündung, braun wie amerikanischer Milchkaffee, widerlich, Quadratmeilen nichts als Lagunen. Auch der Düsseldorfer hatte das Gefühl, wir steigen.
Die Leute redeten wieder.
Eine anständige Landkarte, wie bei der Swissair immer zur Hand, gab es hier nicht, und was mich nervös machte, war lediglich diese idiotische Information: Kurs nach Tampico, während die Maschine landeinwärts fliegt – steigend, wie gesagt, mit drei Motoren, ich beobachtete die drei glitzernden Scheiben, die manchmal zu stocken scheinen, was auf optischer Täuschung beruht, ein schwarzes Zucken wie üblich. Es war kein Grund, sich aufzuregen, komisch nur der Anblick: das starre Kreuz eines stehenden Propellers bei voller Fahrt.
Unsere Stewardess tat mir leid.
Sie musste von Reihe zu Reihe gehen, lächelnd wie Reklame, und fragen, ob jedermann sich wohlfühle in seiner Schwimmweste; sobald man ein Witzchen machte, verlor sie ihr Lächeln. Ob man im Gebirge schwimmen könne? fragte ich —
Order war Order.
Ich hielt sie am Arm, die junge Person, die meine Tochter hätte sein können, beziehungsweise am Handgelenk; ich sagte ihr (natürlich zum Spass!) mit erhobenem Finger, sie habe mich zu diesem Flug gezwungen, jawohl, niemand anders als sie – sie sagte:
„There is no danger, Sir, no danger at all. We’re going to land in Mexico-City in about one hour and twenty minutes.“
Das sagte sie jedem.
Ich ließ sie los, damit sie wieder lächeln und ihre Pflicht erfüllen konnte, schauen, ob jedermann angeschnallt war. Kurz darauf hatte sie Order, Lunch zu bringen, obschon es noch nicht Lunchtime war… Zum Glück hatten wir schönes Wetter auch über Land, fast keine Wolken, jedoch Böen wie üblich vor Gebirgen, die normale Thermik, so dass unsere Maschine sackte, schaukelte, bis sie sich wieder im Gleichgewicht hatte und stieg, um neuerdings zu sacken mit schwingenden Tragflächen; Minuten lang flog man vollkommen ruhig, dann wieder ein Stoss, so dass die Tragflächen wippten, und wieder das Schlenkern, bis die Maschine sich fing und stieg, als wäre es für immer in Ordnung, und wieder sackte – wie üblich bei Böen.
In der Ferne die blauen Gebirge.
Sierra Madre Oriental.
Unter uns die rote Wüste.
Als kurz darauf – wir erhielten gerade unsren Lunch, mein Düsseldorfer und ich, das Übliche: Juice, ein schneeweißes Sandwich mit grünem Salat – plötzlich ein zweiter Motor aussetzte, war die Panik natürlich da, unvermeidlich, trotz Lunch auf dem Knie. Jemand schrie.
Von diesem Augenblick an ging alles sehr rasch —
Offenbar befürchtete man noch den Ausfall der anderen Motoren, so dass man sich zur Notlandung entschloss. Jedenfalls sanken wir, der Lautsprecher knackte und knarrte, so dass man von den Anweisungen, die gegeben werden, kaum ein Wort versteht.
Meine erste Sorge: wohin mit dem Lunch?
Wir sanken, obschon zwei Motoren, wie gesagt, genügen sollten, das reglose Pneu-Paar in der Luft, wie üblich vor einer Landung, und ich stellte meinen Lunch einfach auf den Boden des Korridors, dabei befanden wir uns noch mindestens fünfhundert Meter über dem Boden.
Jetzt ohne Böen.
No smoking.
Die Gefahr, dass unsere Maschine bei der Notlandung zerschellt oder in Flammen aufgeht, war mir bewusst – ich staunte über meine Ruhe.
Ich dachte an niemand.
Alles ging sehr geschwind, wie schon gesagt, unter uns Sand, ein flaches Tal zwischen Hügeln, die felsig zu sein schienen, alles vollkommen kahl, Wü s t e —
Eigentlich war man nur gespannt.
Wir sanken, als läge eine Piste unter uns, ich presste mein Gesicht ans Fenster, man sieht ja diese Pisten immer erst im letzten Augenblick, wenn schon die Bremsklappen draußen sind. Ich wunderte mich, dass die Bremsklappen nicht kommen. Unsere Maschine vermied offensichtlich jede Kurve, um nicht abzusacken, und wir flogen über die günstige Ebene hinaus, unser Schatten flog immer näher, er sauste schneller als wir, so schien es, ein grauer Fetzen auf dem rötlichen Sand, er flatterte.
Dann Felsen —
Jetzt stiegen wir wieder.
Dann, zum Glück, neuerdings Sand, aber Sand mit Agaven, beide Motoren auf Vollgas, so flogen wir Minuten lang auf Haushöhe, das Fahrgestell wurde wieder eingezogen. Also Bauchlandung! Wir flogen, wie man sonst in großen Höhen fliegt, ziemlich ruhig und ohne Fahrgestell – aber auf Haushöhe, wie gesagt, und ich wusste, es wird keine Piste kommen, trotzdem presste ich das Gesicht ans Fenster.
Plötzlich war unser Fahrgestell neuerdings ausgeschwenkt, ohne dass eine Piste kam, dazu die Bremsklappen, man spürte es wie eine Faust gegen den Magen, Bremsen, Sinken wie im Lift, im letzten Augenblick verlor ich die Nerven, so dass die Notlandung – ich sah nur noch die flitzenden Agaven zu beiden Seiten, dann beide Hände vors Gesicht! – nichts als ein blinder Schlag war, Sturz vornüber in die Bewusstlosigkeit.
Dann Stille.
Wir hatten ein Affenschwein, kann ich nur sagen, niemand hatte auch nur eine Nottüre aufgetan, ich auch nicht, niemand rührte sich, wir hingen vornüber in unseren Gurten.
„Go on“, sagte der Captain, „go on!“
Niemand rührte sich.
„Go on!“
Zum Glück kein Feuer, man musste den Leuten sagen, sie dürften sich abschnallen, die Türe war offen, aber es kam natürlich keine Treppe angerollt, wie man’s gewohnt ist, bloß Hitze, wie wenn man einen Ofen aufmacht, Glutluft.
Ich war unverletzt.
Endlich die Strickleiter!
Man versammelte sich, ohne dass es eine Order brauchte, im Schatten unter der Tragfläche, alle stumm, als wäre Sprechen in der Wüste strengstens verboten. Unsere Super-Constellation stand etwas vornüber gekippt, nicht schlimm, nur das vordere Fahrgestell war gestaucht, weil eingesunken im Sand, nicht einmal gebrochen. Die vier Propeller-Kreuze glänzten im knallblauen Himmel, ebenso die drei Schwanzsteuer. Niemand rührte sich, wie gesagt, offenbar warteten alle, dass der Captain etwas sagte.
„Well“, sagte er, „there we are!“
Er lachte.
Ringsum nichts als Agaven, Sand, die rötlichen Gebirge in der Ferne, ferner als man vorher geschätzt hat, vor allem Sand und nochmals Sand, gelblich, das Flimmern der heißen Luft darüber, Luft wie flüssiges Glas. —
Zeit: 11.05 Uhr.
Ich zog meine Uhr auf —
Die Besatzung holte Wolldecken heraus, um die Pneus vor der Sonne zu schützen, während wir in unseren grünen Schwimmwesten umherstanden, untätig. Ich weiß nicht, warum niemand die Schwimmweste auszog.
Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal, als Techniker bin ich gewohnt mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Wieso Fügung? Ich gebe zu: Ohne die Notlandung in Tamaulipas (2. IV.) wäre alles anders gekommen; ich hätte diesen jungen Hencke nicht kennen gelernt, ich hätte vielleicht nie wieder von Hanna gehört, ich wüsste heute noch nicht, dass ich Vater bin. Es ist nicht auszudenken, wie anders alles gekommen wäre ohne diese Notlandung in Tamaulipas. Vielleicht würde Sabeth noch leben. Ich bestreite nicht: Es war mehr als ein Zufall, dass alles so gekommen ist, es war eine ganze Kette von Zufällen. Aber wieso Fügung? Ich brauche, um das Unwahrscheinliche als Erfahrungstatsache gelten zu lassen, keinerlei Mystik; Mathematik genügt mir.
Mathematisch gesprochen:
Das Wahrscheinliche (dass bei 6 000 000 000 Würfen mit einem regelmäßigen Sechserwürfel annähernd 1 000 000 000 Einser vorkommen) und das Unwahrscheinliche (dass bei 6 Würfen mit demselben Würfel einmal 6 Einser vorkommen) unterscheiden sich nicht dem Wesen nach, sondern nur der Häufigkeit nach, wobei das Häufigere von vornherein als glaubwürdiger erscheint. Es ist aber, wenn einmal das Unwahrscheinliche eintritt, nichts Höheres dabei, keinerlei Wunder oder Derartiges, wie es der Laie so gerne haben möchte. Indem wir vom Wahrscheinlichen sprechen, ist ja das Unwahrscheinliche immer schon inbegriffen und zwar als Grenzfall des Möglichen, und wenn es einmal eintritt, das Unwahrscheinliche, so besteht für unsereinen keinerlei Grund zur Verwunderung, zur Erschütterung, zur Mystifikation.
Vergleiche hierzu:
Ernst Mally4 Wahrscheinlichkeit und Gesetz, ferner Hans Reichenbach5 Wahrscheinlichkeitslehre, ferner Whitehead6 und Russell7 Principia Mathematica, ferner v. Mises8 Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit.
Unser Aufenthalt in der Wüste von Tamaulipas, Mexico, dauerte vier Tage und drei Nächte, total 85 Stunden, worüber es wenig zu berichten gibt – ein grandioses Erlebnis (wie jedermann zu erwarten scheint, wenn ich davon spreche) war es nicht. Dazu viel zu heiß! Natürlich dachte ich auch sofort an den Disney-Film, der ja grandios war, und nahm sofort meine Kamera; aber von Sensation nicht die Spur, ab und zu eine Eidechse, die mich erschreckte, eine Art von Sandspinnen, das war alles.
Es blieb uns nichts als Warten.
Das erste, was ich in der Wüste von Tamaulipas tat: ich stellte mich dem Düsseldorfer vor, denn er interessierte sich für meine Kamera, ich erläuterte ihm meine Optik.
Andere lasen.
Zum Glück, wie sich bald herausstellte, spielte er auch Schach, und da ich stets mit meinem Steck-Schach reise, waren wir gerettet; er organisierte sofort zwei leere Coca-Cola-Kistchen, wir setzten uns abseits, um das allgemeine Gerede nicht hören zu müssen, in den Schatten unter dem Schwanzsteuer – kleiderlos, bloß in Schuhen (wegen der Hitze des Sandes) und in Jockey-Unterhosen.
Unser Nachmittag verging im Nu.
Kurz vor Einbruch der Dämmerung erschien ein Flugzeug, Militär, es kreiste lange über uns, ohne etwas abzuwerfen, und verschwand (was ich gefilmt habe) gegen Norden, Richtung Monterre y.
Abendessen: ein Käse-Sandwich, eine halbe Banane.
Ich schätze das Schach, weil man Stunden lang nichts zu reden braucht. Man braucht nicht einmal zu hören, wenn der andere redet. Man blickt auf das Brett, und es ist keineswegs unhöflich, wenn man kein Bedürfnis nach persönlicher Bekanntschaft zeigt, sondern mit ganzem Ernst bei der Sache ist —
„Sie sind am Zug! “ sagte er —
Die Entdeckung, dass er Joachim, meinen Freund, der seit mindestens zwanzig Jahren einfach verstummt war, nicht nur kennt, sondern dass er geradezu sein Bruder ist, ergab sich durch Zufall… Als der Mond aufging (was ich ebenfalls gefilmt habe) zwischen schwarzen Agaven am Horizont, hätte man noch immer Schach spielen können, so hell war es, aber plötzlich zu kalt; wir waren hinausgestapft, um eine Zigarette zu rauchen, hinaus in den Sand, wo ich gestand, dass ich mir aus Landschaften nichts mache, geschweige denn aus einer Wüste.
„Das ist nicht Ihr Ernst! “ sagte er.
Er fand es ein Erlebnis.
„Gehen wir schlafen!“ sagte ich, „– Hotel Super-Constellation, Holiday In Desert With All Accommodations!“
Ich fand es kalt.
Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnis reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe alles, wovon sie reden, sehr genau; ich bin ja nicht blind. Ich sehe den Mond über der Wüste von Tamaulipas – klarer als je, mag sein, aber eine errechenbare Masse, die um unseren Planeten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe die gezackten Felsen, schwarz vor dem Schein des Mondes; sie sehen aus, mag sein, wie die gezackten Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiß: Es sind Felsen, Gestein, wahrscheinlich vulkanisch, das müsste man nachsehen und feststellen. Wozu soll ich mich fürchten? Es gibt keine urweltlichen Tiere mehr. Wozu sollte ich sie mir einbilden? Ich sehe auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid; auch keine Dämonen, ich sehe, was ich sehe: die üblichen Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem Sand, aber keine Gespenster. Wozu weibisch werden? Ich sehe auch keine Sintflut, sondern Sand, vom Mond beschienen, vom Wind gewellt wie Wasser, was mich nicht überrascht; ich finde es nicht fantastisch, sondern erklärlich. Ich weiß nicht, wie verdammte Seelen aussehen; vielleicht wie schwarze Agaven in der nächtlichen Wüste. Was ich sehe, das sind Agaven, eine Pflanze, die ein einziges Mal blüht und dann abstirbt. Ferner weiß ich, dass ich nicht (wenn es im Augenblick auch so aussieht) der erste oder letzte Mensch auf der Erde bin; und ich kann mich von der bloßen Vorstellung, der letzte Mensch zu sein, nicht erschüttern lassen, denn es ist nicht so. Wozu hysterisch sein? Gebirge sind Gebirge, auch wenn sie in gewisser Beleuchtung, mag sein, wie irgend etwas anderes aussehen, es ist aber die Sierra Madre Oriental, und wir stehen nicht in einem Totenreich, sondern in der Wüste von Tamaulipas, Mexico, ungefähr sechzig Meilen von der nächsten Straße entfernt, was peinlich ist, aber wieso ein Erlebnis? Ein Flugzeug ist für mich ein Flugzeug, ich sehe keinen ausgestorbenen Vogel dabei, sondern eine Super-Constellation mit Motor-Defekt, nichts weiter, und da kann der Mond sie bescheinen, wie er will. Warum soll ich erleben, was gar nicht ist? Ich kann mich auch nicht entschließen, etwas wie die Ewigkeit zu hören; ich höre gar nichts, ausgenommen das Rieseln von Sand nach jedem Schritt. Ich schlottere, aber ich weiß: in sieben bis acht Stunden kommt wieder die Sonne. Ende der Welt, wieso? Ich kann mir keinen Unsinn einbilden, bloß um etwas zu erleben. Ich sehe den Sand-Horizont, weißlich in der grünen Nacht, schätzungsweise zwanzig Meilen von hier, und ich sehe nicht ein, wieso dort, Richtung Tampico, das Jenseits beginnen soll. Ich kenne Tampico. Ich weigere mich, Angst zu haben aus bloßer Fantasie, beziehungsweise fantastisch zu werden aus bloßer Angst, geradezu mystisch.
„Kommen Sie!“ sagte ich.
Herbert stand und erlebte noch immer.
„Übrigens“, sagte ich, „sind Sie irgendwie verwandt mit einem Joachim Hencke, der einmal in Zürich studiert hat?“ Es kam mir ganz plötzlich, als wir so standen, die Hände in den Hosentaschen, den Rockkragen heraufgestülpt; wir wollten gerade in die Kabine steigen.
„Joachim?“ sagte er, „das ist mein Bruder.“
„Nein!“ sagte ich —
„Ja“, sagte er, „natürlich – ich erzählte Ihnen doch, dass ich meinen Bruder in Guatemala besuche.“
Wir mussten lachen.
„Wie klein die Welt ist!“
Die Nächte verbrachte man in der Kabine, schlotternd in Mantel und Wolldecken; die Besatzung kochte Tee, solange Wasser vorhanden.
„Wie geht’s ihm denn?“ fragte ich. „Seit zwanzig Jahren habe ich nichts mehr von ihm gehört. “
„Danke“, sagte er, „danke —“
„Damals“, sagte ich, „waren wir sehr befreundet —“
Was ich erfuhr, war so das Übliche: Heirat, ein Kind (was ich offenbar überhört habe; sonst hätte ich mich nicht später danach erkundigt), dann Krieg, Gefangenschaft, Heimkehr nach Düsseldorf und so fort, ich staunte, wie die Zeit vergeht, wie man älter wird.
„Wir sind besorgt“, sagte er —
„Wieso?“
„Er ist der einzige Weiße da unten“, sagte er, „seit zwei Monaten keinerlei Nachrichten —“
Er berichtete.
Die meisten Passagiere schliefen schon, man musste flüstern, das große Licht in der Kabine war lange schon gelöscht, um die Batterie zu schonen, war man gebeten, auch das kleine Lämpchen über dem Sitz auszuknipsen; es war dunkel, nur draußen die Helligkeit des Sandes, die Tragflächen im Mondlicht, glänzend, kalt.
„Wieso Revolte?“ fragte ich.
Ich beruhigte ihn.
„Wieso Revolte?“ sagte ich, „vielleicht sind seine Briefe einfach verlorengegangen —“
Jemand bat uns, endlich zu schweigen.
Zweiundvierzig Passagiere in einer Super-Constellation, die nicht fliegt, sondern in der Wüste steht, ein Flugzeug mit Wolldecken um die Motoren (um sie vor Sand zu schützen) und mit Wolldecken um jeden Pneu, die Passagiere genau so, wie wenn man fliegt, in ihren Sesseln schlafend mit schrägen Köpfen und meistens offenen Mündern, aber dazu Totenstille, draußen die vier blanken Propeller-Kreuze, der weißliche Mondglanz auch auf den Tragflächen, alles reglos – es war ein komischer Anblick.
Jemand redete im Traum —
Beim Erwachen am Morgen, als ich zum Fensterchen hinausschaute und den Sand sah, die Nähe des Sandes, erschrak ich eine Sekunde lang, unnötigerweise.
Herbert las wieder ein rororo.
Ich nahm mein Kalenderchen:
27. III. Montage in Caracas!
Zum Frühstück gab es Juice, dazu zwei Biscuits, dazu Versicherungen, dass Lebensmittel unterwegs sind, Getränke auch, kein Grund zu Besorgnis – sie hätten besser nichts gesagt; denn so wartete man natürlich den ganzen Tag auf Motorengeräusch.
Wieder eine Irrsinnshitze!
In der Kabine war’s noch heißer —
Was man hörte: Wind, dann und wann Pfiffe von Sandmäusen, die man allerdings nicht sah, das Rascheln einer Eidechse, vor allem ein steter Wind, der den Sand nicht aufwirbelte, wie gesagt, aber rieseln ließ, so dass unsere Trittspuren immer wieder gelöscht waren; immer wieder sah es aus, als wäre niemand hier gewesen, keine Gesellschaft von zweiundvierzig Passagieren und fünf Leuten der Besatzung.
Ich wollte mich rasieren —
Zu filmen gab es überhaupt nichts.
Ich fühle mich nicht wohl, wenn unrasiert; nicht wegen der Leute, sondern meinetwegen. Ich habe dann das Gefühl, ich werde etwas wie eine Pflanze, wenn ich nicht rasiert bin, und ich greife unwillkürlich an mein Kinn. Ich holte meinen Apparat und versuchte alles mögliche, beziehungsweise unmögliche, denn ohne elektrischen Strom ist mit diesem Apparat ja nichts zu machen, das weiß ich – das war es ja, was mich nervös machte: dass es in der Wüste keinen Strom gibt, kein Telefon, keinen Stecker, nichts. Einmal, mittags, hörte man Motoren.
Alle, außer Herbert und mir, standen draußen in der brütenden Sonne, um Ausschau zu halten in dem violetten Himmel über dem gelblichen Sand und den grauen Disteln und den rötlichen Gebirgen, es war nur ein dünnes Summen, eine gewöhnliche DC-7, die da in großer Höhe glänzte, im Widerschein weiß wie Schnee, Kurs auf Mexico-City, wo wir gestern um diese Zeit hätten landen sollen.
Die Stimmung war miserabler als je.
Wir hatten unser Schach, zum Glück.
Viele Passagiere folgten unserem Vorbild, indem sie sich mit Schuhen und Unterhosen begnügten; die Damen hatten es schwieriger, einige saßen in aufgekrempelten Röcken und in Büstenhaltern, blau oder weiß oder rosa, ihre Bluse um den Kopf gewickelt wie einen Turban.
Viele klagten über Kopfschmerz.
Jemand musste sich erbrechen —
Wir hockten wieder abseits, Herbert und ich, im Schatten unter dem Schwanzsteuer, das, wie die Tragflächen auch, im Widerschein des besonnten Sandes blendete, so dass man sogar im Schatten wie unter einem Scheinwerfer saß, und wir redeten wie üblich wenig beim Schach. Einmal fragte ich:
„Ist Joachim denn nicht mehr verheiratet?“
„Nein“, sagte er.
„Geschieden?“
„Ja“, sagte er.
„Wir haben viel Schach gespielt – damals.“
„So“, sagte er.
Seine Einsilbigkeit reizte mich.
„Wen hat er denn geheiratet?“
Ich fragte zum Zeitvertreib, es machte mich nervös, dass man nicht rauchen durfte, ich hatte eine Zigarette im Mund, feuerlos, weil Herbert sich so lange besann, obschon er sehen musste, dass es nichts mehr zu retten gibt; ich lag mit einem Pferdchen-Gewinn im sicheren Vorteil, als er nach langem Schweigen, dann so beiläufig, wie ich meinerseits gefragt hatte, den Namen von Hanna erwähnte.
„– Hanna Landsberg, Münchnerin, Halbjüdin.“
Ich sagte nichts.
„Sie sind am Zug!“ sagte er.
Ich ließ nichts merken, glaube ich. Ich zündete versehentlich meine Zigarette an, was strengstens verboten war, und löschte sofort aus. Ich tat, als überlegte ich meine Züge, und verlor Figur um Figur —
„Was ist los?“ lachte er, „was ist los?“
Wir spielten die Partie nicht zu Ende, ich gab auf und drehte das Brettchen, um die Figuren neuerdings aufzustellen. Ich wagte nicht einmal zu fragen, ob Hanna noch am Leben sei. Stundenlang spielten wir ohne ein Wort, von Zeit zu Zeit genötigt, unsere Coca-Cola-Kiste zu verrutschen, um im Schatten zu bleiben, das heißt: genötigt, immer wieder auf Sand zu sitzen, der gerade noch in der Sonne geglüht hatte. Wir schwitzten wie in der Sauna, wortlos über mein ledernes Steckschach gebeugt, das sich von unseren Schweisstropfen leider verfärbte.
Zu trinken gab es nichts mehr.
Warum ich nicht fragte, ob Hanna noch lebt, weiß ich nicht – vielleicht aus Angst, er würde mir sagen, Hanna sei nach Theresienstadt gekommen.
Ich errechnete ihr heutiges Alter.
Ich konnte sie mir nicht vorstellen.
Gegen Abend, kurz vor Dämmerung, kam endlich das versprochene Flugzeug, eine Sportmaschine, die lange kreiste, bis sie endlich den Fallschirmabwurf wagte: drei Säcke, zwei Kisten, die es im Umkreis von dreihundert Metern zu holen galt – wir waren gerettet: Carta blanca, Cerveza Mexicana, ein gutes Bier, das sogar Herbert, der Deutsche, anerkennen musste, als man mit Bierdosen in der Wüste stand, Gesellschaft in Büstenhaltern und Unterhosen, dazu wieder Sonnenuntergang, den ich auf Farbfilm nahm.
Ich träumte von Hanna.
Hanna als Krankenschwester zu Pferd!
Am dritten Tag endlich ein erster Helikopter, um wenigstens die argentinische Mama mit ihren zwei Kindern zu holen, Gott sei Dank, und um Post mitzunehmen; er wartete eine Stunde auf Post.
Herbert schrieb sofort nach Düsseldorf.
Jedermann saß und schrieb.
Man musste fast schreiben, bloß damit die lieben Leute nicht fragten, ob man denn keine Frau habe, keine Mutter, keine Kinder, – ich holte meine Hermes-Baby9 (sie ist heute noch voll Sand) und spannte einen Bogen ein, Bogen mit Durchschlag, da ich annahm, ich würde an Williams schreiben, tippte das Datum und schob – Platz für Anrede:
„My Dear!“
Ich schrieb also an Ivy. Lange schon hatte ich das Bedürfnis, einmal sauberen Tisch zu machen. Endlich einmal hatte ich die Ruhe und Zeit, die Ruhe einer ganzen Wüste.
„My Dear —“
Dass ich in der Wüste hocke, sechzig Meilen von der befahrbaren Welt entfernt, war bald gesagt. Dass es heiß ist, schönes Wetter, keine Spur von Verletzung und so weiter, dazu ein paar Details zwecks Anschaulichkeit: Coca-Cola-Kiste, Unterhosen, Helikopter, Bekanntschaft mit einem Schachspieler, all dies füllte noch keinen Brief. Was weiter? Die bläulichen Gebirge in der Ferne. Was weiter? Gestern Bier. Was weiter? Ich konnte sie nicht einmal um Zustellung von Filmen bitten und war mir bewusst, dass Ivy, wie jede Frau, eigentlich nur wissen möchte, was ich fühle, beziehungsweise denke, wenn ich schon nichts fühle, und das wusste ich zwar genau: Ich habe Hanna nicht geheiratet, die ich liebte, und wieso soll ich Ivy heiraten? – aber das zu formulieren, ohne dass es verletzte, war verdammt nicht leicht, denn sie wusste ja nichts von Hanna und war ein lieber Kerl, aber eine Art von Amerikanerin, die jeden Mann, der sie ins Bett nimmt, glaubt heiraten zu müssen. Dabei war Ivy durchaus verheiratet, ich weiß nicht zum wievielten Mal, und ihr Mann, Beamter in Washington, dachte ja nicht dran, sich scheiden zu lassen; denn er liebte Ivy. Ob er ahnte, warum Ivy regelmäßig nach New York flog, weiß ich nicht. Sie sagte, sie ginge zum Psychiater, und das ging sie nämlich auch. Jedenfalls klopfte es nie an meiner Türe, und ich sah nicht ein, wieso Ivy, sonst in ihren Ansichten modern, eine Ehe daraus machen wollte; sowieso hatten wir in letzter Zeit nur noch Krach, schien mir, Krach um jede Kleinigkeit. Krach wegen Studebakeroder-Nash! Ich brauchte nur daran zu denken – und es tippte plötzlich wie von selbst, im Gegenteil, ich musste auf die Uhr sehen, damit mein Brief noch fertig wird, bis der Helikopter startet.
Sein Motor lief bereits —
Nicht ich, sondern Ivy hatte den Studebaker gewollt; vor allem die Farbe (Tomatenrot nach ihrer Meinung, Himbeerrot nach meiner Meinung) war ihr Geschmack, nicht meiner, denn das Technische kümmerte sie wenig. Ivy war Mannequin, sie wählte ihre Kleider nach der Wagenfarbe, glaube ich, die Wagenfarbe nach ihrem Lippenstift oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Ich kannte nur ihren ewigen Vorwurf: dass ich überhaupt keinen Geschmack habe und dass ich sie nicht heirate. Dabei war sie, wie gesagt, ein lieber Kerl. Aber dass ich daran dachte, ihren Studebaker zu verkaufen, das fand sie unmöglich, beziehungsweise typisch für mich, dass ich nicht eine Sekunde lang an ihre Garderobe dächte, die mit dem Himbeer-Studebaker stand und fiel, typisch für mich, denn ich sei ein Egoist, ein Rohling, ein Barbar in bezug auf Geschmack, ein Unmensch in bezug auf die Frau. Ich kannte ihre Vorwürfe und hatte sie satt. Dass ich grundsätzlich nicht heirate, das hatte ich oft genug gesagt, zumindest durchblicken lassen, zuletzt aber auch gesagt, und zwar auf dem Flugplatz, als wir drei Stunden lang auf diese Super-Constellation hatten warten müssen. Ivy hatte sogar geweint, somit gehört, was ich sagte. Aber vielleicht brauchte Ivy es schwarz auf weiß. Wären wir bei dieser Notlandung verbrannt, könnte sie auch ohne mich leben! – schrieb ich ihr (zum Glück mit Durchschlag) deutlich genug, so meinte ich, um uns ein Wiedersehen zu ersparen.
Der Helikopter war startbereit —
Ich konnte meinen Brief nicht mehr durchlesen, nur in den Umschlag stecken, zukleben und geben – schauen, wie der Helikopter startete.
Langsam hatte man Bärte.
Ich sehnte mich nach elektrischem Strom – Langsam wurde die Sache doch langweilig, eigentlich ein Skandal, dass die zweiundvierzig Passagiere und fünf Leute der Besatzung nicht längst aus dieser Wüste befreit waren, schließlich reisten die meisten von uns in dringenden Geschäften.
Einmal fragte ich doch:
„Lebt sie eigentlich noch?“
„Wer?“ fragte er.
„Hanna – seine Frau.“
„Ach so“, sagte er und überlegte nur, wie er meine Gambit-Eröffnung abwehren solle, dazu sein Pfeifen, das mir sowieso auf die Nerven ging, ein halblautes Pfeifen ohne jede Melodie, Gezisch wie bei einem Ventil, unwillkürlich – ich musste nochmals fragen:
„Wo lebt sie denn heute?“
„Weiß ich nicht“, sagte er.
„Aber sie lebt noch?“
„Ich nehme an.“
„Du weißt es nicht?“
„Nein“, sagte er, „aber ich nehme an —“ Er wiederholte alles wie sein eigenes Echo: „– ich nehme an.“
Unser Schach war ihm wichtiger.
„Vielleicht ist alles zu spät“, sagte er später, „vielleicht ist alles zu spät.“
Damit meinte er das Schach.
„Hat sie denn noch emigrieren können?“
„Ja“, sagte er, „das hat sie —“
„Wann?“
„1938“, sagte er, „in letzter Stunde —“
„Wohin?“
„Paris“, sagte er, „dann vermutlich weiter, denn ein paar Jahre später waren wir ja auch in Paris. – Übrigens meine schönste Zeit! Bevor ich in den Kaukasus kam. Sous les toits de Paris!“
Mehr war nicht zu erfragen.
„Du“, sagte er, „das ist eine beschissene Sache, scheint mir, wenn ich jetzt nicht abtausche.“
Wir spielten immer lustloser.
Wie man später erfuhr, warteten damals acht Helikopter der US-Army an der mexikanischen Grenze auf die behördliche Bewilligung, uns zu holen.
Ich putzte meine Hermes-Baby.
Herbert las.
Es blieb uns nichts als Warten.
Was Hanna betrift:
Ich hätte Hanna gar nicht heiraten können, ich war damals, 1933 bis 1935, Assistent an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich, arbeitete an meiner Dissertation (Über die Bedeutung des sogenannten Maxwell’schen Dämons) und verdiente dreihundert Franken im Monat, eine Heirat kam damals nicht in Frage, wirtschaftlich betrachtet, abgesehen von allem anderen. Hanna hat mir auch nie einen Vorwurf gemacht, dass es damals nicht zur Heirat kam. Ich war bereit dazu. Im Grunde war es Hanna selbst, die damals nicht heiraten wollte.
Mein Entschluss, eine Dienstreise einfach zu ändern und einen privaten Umweg über Guatemala zu machen, bloß um einen alten Jugendfreund wiederzusehen, fiel auf dem neuen Flugplatz in Mexico-City, und zwar im letzten Augenblick; ich stand schon an der Schranke, nochmals Händeschütteln, ich bat Herbert, seinen Bruder zu grüßen von mir, sofern Joachim sich überhaupt noch an mich erinnerte – dazu wieder der übliche Lautsprecher: Your attention please, your attention please, es war wieder eine Super-Constellation, all passengers for Panama – Caracas – Pernambuco, es ödete mich einfach an, schon wieder in ein Flugzeug zu steigen, schon wieder Gürtel zu schnallen, Herbert sagte:
„Mensch, du musst gehen!“
Ich gelte in beruflichen Dingen als äußerst gewissenhaft, geradezu pedantisch, jedenfalls ist es noch nicht vorgekommen, dass ich eine Dienstreise aus purer Laune verzögerte, geschweige denn änderte – eine Stunde später flog ich mit Herbert.
„Du“, sagte er, „das ist flott von dir!“
Ich weiß nicht, was es wirklich war.
„Nun warten die Turbinen einmal auf mich“, sagte ich, „ich habe auch schon auf Turbinen gewartet – nun warten sie einmal auf mich!“
Natürlich ist das kein Standpunkt.
Schon in Campeche empfing uns die Hitze mit schleimiger Sonne und klebriger Luft, Gestank von Schlamm, der an der Sonne verwest, und wenn man sich den Schweiß aus dem Gesicht wischt, so ist es, als stinke man selbst nach Fisch. Ich sagte nichts. Schließlich wischt man sich den Schweiß nicht mehr ab, sondern sitzt mit geschlossenen Augen und atmet mit geschlossenem Mund, Kopf an eine Mauer gelehnt, die Beine von sich gestreckt. Herbert war ganz sicher, dass der Zug jeden Dienstag fährt, laut Reiseführer von Düsseldorf, er hatte es sogar schwarz auf weiß – aber es war, wie sich nach fünfstündigem Warten plötzlich herausstellte, nicht Dienstag, sondern Montag.
Ich sagte kein Wort.
Im Hotel gibt es wenigstens eine Dusche, ein Handtuch, das nach Campfer riecht wie üblich in diesen Gegenden, und wenn man sich duschen will, fallen die fingerlangen Käfer aus dem schimmligen Vorhang – ich ersäufte sie, doch kletterten sie nach einer Weile immer wieder aus dem Ablauf hervor, bis ich sie mit der Ferse zertrat, um mich endlich duschen zu können.
Ich träumte von diesen Käfern.
Ich war entschlossen, Herbert zu verlassen und am andern Mittag zurückzufliegen, Kameradschaft hin oder her —
Ich spürte wieder meinen Magen.
Ich lag splitternackt – Es stank die ganze Nacht. Auch Herbert lag splitternackt – Campeche ist immerhin noch eine Stadt, eine Siedlung mit elektrischem Strom, so dass man sich rasieren konnte, und mit Telefon; aber auf allen Drähten hockten schon Zopilote, die reihenweise warten, bis ein Hund verhungert, ein Esel verreckt, ein Pferd geschlachtet wird, dann flattern sie herab… Wir kamen gerade hinzu, wie sie hin und her zerrten an einem solchen Geschlamp von Eingeweide, eine ganze Meute von schwarzvioletten Vögeln mit blutigen Därmen in ihren Schnäbeln, nicht zu vertreiben, auch wenn ein Wagen kommt; sie zerren das Aas anderswohin, ohne aufzufliegen, nur hüpfend, nur huschend, alles mitten auf dem Markt. Herbert kaufte eine Ananas.
Ich war entschlossen, wie gesagt, nach Mexico-City zurückzufliegen. Ich war verzweifelt. Warum ich es nicht tat, weiß ich nicht.
Plötzlich war’s Mittag —
Wir standen draußen auf einem Damm, wo es weniger stank, aber um so heißer war, weil schattenlos, und aßen unsere Ananas, wir bückten uns vornüber, so tropfte es, dann über die Steine hinunter, um die zuckerigen Finger zu spülen; das warme Wasser war ebenfalls klebrig, nicht zuckerig, aber salzig, und die Finger stanken nach Tang, nach Motoröl, nach Muscheln, nach Fäulnis unbestimmbarer Art, so dass man sie sofort am Taschentuch abwischte. Plötzlich das Motorengeräusch! Ich stand gelähmt. Meine DC-4 nach Mexico-City, sie flog gerade über uns hinweg, dann Kurve aufs offene Meer hinaus, wo sie im heißen Himmel sich sozusagen auflöste wie in einer blauen Säure – Ich sagte nichts.
Ich weiß nicht, wie jener Tag verging.
Er verging —
Unser Zug (Campeche–Palenque–Coatzacoalcos) war besser als erwartet: Eine Dieselmaschine und vier Wagen mit air-condition, so dass wir die Hitze vergaßen, mit der Hitze auch den Unsinn dieser ganzen Reise.
„Ob Joachim mich noch kennt?“
Ab und zu hielt unser Zug auf offener Strecke in der Nacht, man hatte keine Ahnung wieso, nirgends ein Licht, nur dank eines fernen Gewitters erkannte man, dass es durch Dschungel geht, teilweise Sumpf, Wetterleuchten hinter einem Geflecht von schwarzen Bäumen, unsere Lokomotive tutete und tutete in die Nacht hinaus, man konnte das Fenster nicht öffnen, um zu sehen, was los ist… Plötzlich fuhr er wieder: dreißig Stundenkilometer, obschon es topfeben ist, eine schnurgerade Strecke. Immerhin war man zufrieden, dass es weiterging.
Einmal fragte ich:
„Warum sind sie eigentlich geschieden?“
„Weiß ich nicht“, sagte er, „sie wurde Kommunistin, glaube ich —“
„Drum?“
Er gähnte.
„Ich weiß es nicht“, sagte er, „es ging nicht. Ich habe nie danach gefragt.“
Einmal, als unser Zug neuerdings hielt, ging ich zur Wagentür, um hinauszuschauen. Draußen die Hitze, die man vergessen hatte, eine feuchte Finsternis und Stille. Ich ging aufs Trittbrett hinunter, Stille mit Wetterleuchten, ein Büffel stand auf dem schnurgeraden Geleise vor uns, nichts weiter. Er stand wie ausgestopft, weil vom Scheinwerfer unserer Lokomotive geblendet, stur. Sofort hatte man wieder Schweiß auf der Stirne und am Hals. Es tutete und tutete. Ringsum nichts als Dickicht. Nach einigen Minuten ging der Büffel (oder was es war) langsam aus dem Scheinwerfer, dann hörte ich Rauschen im Dickicht, das Knicken von Ästen, dann ein Klatschen, sein Platschen im Wasser, das man nicht sah —
Dann fuhren wir wieder.
„Haben sie denn Kinder?“ fragte ich.
„Eine Tochter —“
Wir richteten uns zum Schlafen, die Jacke unter den Nacken, die Beine gestreckt auf die leeren Sitze gegenüber.
„Hast du sie gekannt?“
„Ja“, sagte ich, „warum?“ Kurz darauf schlief er —
Beim Morgengrauen noch immer Dickicht, die erste Sonne über dem flachen Dschungel-Horizont, viel Reiher, die in weißen Scharen auflatterten vor unserem langsamen Zug, Dickicht ohne Ende, unabsehbar, dann und wann eine Gruppe indianischer Hütten, verborgen unter Bäumen mit Luftwurzeln, manchmal eine einzelne Palme, sonst meistens Laubhölzer, Akazien und Unbekanntes, vor allem Büsche, ein vorsintflutliches Farnkraut, es wimmelte von schwefelgelben Vögeln, die Sonne wieder wie hinter Milchglas, Dunst, man sah die Hitze.
Ich hatte geträumt – (Nicht von Hanna!)
Als wir neuerdings auf offener Strecke hielten, war es Palenque, ein Bahnhöflein irgendwo, wo niemand einsteigt und niemand aussteigt außer uns, ein kleiner Schopf neben dem Geleise, ein Signal, nichts weiter, nicht einmal Verdopplung des Geleises (wenn ich mich richtig erinnere), wir erkundigten uns dreimal, ob das Palenque ist.
Sofort rann wieder der Schweiß —
Wir standen mit unserem Gepäck, als der Zug weiterfuhr, wie am Ende der Welt, mindestens am Ende der Zivilisation, und von einem Jeep, der hier hätte warten sollen, um den Herrn aus Düsseldorf sofort zur Plantage hinüberzufahren, war natürlich keine Spur.
„There we are!“
Ich lachte.
Immerhin gab es ein Sträßlein, und nach einer halben Stunde, die uns ziemlich erschöpft hatte, kamen Kinder aus den Büschen, später ein Eseltreiber, der unser Gepäck nahm, ein Indio natürlich, ich behielt nur meine gelbe Aktenmappe mit Reißverschluss.
Fünf Tage hingen wir in Palenque.
Wir hingen in Hängematten, allzeit ein Bier in greifbarer Nähe, schwitzend, als wäre Schwitzen unser Lebenszweck, unfähig zu irgendeinem Entschluss, eigentlich ganz zufrieden, denn das Bier ist ausgezeichnet, Yucateca, besser als das Bier im Hochland, wir hingen in unseren Hängematten und tranken, um weiter schwitzen zu können, und ich wusste nicht, was wir eigentlich wollten.
Wir wollten einen Jeep!
Wenn man es sich nicht immer wieder sagte, so vergaß man es, und sonst sagten wir wenig den ganzen Tag, ein sonderbarer Zustand.
Ein Jeep, ja, aber woher?
Sprechen machte nur durstig.
Der Wirt unsres winzigen Hotels (Lacroix) hatte einen Landrover, offensichtlich das einzige Fahrzeug in Palenque, das er aber selber brauchte, um Bier und Gäste von der Bahn zu holen, Leute, die sich etwas aus indianischen Ruinen machen, Liebhaber von Pyramiden; zur Zeit war nur ein einziger da, ein junger Amerikaner, der zuviel redete, aber zum Glück war er tagsüber immer weg – draußen auf den Ruinen, die auch wir, meinte er, besichtigen sollten.
Ich dachte ja nicht daran!
Jeder Schritt löste Schweiß aus, der sofort mit Bier ersetzt werden musste, und es ging nur, indem man in der Hängematte hing mit bloßen Füßen und sich nicht rührte, rauchend, Apathie als einzig möglicher Zustand – sogar das Gerücht, die Plantage jenseits der Grenze sei seit Monaten verlassen, regte uns nicht auf; wir blickten einander an, Herbert und ich, und tranken unser Bier.
Unsere einzige Chance: der Landrover.
Der stand tagelang vor dem Hotelchen —
Aber der Wirt, wie gesagt, brauchte ihn!
Erst nach Sonnenuntergang (die Sonne geht eigentlich nicht unter, sondern ermattet im Dunst) wurde es kühler, so dass man wenigstens blödeln konnte. Über die Zukunft der deutschen Zigarre! Ich fand es zum Lachen, nichts weiter, unsere ganze Reiserei und überhaupt. Revolte der Eingeborenen! Daran glaubte ich nicht einen Augenblick lang; dazu sind diese Indios viel zu sanft, zu friedlich, geradezu kindisch. Abende lang hocken sie in ihren weißen Strohhüten auf der Erde, reglos wie Pilze, zufrieden ohne Licht, still. Sonne und Mond sind ihnen Licht genug, ein weibisches Volk, unheimlich, dabei harmlos.
Herbert fragte, was ich denn glaube.
Nichts!
Was man denn machen solle, fragte er.
Duschen —
Ich duschte mich von morgens bis abends, ich hasse Schweiß, weil man sich wie ein Kranker vorkommt. (Ich bin in meinem Leben nie krank gewesen, ausgenommen Masern.) Ich glaube, Herbert fand es nicht gerade kameradschaftlich von mir, dass ich überhaupt nichts glaubte, aber es war einfach zu heiß, um etwas zu glauben, oder dann glaubte man geradezu alles – wie Herbert.
„Komm“, sagte ich, „gehen wir ins Kino!“
Herbert glaubte im Ernst, dass es in Palenque, das aus lauter indianischen Hütten besteht, ein Kino gibt, und er war wütend, als ich lachte.
Zum Regnen kam es nie.
Es wetterleuchtete jede Nacht, unsere einzige Abendunterhaltung, Palenque besitzt einen Dieselmotor, der elektrischen Strom erzeugt, aber um 21.00 Uhr abgestellt wird, so dass man plötzlich in der Finsternis des Dschungels hing und nur noch das Wetterleuchten sah, bläulich wie Quarzlampenlicht, dazu die roten Leuchtkäfer, später Mond, schleimig, Sterne sah man nicht, dazu war es zu dunstig… Joachim schreibt einfach keine Briefe, weil es zu heiß ist, ich konnte es verstehen; er hängt in seiner Hängematte wie wir, gähnend, oder er ist tot – da gab es nichts zu glauben, fand ich, bloß zu warten, bis wir einen Jeep bekommen, um über die Grenze zu fahren und zu sehen.
Herbert schrie mich an:
„Ein Jeep! – woher?“
Kurz darauf schnarchte er.
Sonst herrschte, sobald der Dieselmotor abgestellt war, meistens Stille; ein Pferd graste im Mondschein, im gleichen Gehege ein Reh, aber lautlos, ferner eine schwarze Sau, ein Truthahn, der das Wetterleuchten nicht vertrug und kreischte, ferner Gänse, die plötzlich, vom Truthahn aufgeregt, ebenfalls schnatterten, plötzlich ein Alarm, dann wieder Stille, Wetterleuchten über dem plat-ten Land, nur das grasende Pferd hörte man die ganze Nacht.
Ich dachte an Joachim —
Aber was eigentlich?
Ich war einfach wach.
Nur unser Ruinen-Freund schwatzte viel, und wenn man zuhörte, sogar ganz interessant; von Tolteken10, Zapoteken11, Azteken12, die zwar Tempel erbaut, aber das Rad nicht gekannt haben. Er kam aus Boston und war Musiker. Manchmal ging er mir auf die Nerven wie alle Künstler, die sich für höhere oder tiefere Wesen halten, bloß weil sie nicht wissen, was Elektrizität ist.
Schließlich schlief ich auch.
Am Morgen, jedesmal, weckte mich ein sonderbarer Lärm, halb Industrie, halb Musik, ein Geräusch, das ich mir nicht erklären konnte, nicht laut, aber rasend wie Grillen, metallisch, monoton, es musste eine Mechanik sein, aber ich erriet sie nicht, und später, wenn wir zum Frühstück ins Dorf gingen, war es verstummt, nichts zu sehen. Wir waren die einzigen Gäste in der einzigen Pinte, wo wir immer das gleiche bestellten: Huevos à la mexicana, sauscharf, aber vermutlich gesund, dazu Tortilla, dazu Bier. Die indianische Wirtin, eine Matrone mit schwarzen Zöpfen, hielt uns für Forscher. Ihre Haare erinnern an Gefieder: schwarz mit einem bläulich-grünen Glanz darin; dazu ihre Elfenbein-Zähne, wenn sie einmal lächeln, ihre ebenfalls schwarzen und weichen Augen.
„Frag sie doch“, sagte Herbert, „ob sie meinen Bruder kennt und wann sie ihn zuletzt gesehen hat.“
Viel war nicht zu erfahren.
„Sie erinnert sich an ein Auto“, sagte ich, „das ist alles —“ Auch der Papagei wusste nichts.
Gracias, hihi!
Ich redete spanisch mit ihm.
Hihi, gracias, hihi!
Am zweiten oder dritten Morgen, als wir wie üblich frühstückten, begaft von lauter Maya-Kindern, die übrigens nicht betteln, sondern einfach vor unserem Tisch stehen und von Zeit zu Zeit lachen, war Herbert von der fixen Idee besessen, es müsste irgendwo in diesem Hühnerdorf, wenn man es gründlich untersuchte, irgendeinen Jeep geben – irgendwo hinter einer Hütte, irgend-wo im Dickicht von Kürbis und Bananen und Mais. Ich ließ ihn. Es war Blödsinn, schien mir, wie alles, aber es war mir einerlei, ich hing in meiner Hängematte, und Herbert zeigte sich den ganzen Tag nicht.
Sogar zum Filmen war ich zu faul.
Außer Bier, Yucateca, das ausgezeichnet war, aber ausgegangen, gab es in Palenque nur noch Rum, miserabel, und Coca-Cola, was ich nicht ausstehen kann —
Ich trank Rum und schlief.
Jedenfalls dachte ich stundenlang an nichts – Herbert, der erst in der Dämmerung zurückkam, bleich vor Erschöpfung, hatte einen Bach entdeckt und gebadet, ferner zwei Männer entdeckt, die mit krummen Säbeln (so behauptete er) durch den Mais gingen, Indios mit weißen Hosen und weißen Strohhüten, genau wie die Männer im Dorf – aber mit krummen Säbeln in der Hand.
Von Jeep natürlich kein Wort!
Er hatte Angst, glaube ich.
Ich rasierte mich, solange es noch elektrischen Strom gab. Herbert erzählte wieder von seinem Kaukasus, seine Schauergeschichten vom Iwan, die ich kenne; später gingen wir, da es kein Bier mehr gab, ins Kino, geführt von unserem Ruinen-Freund, der sein Palenque kannte – es gab tatsächlich ein Kino, Schopf mit Wellblechdach, wir sahen als Vorfilm: Harald Lloyd, Fassadenkletterei in der Mode der Zwanzigerjahre; als Hauptfilm: Liebesleidenschaft in den besten Kreisen von Mexico, Ehebruch mit Cadillac und Browning, alles in Marmor und Abendkleid. Wir lachten uns krumm, während die vier oder fünf Indios reglos vor der zerknitterten Leinwand hockten, ihre großen Strohhüte auf dem Kopf, vielleicht zufrieden, vielleicht auch nicht, man weiß es nie, undurchsichtig, mongolisch… Unser neuer Freund, Musiker aus Boston, wie gesagt, Amerikaner französischer Herkunft, war von Yucatan begeistert und konnte nicht fassen, dass wir uns nicht für Ruinen interessieren; er fragte, was wir hier machten.
Achselzucken unsrerseits —
Wir blickten uns an, Herbert und ich, indem es jeder dem andern überließ, zu sagen, dass wir auf einen Jeep warten. Ich weiß nicht, wofür der andere uns hielt.
Rum hat den Vorteil, dass man nicht einen Schweißausbruch hat wie nach jedem Bier, dafür Kopfschmerzen am anderen Morgen, wenn wieder der unverständliche Lärm losgeht, halb Klavier, halb Maschinengewehr, dazu Gesang – jedesmal zwischen 6.00 und 7.00 Uhr, jedesmal will ich der Sache nachgehen, vergesse es aber im Lauf des Tages.
Man vergisst hier alles.
Einmal – wir wollten baden, aber Herbert fand seinen sagenhaften Bach nicht wieder, und wir gerieten plötzlich zu den Ruinen – trafen wir unseren Künstler an seiner Arbeit. In dem Gestein, das einen Tempel vorstellen soll, glühte eine Höllenhitze. Seine einzige Sorge: kein Schweisstropfen auf sein Papier! Er grüßte kaum; wir störten ihn. Seine Arbeit: er spannte Pauspapier über die steinernen Reliefs, um dann stundenlang mit einer schwarzen Kreide darüber hinzustreichen, eine irrsinnige Arbeit, bloß um Kopien herzustellen; er behauptete steif und fest, man könne diese Hieroglyphen und Götterfratzen nicht fotografieren, sonst wären sie sofort tot. Wir ließen ihn.
Ich bin kein Kunsthistoriker —
Nach einiger Pyramidenkletterei aus purer Langeweile (die Stufen sind viel zu steil, gerade das verkehrte Verhältnis von Breite und Höhe, so dass man außer Atem kommt) legte ich mich, schwindlig vor Hitze, irgendwo in den Schatten eines sogenannten Palastes, meine Arme und Beine von mir gestreckt, atmend.
Die feuchte Luft —
Die schleimige Sonne —
Ich war entschlossen, meinerseits umzukehren: wenn wir bis morgen keinen Jeep hätten… Es war schwüler als je, moosig und moderig, es schwirrte von Vögeln mit langen blauen Schwänzen, jemand hatte den Tempel als Toilette benutzt, daher die Fliegen. Ich versuchte zu schlafen. Es schwirrte und lärmte wie im Zoo, wenn man nicht weiß, was da eigentlich pfeift und kreischt und trillert, Lärm wie moderne Musik, es können Affen sein, Vögel, vielleicht eine Katzenart, man weiß es nicht, Brunst oder Todesangst, man weiß es nicht. —
Ich spürte meinen Magen. (Ich rauchte zuviel!)
Einmal, im elften oder dreizehnten Jahrhundert, soll hier eine ganze Stadt gestanden haben, sagte Herbert, eine Maya-Stadt —
Meinetwegen!
Meine Frage, ob er eigentlich noch an die Zukunft der deutschen Zigarre glaube, beantwortete Herbert schon nicht mehr: er schnarchte, nachdem er eben noch von der Religion der Maya geredet hatte, von Kunst und Derartigem.
Ich ließ ihn schnarchen.
Ich zog meine Schuhe aus, Schlangen hin oder her, ich brauchte Luft, ich hatte Herzklopfen vor Hitze, ich staunte über unseren Pauspapier-Künstler, der an der prallen Sonne arbeiten konnte und dafür seine Ferien hergibt, seine Ersparnisse, um Hieroglyphen, die niemand entziffern kann, nach Hause zu bringen —
Menschen sind komisch!
Ein Volk wie diese Maya, die das Rad nicht kennen und Pyramiden bauen, Tempel im Urwald, wo alles vermoost und in Feuchtigkeit zerbröckelt – wozu?
Ich verstand mich selbst nicht.
Vor einer Woche hätte ich in Caracas und heute (spätestens) wieder in New York landen sollen; statt dessen hockte man hier – um einem Jugendfreund, der meine Jugendfreundin geheiratet hat, Gutentag zu sagen.
Wozu!
Wir warteten auf den Landrover, der unseren Ruinen-Künstler täglich hierher bringt, um ihn gegen Abend wieder abzuholen mit seinen Pauspapierrollen… Ich war entschlossen, Herbert zu wecken und ihm zu sagen, dass ich mit dem nächsten Zug, der dieses Palenque verlässt, meine Rückkehr antrete.
Die schwirrenden Vögel —
Nie ein Flugzeug!
Wenn man den Kopf zur Seite dreht, um nicht immer diesen Milchglashimmel zu sehen, meint man jedesmal, man sei am Meer, unsere Pyramide eine Insel oder ein Schiff, ringsum das Meer; dabei ist es nichts als Dickicht, uferlos, grün-grau, platt wie ein Ozean – Dickicht!
Drüber Vollmond lila im Nachmittag.
Herbert schnarchte nach wie vor.
Man staunt, wie sie diese Quader herbeigeschaft haben, wenn sie das Rad nicht kannten, also auch den Flaschenzug nicht. Auch das Gewölbe nicht! Abgesehen von den Verzierungen, die mir sowieso nicht gefallen, weil ich für Sachlichkeit bin, finde ich ja diese Ruinen sehr primitiv – im Widerspruch zu unserem Ruinen-Freund, der die Maya liebt, gerade weil sie keinerlei Technik hatten, dafür Götter, er findet es hinreißend, dass man alle zweiundfünfzig Jahre einfach ein neues Zeitalter startet, nämlich alles vorhandene Geschirr zerschmettert, alle Herdfeuer löscht, dann vom Tempel her das gleiche Feuer wieder ins ganze Land hinausträgt, die ganze Töpferei neuerdings herstellt; ein Volk, das einfach aufbricht und seine Städte (unzerstört) verlässt, einfach aus Religion weiterzieht, um nach fünfzig oder hundert Meilen irgendwo in diesem immergleichen Dschungel eine vollkommen neue Tempel-Stadt zu bauen – Er findet es sinnvoll, obschon unwirtschaftlich, geradezu genial, tiefsinnig (profund), und zwar im Ernst.
Manchmal musste ich an Hanna denken —
Als ich Herbert weckte, schoß er auf. Was los sei? Als er sah, dass nichts los war, schnarchte er weiter – um sich nicht zu langweilen.
Von Motor kein Ton!
Ich versuche, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn es plötzlich keine Motoren mehr gäbe wie zur Zeit der Maya. Irgend etwas musste man ja denken. Ich fand es ein kindisches Staunen, betreffend die Herbeischaffung dieser Quader: – sie haben einfach Rampen erstellt, dann ihre Quader geschleift mit einem idiotischen Verschleiß an Menschenkraft, das ist ja gerade das primitive daran. Anderseits ihre Astronomie! Ihr Kalender errechnete das Sonnenjahr, laut Ruinen-Freund, auf 365, 2420 Tage, statt 365, 2422 Tage; trotzdem brachten sie es mit ihrer Mathematik, die man anerkennen muss, zu keiner Technik und waren daher dem Untergang geweiht —
Endlich unser Landrover!
Das Wunder geschah, als unser Ruinen-Freund hörte, dass wir hinüber nach Guatemala müssten. Er war begeistert. Er zog sofort sein Kalenderchen, um die restlichen Tage seiner Ferien zu zählen. In Guatemala, sagte er, wimmle es von Maya-Stätten, teilweise kaum ausgegraben, und wenn wir ihn mitnähmen, wollte er alles versuchen, um den Landrover zu bekommen, den wir nicht bekommen, dank seiner Freundschaft mit dem Lacroix-Wirt – und er bekam ihn.
(Hundert Pesos pro Tag.)
Es war Sonntag, als wir packten, eine heiße Nacht mit schleimigem Mond, und der sonderbare Lärm, der mich jeden Morgen geweckt hatte, erwies sich als Musik, Geklimper einer altertümlichen Marimba, Gehämmer ohne Klang, eine fürchterliche Musik, geradezu epileptisch. Es war irgendein Fest, das mit dem Vollmond zu tun hat. Jeden Morgen vor der Feldarbeit hatten sie trainiert, um jetzt zum Tanz aufzuspielen, fünf Indios, die mit rasenden Hämmerchen auf ihr Instrument schlugen, eine Art hölzernes Xylophon, lang wie ein Tisch. Ich überholte den Motor, um uns eine Panne im Dschungel zu ersparen, und hatte keine Zeit, die Tanzerei anzuschauen; ich lag unter unserem Landrover. Die Mädchen saßen reihenweise um den Platz, die meisten mit einem Säugling an der braunen Brust, die Tänzer schwitzten und tranken Kokos-Milch. Im Lauf der Nacht kamen immer mehr, schien es, ganze Völkerstämme; die Mädchen trugen keine Trachten wie sonst, sondern amerikanische Konfektion zur Feier ihres Mondes, ein Umstand, worüber Marcel, unser Künstler, sich stundenlang aufregte. Ich hatte an-dere Sorgen! Wir besaßen keine Waffe, keinen Kompass, nichts. Ich mache mir nichts aus Folklore. Ich packte unseren Landrover, jemand musste es ja machen, und ich machte es gern, um weiterzukommen.
Hanna hatte Deutschland verlassen müssen und studierte damals Kunstgeschichte bei Professor Wölflin, eine Sache, die mir ferne lag, aber sonst verstanden wir uns sofort, ohne an Heiraten zu denken. Auch Hanna dachte nicht an Heiraten. Wir waren beide viel zu jung, wie schon gesagt, ganz abgesehen von meinen Eltern, die Hanna sehr sympathisch fanden, aber um meine Karriere besorgt waren, wenn ich eine Halbjüdin heiraten würde, eine Sorge, die mich ärgerte und geradezu wütend machte. Ich war bereit, Hanna zu heiraten, ich fühlte mich verpflichtet gerade in Anbetracht der Zeit. Ihr Vater, Professor in München, kam damals in Schutzhaft, es war die Zeit der sogenannten Greuelmärchen, und es kam für mich nicht in Frage, Hanna im Stich zu lassen. Ich war kein Feigling, ganz abgesehen davon, dass wir uns wirklich liebten. Ich erinnere mich genau an jene Zeit, Parteitag in Nürnberg, wir saßen vor dem Radio, Verkündung der deutschen Rassengesetze. Im Grunde war es Hanna, die damals nicht hei-raten wollte; ich war bereit dazu. Als ich von Hanna hörte, dass sie die Schweiz binnen vierzehn Tagen zu verlassen habe, war ich in Thun als Ofizier; ich fuhr sofort nach Zürich, um mit Hanna zur Fremdenpolizei zu gehen, wo meine Uniform nichts ändern konnte, immerhin gelangten wir zum Chef der Fremdenpolizei. Ich erinnere mich noch heute, wie er das Schreiben betrachtete, das Hanna vorwies, und sich das Dossier kommen ließ, Hanna saß, ich stand. Dann seine wohlmeinende Frage, ob das Fräulein meine Braut sei, und unsere Verlegenheit. Wir sollten verstehen: die Schweiz sei ein kleines Land, kein Platz für zahllose Flüchtlinge, Asylrecht, aber Hanna hätte doch Zeit genug gehabt, ihre Auswanderung zu betreiben. Dann endlich das Dossier, und es stellt sich heraus, dass gar nicht Hanna gemeint war, sondern eine Emigrantin gleichen Namens, die bereits nach Übersee ausgewandert war. Erleichterung allerseits! Im Vorzimmer nahm ich meine Ofiziershandschuhe, meine Ofiziersmütze, als Hanna nochmals an den Schalter gerufen wurde, Hanna kreidebleich. Sie musste noch zehn Rappen zahlen, Porto für den Brief, den man fälschlicherweise an ihre Adresse geschickt hatte. Ihre maßlose Empörung darüber! Ich fand es einen Witz. Leider musste ich am selben Abend wieder nach Thun zu meinen Rekruten; auf jener Fahrt kam ich zum Entschluss, Hanna zu heiraten, falls ihr je die Aufenthaltsbewilligung entzogen werden sollte. Kurz darauf (wenn ich mich richtig erinnere) starb ihr alter Vater in Schutzhaft. Ich war entschlossen, wie gesagt, aber es kam nicht dazu. Ich weiß eigentlich nicht warum. Hanna war immer sehr empfindlich und sprunghaft, ein unberechenbares Temperament; wie Joachim sagte: manischdepressiv. Dabei hatte Joachim sie nur ein oder zwei Mal gesehen, denn Hanna wollte mit Deutschen nichts zu tun haben. Ich schwor ihr, dass Joachim, mein Freund, kein Nazi ist; aber vergeblich. Ich verstand ihr Misstrauen, aber sie machte es mir nicht leicht, abgesehen davon, dass unsere Interessen sich nicht immer deckten. Ich nannte sie eine Schwärmerin und Kunstfee. Dafür nannte sie mich: Homo Faber. Manchmal hatten wir einen regelrechten Krach, wenn wir beispielsweise aus dem Schauspielhaus kamen, wohin sie mich immer wieder nötigte; Hanna hatte einerseits einen Hang zum Kommunistischen, was ich nicht vertrug, und andererseits zum Mystischen, um nicht zu sagen: zum Hysterischen. Ich bin nun einmal der Typ, der mit beiden Füßen auf der Erde steht. Nichtsdestoweniger waren wir sehr glücklich zusammen, scheint mir, und eigentlich weiß ich wirklich nicht, warum es damals nicht zur Heirat kam. Es kam einfach nicht dazu. Ich war, im Gegensatz zu meinem Vater, kein Antisemit, glaube ich; ich war nur zu jung wie die meisten Männer unter dreißig, zu unfertig, um Vater zu sein. Ich arbeitete noch an meiner Dissertation, wie gesagt, und wohnte bei meinen Eltern, was Hanna durchaus nicht begriff. Wir trafen uns immer in ihrer Bude. In jener Zeit kam das Angebot von Escher-Wyss, eine Chance sondergleichen für einen jungen Ingenieur, und was mir dabei Sorge machte, war nicht das Klima von Bagdad, sondern Hanna in Zürich. Sie erwartete damals ein Kind. Ihre Offenbarung hörte ich ausgerechnet an dem Tag, als ich von meiner ersten Besprechung mit Escher-Wyss kam, meinerseits entschlossen, die Stelle in Bagdad anzutreten sobald als möglich. Ihre Behauptung, ich sei zu Tode erschrocken, bestreite ich noch heute; ich fragte bloß: Bist du sicher? Immerhin eine sachliche und vernünftige Frage. Ich fühlte mich übertölpelt nur durch die Bestimmtheit ihrer Meldung; ich fragte: Bist du bei einem Arzt gewesen? Ebenfalls eine sachliche und erlaubte Frage. Sie war nicht beim Arzt gewesen. Sie wisse es! Ich sagte: Warten wir noch vierzehn Tage. Sie lachte, weil vollkommen sicher, und ich musste annehmen, dass Hanna es schon lange gewusst, aber nicht gesagt hatte; nur insofern fühlte ich mich übertölpelt. Ich legte meine Hand auf ihre Hand, im Augenblick fiel mir nicht viel dazu ein, das ist wahr; ich trank Kaffee und rauchte. Ihre Enttäuschung! Ich tanzte nicht vor Vaterfreude, das ist wahr, dazu war die politische Situation zu ernst. Ich fragte: Hast du denn einen Arzt, wo du hingehen kannst? Natürlich meinte ich bloß: um sich einmal untersuchen zu lassen. Hanna nickte. Das sei keine Sache, sagte sie, das lasse sich schon machen! Ich fragte: Was meinst du? Später behauptete Hanna, ich sei erleichtert gewesen, dass sie das Kind nicht haben wollte, und geradezu entzückt, drum hätte ich meinen Arm um ihre Schultern gelegt, als sie weinte. Sie selber war es, die nicht mehr davon sprechen wollte, und dann berichtete ich von Escher-Wyss, von der Stelle in Bagdad, von den beruflichen Möglichkeiten eines Ingenieurs überhaupt. Das war keineswegs gegen ihr Kind gerichtet. Ich sagte sogar, wieviel ich in Bagdad verdienen würde.
Und wörtlich: Wenn du dein Kind haben willst, dann müssen wir natürlich heiraten. Später ihr Vorwurf, dass ich von Müssen gesprochen habe! Ich fragte offen heraus: Willst du heiraten, ja oder nein? Sie schüttelte den Kopf, und ich wusste nicht, woran ich bin. Ich besprach mich viel mit Joachim, während wir unser Schach spielten; Joachim unterrichtete mich über das Medizinische, was bekanntlich kein Problem ist, dann über das Juristische, bekanntlich auch kein Problem, wenn man sich die erforderlichen Gutachten zu verschaffen weiß, und dann stopfte er seine Pfeife, Blick auf unser Schach, denn Joachim war grundsätzlich gegen Ratschläge. Seine Hilfe (er war Mediziner im Staatsexamen) hatte er zugesagt, falls wir, das Mädchen und ich, seine Hilfe verlangen. Ich war ihm sehr dankbar, etwas verlegen, aber froh, dass er keine große Geschichte draus machte; er sagte bloß: Du bist am Zug! Ich meldete Hanna, dass alles kein Problem ist. Es war Hanna, die plötzlich Schluss machen wollte; sie packte ihre Koffer, plötzlich ihre wahnsinnige Idee, nach München zurückzukehren. Ich stellte mich vor sie, um sie zur Vernunft zu bringen; ihr einziges Wort: Schluss! Ich hatte gesagt: Dein Kind, statt zu sagen: Unser Kind. Das war es, was mir Hanna nicht verzeihen konnte.
Die Strecke zwischen Palenque und der Plantage, in der Luftlinie gemessen, beträgt kaum siebzig Meilen, sagen wir: hundert Meilen zum Fahren, eine Bagatelle, hätte es so etwas wie eine Straße gegeben, was natürlich nicht der Fall war; die einzige Straße, die in unsrer Richtung führte, endete bereits bei den Ruinen, sie verliert sich einfach in Moos und Farnkraut —
Immerhin kamen wir voran.
37 Meilen am ersten Tag.
Wir wechselten am Steuer.
19 Meilen am zweiten Tag.
Wir fuhren einfach nach Himmelsrichtung, dabei natürlich im Zickzack, wo es uns durchließ, das Dickicht, das übrigens nicht so lückenlos ist, wie es aus der Ferne aussieht; überall gab es wieder Lichtungen, sogar Herden, aber ohne Hirten, zum Glück keine größeren Sümpfe.
Wetterleuchten —
Zum Regnen kam es nie.
Was mich nervös machte: das Scheppern unsrer Kanister, ich stoppte öfter und befestigte sie, aber nach einer halben Stunde unserer Fahrt über Wurzeln und faule Stämme schepperten sie wieder —
Marcel pfiff.
Obschon er hinten saß, wo es ihn hin und her schleuderte, pfiff er wie ein Bub und freute sich wie auf einer Schulreise, stundenlang sang er seine französischen Kinderlieder:
II était un petit navire…
Herbert wurde eher still.
Über Joachim redeten wir kaum —
Was Herbert nicht ertrug, waren die Zopilote; dabei tun sie uns, solange wir leben, überhaupt nichts, sie stinken nur, wie von Aasgeiern nicht anders zu erwarten, sie sind hässlich, und man trift sie stets in Scharen, sie lassen sich kaum verscheuchen, wenn einmal an der Arbeit, alles Hupen ist vergeblich, sie flattern bloß, hüpfen um das aufgerissene Aas, ohne es aufzugeben… Einmal, als Herbert am Steuer saß, packte ihn ein regelrechter Koller; plötzlich gab er Vollgas – los und hinein in die schwarze Meute, mitten hinein und hindurch, so dass es von schwarzen Federn nur so wirbelte!
Nachher hatte man es an den Rädern.
Der süßliche Gestank begleitete uns noch stundenlang, bis man sich überwand; das Zeug klebte in den Pneu-Rillen, und es half nichts als peinliche Handarbeit, Rille um Rille. – Zum Glück hatten wir Rum! – Ohne Rum, glaube ich, wären wir umgekehrt – spätestens am dritten Tag – nicht aus Angst, aber aus Vernunft.
Wir hatten keine Ahnung, wo wir sind.
Irgendwo am 18. Breitengrad…
Marcel sang, il était un petit navire, oder er schwatzte wieder die halbe Nacht lang: – von Cortez und Montezuma13 (das ging noch, weil historische Tatsache) und vom Untergang der weißen Rasse (es war einfach zu heiß und zu feucht, um zu widersprechen), vom katastrophalen Scheinsieg des abendländischen Technikers (Cortez als Techniker, weil er Schießpulver hatte!) über die indianische Seele und was weiß ich, ganze Vorträge über die unweigerliche Wiederkehr der alten Götter (nach Abwurf der H-Bombe!) und über das Aussterben des Todes (wörtlich!) dank Penicillin, über Rückzug der Seele aus sämtlichen zivilisierten Gebieten der Erde, die Seele im Maquis usw., Herbert erwachte an dem Wort Maquis, das er verstand, und fragte: Was sagt er? Ich sagte: Künstlerquatsch! und wir ließen ihm seine Theorie über Amerika, das keine Zukunft habe, The American Way of Life: Ein Versuch, das Leben zu kosmetisieren, aber das Leben lasse sich nicht kosmetisieren —
Ich versuchte zu schlafen.
Ich platzte nur, wenn Marcel sich über meine Tätigkeit äußerte, beziehungsweise über die Unesco: der Techniker als letzte Ausgabe des weißen Missionars, Industrialisierung als letztes Evangelium einer sterbenden Rasse, Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn —
Ich fragte ihn, ob er Kommunist sei.
Marcel bestritt es.
Am dritten Tag, als wir wieder durch Gebüsche fuhren, ohne eine Fährte zu haben, einfach Richtung Guatemala, hatte ich es satt —
Ich war für Umkehren.
„Weil es idiotisch ist“, sagte ich, „einfach aufs Geratewohl weiterzufahren, bis wir kein Gasoline mehr haben.“
Herbert holte seine Karte —
Was mir auf die Nerven ging: die Molche in jedem Tümpel, in jeder Eintagspfütze ein Gewimmel von Molchen – überhaupt diese Fortpflanzerei überall, es stinkt nach Fruchtbarkeit, nach blühender Verwesung.
Wo man hinspuckt, keimt es!
Ich kannte sie, diese Karte 1: 500 000, die nicht einmal unter der Lupe etwas hergibt, nichts als weißes Papier: ein blaues Flüßchen, eine Landesgrenze schnurgerade, die Linie eines Breitengrades im leeren Weiß!… Ich war für Umkehren. Ich hatte keine Angst (wovor denn!), aber es hat-te keinen Sinn. Nur Herbert zuliebe fuhr man noch weiter, unglücklicherweise, denn kurz darauf kamen wir tatsächlich an einen Fluss, beziehungsweise ein Flussbett, das nichts anderes sein konnte als der Rio Usumacinta, Grenze zwischen Mexico und Guatemala, teilweise trocken, teilweise voll Wasser, das kaum zu fließen schien, nicht ohne weiteres zu überqueren, aber es musste Stellen geben, wo es auch ohne Brücke möglich ist, und Herbert ließ keine Ruhe, obschon ich baden wollte, er steuerte am Ufer entlang, bis die Stelle gefunden war, wo man überqueren konnte und wo auch Joachim (wie sich später herausstellte) überquert hatte.
Ich badete.
Marcel badete ebenfalls, und wir lagen rücklings im Wasser, Mund geschlossen, um nichts zu schlucken, es war ein trübes und warmes Wasser, das stank, jede Bewegung hinterlässt Bläschen, immerhin Wasser, lästig nur die zahllosen Libellen und Herbert, der weiter drängte, und der Gedanke, es könnte Schlangen geben.
Herbert blieb an Land.
Unser Landrover stand bis zur Achse in dem schlüpfrigen Mergel (oder was es ist), Herbert tankte —
Es wimmelte von Schmetterlingen.
Als ich einen rostigen Kanister im Wasser sah, was darauf schließen ließ, dass auch Joachim (wer sonst?) an dieser Stelle einmal getankt hatte, sagte ich kein Wort, sondern badete weiter, während Herbert versuchte, unseren Landrover aus dem schlüpfrigen Mergel zu steuern…
Ich war für Umkehren.
Ich blieb im Wasser, obschon es mich plötzlich ekelte, das Ungeziefer, die Bläschen auf dem braunen Wasser, das faule Blinken der Sonne, ein Himmel voll Gemüse, wenn man rücklings im Wasser lag und hinaufblickte, Wedel mit meterlangen Blättern, reglos, dazwischen Akazien-Filigran, Flechten, Luftwurzeln, reglos, ab und zu ein roter Vogel, der über den Fluss flog, sonst Totenstille (wenn Herbert nicht gerade Vollgas-Versuche machte —) unter einem weißlichen Himmel, die Sonne wie in Watte, klebrig und heiß, dunstig mit einem Regenbogenring.
Ich war für Umkehren.
„Weil es Unsinn ist“, sagte ich, „weil wir diese verfluchte Plantage nie finden werden —“
Ich war für Abstimmen.
Marcel war auch für Umkehren, da er seine Ferien zu Ende gehen sah, und es handelte sich, als Herbert es tatsächlich geschaft hatte und un-ser Landrover am anderen Ufer stand, nur noch darum, Herbert zu überzeugen von dem Unsinn, ohne jede Fährte weiterzufahren. Zuerst beschimpfte er mich, weil er meine Gründe nicht widerlegen konnte, dann schwieg er und hörte zu, und eigentlich hatte ich ihn soweit – wäre nicht Marcel gewesen, der dazwischenfunkte.
„Voilà“, rief er, „les traces d’une Nash!“
Wir nahmen’s für einen Witz.
„Mais regardez“, rief er, „sans blague —“
Die verkrusteten Spuren waren teilweise verschwemmt, so dass es auch Karrenspuren sein konnten; an andern Stellen, je nach Bodenart, erkannte man tatsächlich das Pneu-Muster.
Damit hatten wir die Fährte.
Sonst wäre ich nicht gefahren, wie gesagt, und es wäre (ich werde diesen Gedanken nicht los) alles anders gekommen —
Nun gab es kein Umkehren.
(Leider!)
Am Morgen des vierten Tages sahen wir zwei Indios, die übers Feld gingen mit gekrümmten Säbeln in der Hand, genau wie die beiden, die Herbert schon in Palenque gesehen und für Mörder gehalten hatte; ihre krummen Säbel waren nichts anderes als Sicheln.
Dann die ersten Tabakfelder —
Die Hoffnung, noch vor Einbruch der Nacht hinzukommen, machte uns nervöser als je, dazu die Hitze wie noch nie, ringsum Tabak, Gräben dazwischen, Menschenwerk, schnurgerade, aber nirgends ein Mensch.
Wir hatten wieder die Spur verloren —
Wieder die Suche nach Pneu-Muster!
Bald ging die Sonne unter; wir stellten uns auf unseren Landrover und pfiffen, die Finger im Mund, so laut wir konnten. Wir mussten in nächster Nähe sein. Wir pfiffen und hupten, während die Sonne bereits in den grünen Tabak sank – wie gedunsen, im Dunst wie eine Blase voll Blut, widerlich, wie eine Niere oder so etwas.
Ebenso der Mond.
Es fehlte nur noch, dass wir einander in der Dämmerung verloren, indem jeder, um Pneu-Spuren zu finden, irgendwohin stapfte. Wir verteilten uns auf Bezirke, die jeder abzuschreiten hatte. Wer etwas findet, was irgendwie nach Pneu aussieht, sollte pfeifen.
Nur die Vögel pfiffen —
Wir suchten noch bei Mondschein, bis Herbert auf die Zopilote stieß, Zopilote auf einem toten Esel – er schrie und fluchte und schleuderte Steine gegen die schwarzen Vögel, nicht abzuhalten in seiner Wut. Es war scheußlich. Die Augen des Esels waren ausgehackt, zwei rote Löcher, ebenso die Zunge; nun versuchten sie, während Herbert noch immer seine Steine schleuderte, die Därme aus dem After zu zerren.
Das war unsere vierte Nacht —
Zu trinken hatten wir nichts mehr.
Ich war todmüde, die Erde wie geheizt, ich hockte, meinen Kopf in die Hände gestützt, schwitzend im bläulichen Mondschein. Es sprühte von Leuchtkäfern.
Herbert ging auf und ab.
Nur Marcel schlief.
Einmal – ich hörte plötzlich keine Schritte mehr und blickte nach Herbert – stand er drüben beim toten Esel, ohne Steine zu werfen gegen die huschenden Vögel, er stand und sah es sich an.
Sie fraßen die ganze Nacht —
Als der Mond endlich in den Tabak sank, so dass der feuchte Dunst über den Feldern aufhörte, wie Milch zu erscheinen, schlief ich doch; aber nicht lange.
Schon wieder die Sonne!
Der Esel lag offen, die Zopilote waren satt und hockten auf den Bäumen ringsum, wie ausgestopft, als wir losfuhren ohne Weg; Herbert als Vertreter und Neffe der Hencke-Bosch GmbH., dem diese Felder gehörten, übernahm die Verant-wortung und das Steuer, nach wie vor wortlos, und fuhr mitten durch den Tabak, es war idiotisch, hinter uns die Bahnen von zerstörtem Tabak, aber es blieb uns nichts anderes übrig, da auf unser Hupen und Pfeifen, oft genug wiederholt, keinerlei Antwort erfolgte —
Die Sonne stieg.
Dann eine Gruppe von Indios, Angestellte der Hencke-Bosch GmbH, Düsseldorf, die uns sagten, ihr Senor sei tot. Ich musste übersetzen, da Herbert kein Spanisch verstand. Wieso tot? Sie zuckten ihre Achseln. Ihr Señor sei tot, sagten sie, und einer zeigte uns den Weg, indem er neben unserem Landrover herlief im indianischen Trabschritt.
Die andern arbeiteten weiter. Von Revolte also keine Rede!
Es war eine amerikanische Baracke, gedeckt mit Wellblech, und die einzige Türe war von innen verriegelt. Man hörte Radio. Wir riefen und klopften, Joachim sollte aufmachen.
„Nuestro Señor ha muerto —“
Ich holte den Schraubenschlüssel von unserem Landrover, und Herbert sprengte die Türe. Ich erkannte ihn nicht mehr. Zum Glück hatte er’s hinter geschlossenen Fenstern getan, Zopilote auf den Bäumen ringsum, Zopilote auf dem Dach, aber sie konnten nicht durch die Fenster. Man sah ihn durch die Fenster. Trotzdem gingen diese Indios täglich an ihre Arbeit und kamen nicht auf die Idee, die Türe zu sprengen und den Erhängten abzunehmen. – Er hatte es mit einem Draht gemacht. – Es wunderte mich, woher sein Radio, das wir sofort abstellten, den elektrischen Strom bezieht, aber das war jetzt nicht das Wichtigste —
Wir fotografierten und bestatteten ihn.
Die Indios (wie in meinem Bericht zuhanden des Verwaltungsrates bereits erwähnt) befolgten jede Anweisung von Herbert, obschon er damals noch kein Spanisch konnte, und anerkannten Herbert sofort als ihren nächsten Herrn… Ich opferte noch anderthalb Tage, um Herbert zu überzeugen, dass von Revolte nicht die Rede sein konnte, und dass sein Bruder einfach dieses Klima nicht ausgehalten hat, was ich verstand; ich weiß nicht, was Herbert sich in den Kopf setzte, er war nicht zu überreden, seinerseits entschlossen, das Klima auszuhalten. Wir mussten zurück. Herbert tat uns leid, aber ein Bleiben kam nicht in Frage, ganz abgesehen davon, dass es keinen Zweck hatte; Marcel musste auch in Boston an seine Arbeit, auch ich musste weiter, beziehungsweise zurück nach Palenque-Campeche-Mexico, um dann weiterzufliegen, ganz abgesehen davon, dass wir uns verpflichtet hatten, unseren Landrover spätestens in einer Woche dem freundlichen Lacroix-Wirt zurückzubringen. Ich musste zu meinen Turbinen. Ich weiß nicht, was Herbert sich vorstellte, Herbert konnte nicht einmal Spanisch, wie gesagt, und ich fand es unkameradschaftlich, geradezu unverantwortlich, ihn zurückzulassen als einzigen Weißen; wir beschworen ihn, aber vergeblich. Herbert hatte den Nash 55, den ich besichtigte; der Wagen stand in einer Indio-Hütte, nur mit einem Blätterdach gegen Regen geschützt, offensichtlich schon lange nicht mehr benutzt, verkratzt, verdreckt, aber fahrtüchtig. Ich untersuchte ihn persönlich. Damals war der Motor noch in Ordnung, wenn auch verschlammt; ich hatte den Motor probiert, und Gasoline war auch noch da. Sonst hätten wir Herbert, versteht sich, nicht allein zurückgelassen. Wir hatten einfach keine Zeit, Marcel so wenig wie ich; Marcel musste zu seinen Symphonikern, wir hatten schließlich auch unsere Berufe, ob Herbert es begriff oder nicht – er zuckte die Achsel, ohne zu widersprechen, und winkte kaum, als wir auf dem Landrover saßen, Marcel und ich, und nochmals auf ihn warteten; er schüttelte den Kopf. Obendrein sah es nach schweren Gewittern aus, wir mussten fahren, solange wir die eigene Spur noch hatten.
Es ist mir heute noch ein Rätsel, wieso Hanna und Joachim geheiratet und wieso sie mich, Vater des Kindes, nie haben wissen lassen, dass dieses Kind zur Welt gekommen ist.
Ich kann nur berichten, was ich weiß.
Es war die Zeit, als die jüdischen Pässe annulliert wurden. Ich hatte mir geschworen, Hanna keinesfalls im Stich zu lassen, und dabei blieb es. Joachim war bereit, Trauzeuge zu sein. Meinen bürgerlichen und besorgten Eltern war es auch recht, dass wir nicht eine Hochzeit mit Droschken und Klimbim wollten; nur Hanna machte sich immer noch Zweifel, ob es denn richtig wäre, dass wir heirateten, richtig für mich. Ich brachte unsere Papiere aufs zuständige Amt, unsere Eheverkündigung stand in der Zeitung. Auch im Fall einer Scheidung, so sagte ich mir, blieb Hanna jedenfalls Schweizerin und im Besitz eines Passes. Die Sache eilte, da ich meine Stelle in Bagdad anzutreten hatte. Es war ein Samstagvormittag, als wir endlich – nach einem komischen Frühstück bei meinen Eltern, die dann das Kirchengeläute doch vermissten! – endlich ins Stadthaus gingen, um die Trauung zu vollziehen. Es wimmelte von Hochzeiten wie üblich an Samstagen, daher die lange Warterei, wir saßen im Vorzimmer, alle im Straßenanzug, umgeben von weißen Bräuten und Bräutigams, die wie Kellner aussahen. Als Hanna gelegentlich hinausging, dachte ich nichts Schlimmes, man redete, man rauchte. Als endlich der Standesbeamte uns rief, war Hanna nicht da.
Wir suchten sie und fanden sie draußen an der Limmat, nicht zu bewegen, sie weigerte sich in das Trauzimmer zu kommen. Sie könne nicht! Ich redete ihr zu, ringsum das Elfuhrgeläute, ich bat Hanna, die Sache ganz sachlich zu nehmen; aber vergeblich. Sie schüttelte den Kopf und weinte. Ich heirate ja bloß, um zu beweisen, dass ich kein Antisemit sei, sagte sie, und es war einfach nichts zu machen. Die Woche darauf, meine letzte in Zürich, war abscheulich. Es war Hanna, die nicht heiraten wollte, und ich hatte keine Wahl, ich musste nach Bagdad, gemäß Vertrag. Hanna begleitete mich noch an die Bahn, und wir nahmen Abschied. Hanna hatte versprochen, nach meiner Abreise sofort zu Joachim zu gehen, der seine ärztliche Hilfe angeboten hatte, und in diesem Sinn nahmen wir Abschied; es war ausgemacht, dass unser Kind nicht zur Welt kommen sollte.
Später hörte ich nie wieder von ihr.
Das war 1936.
Ich hatte Hanna damals gefragt, wie sie Joachim, meinen Freund, nun finde. Sie fand ihn ganz sym-pathisch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Hanna und Joachim einander heiraten.
1
La Guardia – Flughafen in New York für internationale Flüge
2
eine Super-Constellation – ein Zivilflugzeug
3
Iwan – eine umgangssprachliche Bezeichnung aus dem Landserdeutsch für „Russe“
4
Ernst Mally – ein österreichischer Philosoph
5
Hans Reichenbach – Physiker, Philosoph und Logiker
6
Alfred North Whitehead – britischer Philosoph und Logiker, der vor allem durch seine Arbeit mit Bertrand Russell an der Principia Mathematica berühmt wurde
7
Bertrand Arthur William Russell – Mathematiker (im speziellen Logiker) und Philosoph
8
Richard Edler von Mises – ein österreichischer Mathematiker
9
Hermes-Baby – tragbare Kofferschreibmaschine
10
Tolteken – eine mesoamerikanische Kultur, die zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert den größten Teil Zentralmexikos beherrschte
11
Zapoteken – in vorspanischer Zeit eine hochentwickelte Kultur in Südmexiko
12
Azteken – eine mesoamerikanische Kultur in Zentralmexiko mit einer reichhaltigen Mythologie
13
Hernán (Hernando) Cortés – ein spanischer Konquistador und Entdecker. Cortés eroberte mit wenigen hundert Mann Mexiko. Er zerstörte das Aztekenreich und dessen Hauptstadt Tenochtitlan, die größte Stadt der damaligen Zeit, besiegte die letzten Azteken-Herrscher Montezuma II.