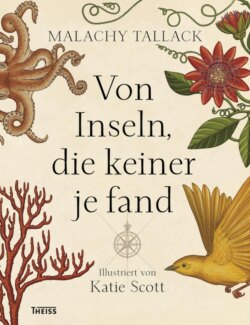Читать книгу Von Inseln, die keiner je fand - Malachy Tallack - Страница 10
Hufaidh
ОглавлениеAM ZUSAMMENFLUSS zweier großer Ströme, Euphrat und Tigris, gab es einst ein Feuchtgebiet, welches Tausende von Quadratkilometern bedeckte, das größte seiner Art in ganz Westeurasien. Die Region – einst Teil von Mesopotamien, jetzt Südirak – war Geburtsstätte der modernen Zivilisation und Heimat des Volks der Ma‘dān, bekannt als Marsch-Araber. Die Ma‘dān sind Abkömmlinge der babylonischen, sumerischen und beduinischen Kultur und 5.000 Jahre lang veränderte sich ihre Lebensweise kaum. Die Art, wie sie lebten, war immer von dem Ort, an dem sie lebten, bestimmt.
Dieser Ort war gekennzeichnet von seichten Lagunen, hoch aufgeschossenem Schilf und flachen Überschwemmungsgebieten. Es war eine eigenartige Welt, wo Büffel durch das Schilf wateten und Pelikane über den Köpfen hinwegzogen; unter Wasser schwammen tödliche Schlangen. Wenig Außenstehende lernten diese Gegend jemals kennen und bis Mitte des 20. Jhs. blieb sie mysteriös, halbmythisch. Der Schriftsteller und Naturkundler Gavin Maxwell reiste 1956 in die Marschen, von wo er Mijbil mitbrachte, den Fischotter im Mittelpunkt seines berühmtesten Buchs, Im Spiel der hellen Wasser. Jener Otter gehörte einer bis dahin unbekannten Unterart an, die heute seinen Namen trägt: Lutrogale perspicillata maxwelli.
In Ein Rohr, vom Winde bewegt schrieb Maxwell über seine erste Begegnung mit den Marschen. Der Ort war für ihn sowohl abstoßend wie auch wunderschön und mit nichts vergleichbar, was er je gesehen hatte. „In gewisser Weise war es ein furchterregendes Landschaftsbild“, schrieb er, „ohne das geringste menschliche Zeichen und verzweifelter und feindseliger als selbst das Meer.“ Doch zwei Tage später war daraus „ein Wunderland“ geworden:
[D]ie Farben hatten die Leuchtkraft und die Reinheit feinen Emails. Hier, im Schutz der Lagunen, ragte das Schilf – golden im Sonnenschein wie das Stroh von Getreide – hoch aus dem Wasser, das im Windschatten der Inseln so metallisch blau wie Käferflügel … und [andernorts] so grün war wie ein ungeschliffener Smaragd.
Die Menschen der Region lebten mit dem, was ihre Heimat ihnen bot. Die Wasserbüffel wurden nicht verzehrt, aber ihre Milch getrunken und ihr Dung als Brennmittel und Baumaterial verwendet. Die Ma‘dān fischten mit Speeren, hielten Vögel für den Verzehr, und in der wassergetränkten Erde bauten sie Reis an. Das Schilf, das dort im Überfluss wuchs, war lang und stark genug für den Boots- und Hausbau. Die großzügigen Hallen, welche sie errichteten – mudhifs – sahen aus wie das ausgehöhlte Innere eines Wals. Hohe, gewölbte Rippen aus geflochtenem Schilf trugen eine dicke Außenhaut aus Stroh. Alles, was benötigt wurde, kam vom Wasser.
Die Ma‘dān waren Schiiten, und einige von ihnen direkte Abkömmlinge des Propheten. Sie glaubten an übersinnliche Wesen, Dschinns, welche die Gestalt von Schlangen und anderen Kreaturen annahmen. Sie behielten aber auch Elemente des vorislamischen Glaubens bei, darunter Geschichten von einer magischen Insel draußen in den Marschen. Der Entdecker Wilfred Thesiger besuchte die Ma‘dān in den 1950ern mehrmals und lebte jeweils monatelang unter ihnen. Einmal wurde Thesiger gefragt, ob er je von Hufaidh gehört habe. Ja, das habe er, aber er wolle mehr wissen. Sein Gastgeber sagte ihm, wobei er vage auf den südwestlichen Horizont wies: „Hufaidh ist eine Insel irgendwo dort drüben. Dort befinden sich Paläste und Palmbäume und Granatapfelgärten, und die Büffel sind größer als die unseren. Aber niemand weiß genau, wo sie ist.“
„Hat sie niemand gesehen?“, fragte Thesiger. „Doch, aber jeder, der Hufaidh sieht, wird verhext, und niemand mehr kann seine Worte verstehen. Bei Abbas, ich schwöre, es ist wahr. Einer der Fartus hat sie vor Jahren gesehen, als ich noch ein Kind war. Er suchte einen Büffel, und als er zurückkehrte, war seine Rede vollkommen verwirrt, und wir wussten, er hatte Hufaidh gesehen.“
Die Ma‘dān erklärten, jede Suche nach der Insel würde scheitern. Die Dschinns konnten sie nach Belieben verschwinden lassen. Aber Hufaidh sei real. Die Scheichs wussten davon, die Regierung wusste davon, kein Anlass also für Zweifel. Wie viele solche Inseln existierte Hufaidh in einer Zwischenregion zwischen Leben und Tod, war teils Paradies, teils Hölle, von dieser Welt und von einer anderen.
Doch Hufaidh gehört nicht länger zu dieser Welt, denn die Marschen sind heute ein ganz anderer Ort. Ihre Trockenlegung begann etwa in der Zeit von Thesiger und Maxwell und anfangs in moderatem Maßstab, um mehr landwirtschaftliche Flächen verfügbar zu machen. Im Laufe der Jahrzehnte dann lenkten mehr Bewässerungskanäle Wasser ab und die Marschen gingen zurück. Erst in den 1990ern aber wurde der eigentliche Schaden angerichtet, und dies absichtlich.
Saddam Hussein hasste die Ma‘dān. Als Schiiten waren sie den an der Macht befindlichen Sunniten gegenüber feindlich eingestellt und hatten Dissidenten und Rebellen beherbergt. Nach Ende des ersten Golfkriegs rächte sich Saddam daher aufs Grausamste. Er lenkte den Fluss Tigris um und ließ einen neuen Kanal errichten. Der Plan ging auf. Binnen zwei Jahren waren zwei Drittel der Feuchtgebiete ausgetrocknet und bis zum Ende des Jahrzehnts 90 % der Marschen verschwunden: ein Akt ungehemmter Barbarei, eine menschliche und ökologische Tragödie.
Tausende von Meilen, einst Heimat für Fische, Pflanzen, Vögel und Säugetiere, wurden zur Wüste. Ein einzigartiges Ökosystem war verloren. Und die Menschen, die von diesem Ökosystem abhingen – vielmehr Teil von ihm waren –, waren zur Flucht gezwungen. In den 1950ern gab es eine halbe Million Ma‘dān in der Region. Heute sind es vielleicht nur noch 10 % davon, womöglich weniger als 2.000, welche wie vor 5.000 Jahren in den Schilfhütten auf dem Wasser leben.
Nach dem zweiten Golfkrieg wurde Saddams Werk rückgängig gemacht. Die Dämme wurden zerstört und das Wasser konnte wieder in die Marschen zurückströmen, die sich seither langsam ausdehnen. Einige der Arten sind zurückgekehrt, doch manche sind für immer ausgestorben. Die Kultur der Ma‘dān ist vielleicht nicht unwiederbringlich verloren, aber Hufaidh – jene Insel mit Palmen und Granatapfelbäumen – ist nicht mehr da. Sie hat sich in Sand verwandelt und wurde im Wind zerstreut.