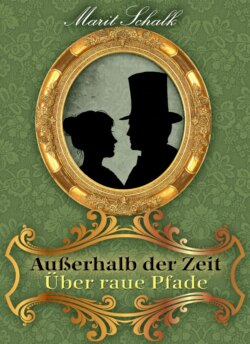Читать книгу Außerhalb der Zeit - Marit Schalk - Страница 12
Kapitel 10
ОглавлениеSonntag, 22. August 1841
Meister Gercke hat das Wunder tatsächlich vollbracht: Noch rechtzeitig vor dem Kirchgang, lässt er mir durch einen Laufburschen das versprochene Sonntagskleid inklusive der dazu passenden Accessoires liefern: Schal, Handschuhe und Hut. Sein Tempo ist wirklich unglaublich. Ich kann es mir nur so erklären, dass er entweder ein ganzes Heer von Gehilfen hat oder aber derzeit keinerlei andere Aufträge bearbeitet und auch die Nächte durchnäht.
Das neue Kleid ist schlicht, aber elegant. Es hat eine beige Grundfarbe, die durch ein feines Blumenmuster in Blassgrün aufgelockert wird. Der lange Rock fällt in mehreren Etagen hinab, deren Ränder jeweils rundum mit Rüschen und dazwischen in regelmäßigen Abständen mit Stoffblumen versehen sind. Böse Zungen könnten behaupten, in so einem Kleid sieht frau wie eine wandelnde Pralinenschachtel aus.
Aber sowohl Ida als auch Meister Gercke haben mir gestern versichert, dass ich damit im brandaktuellsten Pariser Schick gekleidet bin.
Ich habe ihnen meine Unkenntnis in Modefragen mit meinem langen Aufenthalt auf Sansibar erklärt, was die beiden zum Glück fraglos geschluckt haben.
Dank Meister Gerckes Fleiß kann ich das neue Kleid jedenfalls gleich heute Morgen zum Gottesdienst ausführen. Als gottesfürchtige Hamburger Kaufleute besuchen die Sievekings natürlich jede Woche die Nikolaikirche am Hopfenmarkt, wo zu meiner großen Erleichterung sonntags aber keine Äpfel angeboten werden.
Während des Gottesdienstes in der prachtvoll ausgestatteten Kirche, an dem alle Schichten gleichermaßen teilnehmen, gehören wir sichtlich zu den feineren Leuten. Obwohl auch die anderen Bürgersgattinnen ähnlich aufgebrezelt sind wie ich, ernte ich in meinem Sonntagsstaat mehrfach bewundernde oder sogar neidvolle Blicke.
Letzteres könnte allerdings auch daran liegen, dass die beiden Herren in meiner Begleitung ebenfalls optisch einiges hermachen. Sie sind nicht nur beide fraglos attraktive Menschen, sondern auch modisch wieder einmal sehr elegant gekleidet.
Beide Brüder tragen helle Hosen zu braunen Gehröcken. Die Halstücher, in rostbraun bei Eduard und grün bei Henry Sieveking, sind farblich harmonisch auf ihre Garderobe abgestimmt, ebenso wie ihre Zylinder und ihre Handschuhe, mit denen sie ihre Gehstöcke schwingen, als wir später wieder zu Fuß nach Hause gehen.
Eduard Sieveking führt mich galant am Arm über das unebene Kopfsteinpflaster, wohl wissend, dass mir das Gehen in den vielen Schichten Stoff noch recht schwerfällt, obwohl es mir innerhalb des Hauses inzwischen zunehmend besser gelingt. Dort habe ich bereits eine gewisse Geschicklichkeit darin erlangt mich mit dem schweren Rock durch – gefühlt – viel zu schmale Türen zu manövrieren und die Sitzfläche von Stühlen zu treffen, auf die mir durch Berge von Stoff die Sicht verwehrt ist.
Henry Sieveking folgt uns in einigem Abstand wie ein Hütehund, der seine Herde vor sich hertreibt.
Solange wir uns über den Vorplatz der Kirche bewegen, werden wir immer wieder von anderen Bürgern angehalten, die sowohl Henry Sieveking nach seiner langjährigen Abwesenheit wieder in ihrer Mitte begrüßen, als auch einen neugierigen Blick auf meine Wenigkeit werfen wollen. Es werden gleich mehrere Einladungen zum Tee und sogar zu Abendgesellschaften ausgesprochen, die mich stets explizit miteinschließen. Wie sich herausstellt, hat es sich nämlich inzwischen wie ein Lauffeuer unter den Bürgern der Stadt herumgesprochen, dass der Ältere der Sieveking-Brüder überraschend eine Gouvernante aus Sansibar für seine Kinder mitgebracht hat. Noch dazu eine, die mehrere Jahre mit ihrem Vater in der Wildnis geforscht, auf der Heimfahrt von Piraten überfallen und schließlich schiffbrüchig geworden ist. So jemand verspricht doch einen gewissen Unterhaltungswert, den sich die Mitbürger nicht entgehen lassen wollen.
Es gelingt mir an diesem Vormittag zum Glück, sämtliche neugierige Fragen entweder unbestimmt oder halbwegs glaubwürdig zu beantworten, ohne als Hochstaplerin aufzufliegen. Das liegt aber auch zu einem nicht unwesentlichen Teil an Henry Sieveking, der sich gleich mehrmals hilfreich in die Gespräche einschaltet und mögliche Klippen darin geschickt zu umschiffen weiß.
Als wir schließlich vor der Eingangstür des Hauses in der Deichstraße ankommen, bin ich erleichtert, fürs Erste weiteren Fragen zu entkommen. Ich nehme mir vor, in den folgenden Tagen etwas weniger Klavier zu spielen. Stattdessen werde ich mal besser die diversen Nachschlagewerke und Sachbücher in der Sievekingschen Hausbibliothek nach Detailinformationen über Sansibar durchforsten.
Wenn ich dabei auch noch Wissenswertes über Zeitreisen oder über geheimnisvolle Zauberspiegel finden würde, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Aber diesbezüglich gebe ich mich keinen Illusionen hin: Hätten die Sievekings auch nur ein einziges hilfreiches Buch in dieser Richtung im Bestand, hätte gewiss mindestens einer der beiden Brüder etwas davon gewusst, denn die Herren scheinen mir recht belesen zu sein. Bei unseren bisherigen Überlegungen darüber, wie ich es wohl anstellen könnte, wieder nach Hause zurückzukehren, fiel aber leider keinem der beiden ein Buch ein, das uns in dieser Frage hätte weiterhelfen können.
Montag, 22. August 2016
„Sie übernachtet noch eine weitere Nacht bei dir?!“, hakt Johannes nach.
Gregor glaubt das aufkeimende Misstrauen fast durch das Telefon greifen zu können. „Ja, stell dir vor, Alex und ich sind heute zu einer Vernissage eingeladen und Lena möchte auch gerne mitkommen“, lügt er und versucht dabei möglichst unbeschwert zu klingen. „Ich kenne die Künstlerin. Sie hätte gerne, dass ich ein paar Fotos von ihr mache“, unterfüttert er seine Geschichte noch ein bisschen. Letzteres ist nur zur Hälfte gelogen. Tatsächlich war er heute bei besagter Künstlerin und hat in ihrem Atelier fotografiert. Natürlich ist er erst aufgebrochen, nachdem Alex ihm hundertmal versichert hat, sich sofort bei ihm zu melden, sollte Lena aus dem Spiegel wieder auftauchen oder sollte sich sonst irgendein Hinweis auf den Verbleib seiner Schwester finden lassen. Was aber bedauerlicherweise nicht passiert ist. In der Zwischenzeit ist Gregor in seinem Fotostudio angekommen und entwickelt die Bilder der Künstlerin, damit er anschließend so schnell wie möglich wieder zu Alex in den Laden fahren kann.
„Wo ist Lena denn? Kann ich sie mal sprechen?“, fragt Johannes weiter.
„Du, das geht gerade schlecht. Sie steht unter der Dusche“, antwortet Gregor gedehnt.
„Sie duscht bei dir? Ist sie denn schon wieder direkt von der Arbeit aus zu dir gefahren? Warum kommt sie dafür nicht nach Hause? Sie muss doch auch mal die Kleider wechseln. Schließlich ist sie jetzt schon seit drei Tagen von zu Hause weg…“
„Wir müssen ganz früh zu dieser Vernissage“, unterbricht Gregor. „Wegen der Lichtverhältnisse für die Fotos, weißt du? Deshalb hat es sich für Lena nicht gelohnt, erst noch bis zu euch nach Altona zu fahren. Ich habe ihr angeboten, dass sie hier duschen und sich einfach ein Shirt von mir ausleihen kann.“
„Aha“, meint Johannes nur. Er klingt nicht wirklich überzeugt, gibt aber zu Gregors unendlicher Erleichterung fürs Erste auf. „Na gut. Dann grüße sie bitte von mir und sag ihr, dass sie sich mal bei mir melden soll. Ich muss zwar gleich wieder zur Aufführung, weil ein Kollege von mir krank geworden ist. Aber ich lasse mein Handy so lange wie möglich an…“
„Sie kann dir ja auch ne Nachricht schicken“, schlägt Gregor geistesgegenwärtig vor.
„Hmmm, ja. Kann sie natürlich auch.“ Johannes klingt wenig begeistert, lässt sich aber schließlich nach ein paar harmlosen Sätzen Smalltalk endgültig von Gregor abwimmeln.
„Puh!“, stößt Gregor erleichtert aus, als er endlich aufgelegt hat. Nachdem er Lena auf ihrer Arbeitsstelle in der Redaktion erst einmal für die nächsten Tage krankgemeldet hat, entwickelt sich Johannes gerade zu einem weiteren Problem. Was natürlich zu erwarten war. Seit Freitagmorgen hat er Lena schließlich nicht mehr zu Gesicht bekommen, und jetzt ist es Montagabend. Mit den bisherigen Ausreden von vermeintlichen Ausflügen und Unternehmungen konnte Gregor ihn bisher zwar ganz gut hinhalten. Aber diese Geschichten werden selbst in seinen eigenen Ohren allmählich unglaubwürdig. Spätestens morgen Abend wird Johannes erwarten, dass Lena ganz normal von der Arbeit aus der Redaktion nach Hause zurückkommt. Wenn nicht, wird er bei Gregor vor der Tür stehen und wissen wollen, was los ist.
Wenn Gregor das nur selber wüsste!
Sonntag, 22. August 1841
Das Wetter ist umgeschwenkt. Nach der Hitze und dem anschließenden Gewittersturm ist es deutlich abgekühlt. Heute Morgen beim Kirchgang bin ich bereits sehr froh um den blassgrünen Seidenschal gewesen, der mein schulterfreies Sonntagskleid nicht nur farblich passend ergänzt, sondern auch dafür sorgt, dass ich mir in der plötzlichen Kälte keinen Schnupfen einfange. Während des Mittagessens fängt es zu allem Überfluss auch noch an, heftig zu regnen, worauf sich in den Straßen kleine Rinnsale bilden und sich die meist ungepflasterten Straßen außerhalb der Stadt in unwegsame Schlammpfützen verwandeln, wie mir meine Gastgeber mitteilen. Ein ursprünglich geplanter Nachmittagsausflug zum Sommerhaus, um Eduards Frau Hetty und die Kinder kennen zu lernen, fällt damit buchstäblich ins Wasser.
Ich weiß nicht, ob ich darüber froh oder traurig sein soll. Einerseits bin ich neugierig auf die übrige Sievekingsippe, insbesondere auf meine zukünftigen beiden Schützlinge. Andererseits fürchte ich mich aber auch ein wenig davor. Zwar handelt es sich bloß um ein erstes Kennenlernen; es werden noch keinerlei erzieherische Maßnahmen von mir verlangt, aber trotzdem kommt mir der unerwartete Aufschub nicht ungelegen. Ich fühle mich mental einfach noch nicht richtig bereit, meinem Leben als Mary Poppins in die Augen zu blicken – und sei es auch bloß für eine kurze Stippvisite.
Aus einem für mich nicht erkennbaren Grund, scheint es Henry Sieveking ähnlich zu gehen, denn während sein Bruder Anweisungen gibt, statt der ursprünglich geplanten Kutsche lediglich ein Pferd für ihn bereit zu machen, zieht der grimmige Henry es vor, ebenfalls zu Hause zu bleiben. Angeblich, weil er in den ersten Tagen bereits wieder derart in die Geschäfte des Handelshauses eingebunden war, dass er noch gar nicht dazu gekommen ist, seine persönliche Habe auszupacken und sich in seinen Räumlichkeiten wieder wohnlich einzurichten. Selbst mir, die ich erst seit kurzem hier wohne, kommt dieses Argument doch arg fadenscheinig vor. Vielmehr scheint es mir, dass er sich davor drückt, seine Schwägerin, die Großtante und die Kinder wiederzusehen.
Eduard Sieveking sieht es offenbar genauso. Als sein Bruder ihm eröffnet, nicht mit ihm zum Sommerhaus reiten zu wollen, sehe ich ihn zum ersten Mal verärgert. Genau wie bei Henry bildet sich eine zornige Falte auf der Stirn und die beiden sehen sich in diesem Augenblick extrem ähnlich. Einen Moment lang scheint der jüngere Bruder auch zu einer heftigen Erwiderung anzusetzen, die er sich dann aber doch, mit einem Seitenblick auf mich verkneift. Offensichtlich mag er in Anwesenheit eines Nichtfamilienmitglieds nicht über das streiten, was zwischen ihm und seinem Bruder gerade vorgeht, denn dass es hier um mehr geht, als dass der Ältere zu bequem ist, sich bei schlechtem Wetter zu einem Besuch aufzumachen, ist ganz offensichtlich. Noch immer sichtlich verärgert, verabschiedet sich der Eduard Sieveking schon bald nach dem Dessert.
Auch ich entschuldige mich, da ich keine übergroße Lust verspüre, mich länger als nötig alleine mit Henry Miesepeter in einem Raum aufzuhalten. Ohne Umwege mache ich mich auf in die Bibliothek, um meine Recherchen zu Sansibar in Angriff zu nehmen. Zu meinem Erstaunen finde ich bei den Nachschlagewerken ein „Conversationslexikon für Damen“. Bezeichnenderweise besteht es bloß aus zwei Bänden, während das normale Standardlexikon, also wohl das für Herren, fünf umfasst. Kopfschüttelnd suche ich mir jeweils den Buchstaben S wie Sansibar heraus und lege es auf einen großen Tisch, der vor einem gemütlich aussehenden wuchtigen Sofa steht, das mit grünem Samt bezogen ist. Des Weiteren finde ich auch noch einen schweren Weltatlas, den ich mir ebenfalls auf den Tisch hieve. Danach mache ich es mir auf dem Sofa bequem und beginne zu blättern. Mit dem „Conversationslexikon für Damen“ bin ich erwartungsgemäß schnell fertig. Es verrät mir lediglich, dass Sansibar eine Insel vor der Küste Afrikas ist und dort überwiegend Nelken, Zimt, Vanille, Muskat und Pfeffer angebaut werden. Mehr scheinen die Autoren für die Konversation von Damen nicht für nötig zu erachten. Das Standardlexikon ist im Vergleich dazu schon ein wenig präziser. Es informiert über Bevölkerungszahlen, Regierungsform, Religionen, landwirtschaftliche Produkte und die enge wirtschaftliche Verflechtung der Insel mit Europa, insbesondere mit Großbritannien. Na schön. Das ist als Basisinformation sicherlich hilfreich, für meine Zwecke jedoch viel zu dürftig. Jemand, der auf Sansibar gelebt hat, weiß ganz andere Sachen: Wie riecht diese Insel? Wie klingt sie am Tag und in der Nacht? Was isst man dort zum Frühstück…? Solche Dinge verrät einem kein Lexikon. Auch der Atlas hilft mir diesbezüglich nicht wirklich weiter.
Enttäuscht, lasse ich mich in das Sofa zurückfallen. Wenn ich jetzt Zugang zum Internet hätte, könnte ich mir Bilder oder vielleicht sogar einen Film über Sansibar anschauen. Aber was das angeht, trifft Sievekings Stichelei vom ersten Abend zu: technisch gesehen befinde ich mich so gut wie in der Steinzeit. Nachdenklich nestle ich an einer der grünen Blumen aus Stoff, die mein Kleid zieren, als sich hinter mir die Tür öffnet und Henry Sieveking den Raum betritt.
Offensichtlich hat er nicht mit meiner Anwesenheit gerechnet, denn als er eintritt, weicht er sichtlich zurück und würde wohl am liebsten sofort wieder verschwinden.
Mir persönlich wäre das auch lieber. Aber in den wenigen Sekundenbruchteilen, in denen wir uns gegenseitig wahrnehmen, wird uns wohl beiden klar, dass ein Rückzug von seiner Seite jetzt gesellschaftlich inakzeptabel wäre.
Einen Moment lang, wissen wir beide nicht, was wir sagen sollen. Dann finde ich als Erste meine Sprache wieder. „Na? Schon fertig mit auspacken?“, erkundige ich mich, wobei mir durchaus bewusst ist, dass meine Bemerkung ein wenig spitz klingt.
Er ignoriert meine Frage. Stattdessen betritt er endgültig die Bibliothek, schließt die Tür hinter sich und kommt näher. „Was machen Sie da?“, erkundigt er sich seinerseits und fügt mit Blick auf die Lexika und den aufgeschlagenen Atlas ironisch hinzu: „Erarbeiten Sie einen wissenschaftlichen Vortrag über Afrika?“ Wobei er mir höchstwahrscheinlich zu verstehen geben will, dass er Frauen für zu blöd dafür hält, wissenschaftlich zu arbeiten.
Entsprechend hochnäsig gebe ich zurück: „Das würde ich sehr gerne tun, wenn nur die Informationsquellen hier nicht derart dürftig wären. Insbesondere das „Conversationslexikon für Damen“ ist ja wohl die Höhe! Was soll das überhaupt? Ein Lexikon für Frauen und eins für den „Standard“?! Sind Männer der Standard und Frauen nicht? Und wenn ja, wieso ist das so? Seit wann benötigt man einen Schniepel, um sich für die wirtschaftlichen Belange und Bevölkerungsfragen eines Landes zu interessieren?“ Ich habe mich richtig in Rage geredet. Insbesondere, weil ich glaube zu bemerken, dass Henry Sievekings Mundwinkel während meiner Rede amüsiert gezuckt haben, so als mache er sich lustig über meine doch durchaus berechtigte Empörung.
Bei der Verwendung des Wortes Schniepel, wird er jedoch schnell wieder ernst. „Unterstehen Sie sich, derartige Wörter in Anwesenheit meiner Kinder zu verwenden, wenn Sie sie unterrichten! So etwas schickt sich nicht für eine Dame!“, weist er mich streng zurecht.
„Welche Wörter meinen Sie?“, stelle ich mich dumm. „Die Bevölkerungsfragen oder den Schniepel?“
„Das wissen Sie ganz genau!“, aus seinen blauen Augen scheinen Funken zu sprühen.
Ich funkle zurück, so gut ich kann. Einige Sekunden lang liefern wir uns auf diese Weise ein stummes Duell, wie zwei Maultiere, die sich weigern, dem jeweils anderen auszuweichen. Nicht zum ersten Mal kommt mir dabei bei seinem Anblick in den Sinn, dass er rein optisch durchaus mein Typ ist – wenn er nur nicht so ein blöder Idiot wäre.
„Was ist nun?“, ergreift er schließlich das Wort. „Verraten Sie mir endlich, was Sie aus diesen Büchern zu erfahren hoffen?“
Ich informiere ihn darüber, dass ich, um als Tochter des Forschers authentisch zu sein, mehr über das Leben auf Sansibar erfahren muss. Dass ich Informationen aus erster Hand benötige und keine nüchternen Lexikonzahlen.
Er nickt und überlegt einen Moment. Dann kommt er zu meiner Überraschung um das Sofa herum und setzt sich neben mich, wobei er die Beine übereinanderschlägt und die Pfeife aus der Tasche zieht. „Ich habe fünf Jahre auf Sansibar gelebt“, stellt er nüchtern fest, während der er seine Pfeife in Gang bringt, „was also wollen Sie wissen?“
‚Oh nein‘, denke ich. ‚Wahrscheinlich blüht mir jetzt eine stinklangweilige Vorlesung.‘ Innerlich stelle ich bereits meine Ohren auf Durchzug.
Aber dann beginnt er ohne weitere Aufforderung mit seiner angenehmen Stimme zu erzählen. Vom Rauschen des Indischen Ozeans. Vom Gesang der bunten Vögel in den Bäumen. Vom Duft der Nelken, der wie ein samtiger Aromenteppich über der ganzen Insel liegt. Und vom Sternenhimmel, der über Sansibar so ganz anders leuchtet, als über Hamburg.
Binnen weniger Augenblicke hat er mich in seinen Bann gezogen, entführt mich sein Bariton in die schattigen Gassen des exotischen Sultanats. Und ich glaube fast körperlich dort zu sein, den Ruf des Muezzin zu hören, den Sand am Strand zwischen meinen Zehen zu spüren und die Düfte der Blumen in den hinter hohen Mauern verborgenen Gärten zu riechen.
Auch Henry Sieveking selbst scheint in Gedanken weit fort zu sein, ist mitgereist auf die ferne Insel und hat das Hier und Jetzt komplett ausgeblendet. Während er selbstvergessen von dem fremden Land erzählt, geht eine sichtliche Wandlung mit ihm vor. Seine sonst so strengen Züge glätten sich, seine Miene hat mit einem Mal etwas Träumerisches. Sein ganzer Körper entspannt sich. Es ist, als trete er für eine kurze Weile aus dem Schatten seiner selbst ans Licht und offenbare sein wahres inneres Ich, das er sonst so gekonnt zu verbergen weiß.
In diesem Augenblick, da er vollkommen er selbst ist, trifft mich die Erkenntnis wie ein Schock, dass er nicht bloß äußerlich attraktiv ist, sondern auch wahre innere Schönheit besitzt.