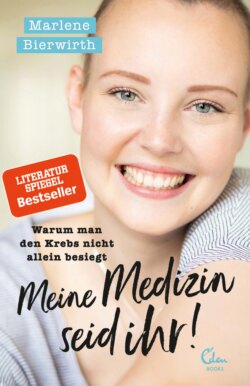Читать книгу Meine Medizin seid ihr - Marlene Bierwirth - Страница 5
Ich bilde mir das alles nur ein
ОглавлениеSamstag, sechs Uhr dreißig, acht Monate vor der Diagnose. Ich laufe schwankend, als wäre ich betrunken, über das unebene Kopfsteinpflaster unseres Hofs. Huch, da ist mein Kreislauf wohl noch nicht auf Touren. Passiert mir immer öfter in letzter Zeit. Ich muss mehr trinken. Es riecht nach Sommer, und ich weiß, heute wird ein warmer Tag. Ich versuche so leise wie möglich das Hoftor zu öffnen, damit ich niemanden wecke. Meine Eltern haben einen leichten Schlaf und hören immer alles. Währenddessen gehe ich in Gedanken den Tag und meine Sachen durch: Ich müsste alles dabeihaben. Ich steige in das Auto meiner Kollegin und hoffe, dass ich sie nicht zu lange habe warten lassen. Um diese Uhrzeit bin ich immer knapp dran, aber meist schaffe ich es trotzdem gerade so, pünktlich zu sein. Wir unterhalten uns über das Wetter, die Schule, und ich frage mich die ganze Zeit, wie sie es schafft, so wach auszusehen.
Wir halten auf dem Parkplatz des Supermarktes und laufen gemeinsam Richtung Eingang. Es stehen schon Leute davor und warten ungeduldig, dass wir öffnen und sie alles Überlebenswichtige für den nächsten freien Tag kaufen können. Ob ich selbst später auch so sein werde? Ich hoffe inständig, nicht. Aber schließlich habe ich mein Leben selbst in der Hand und damit auch, wie ich mich verhalte und was mir wichtig ist.
Nachdem wir uns in dem Raum mit den Spinden umgezogen haben, gehen wir in voller Arbeitsmontur, einem grauen T-Shirt, an dem mein Namensschild hängt: »M. Bierwirth«, und einer schwarzen Schürze über unserer privaten Hose, an die Kassen. Ich bedanke mich innerlich bei meinem Chef, dass wir bei diesen Temperaturen T-Shirts tragen dürfen anstelle zugeknöpfter Hemden mit Schlips.
»Normalerweise mag ich den Sommer, aber dieses Jahr ist es doch wirklich viel zu heiß!«, höre ich mir bei jedem zweiten Kunden an und antworte mit einem meist nickenden Lächeln. Ich sitze also dauerlächelnd und mit wirklich guter Laune dort und bringe die Kasse zum Piepen.
Ich hatte mir den Job schlimmer vorgestellt. Aber ich habe tolle Kollegen, einen netten Chef, und ich muss nicht weit fahren.
Während ich irgendwann im Laufe des Vormittags fast schon mechanisch meinen Job mache, taucht ein mir sehr bekanntes Gesicht in meinem Augenwinkel auf. Es ist meine Mutter, sie macht ihren Großeinkauf der Woche und freut sich jedes Mal, mich bei der Arbeit zu sehen. Weil sie Familie ist, darf ich sie aber nicht an meiner Kasse abscannen, weil dann »aus Versehen« mal etwas durchrutschen könnte. Während ich die Lebensmittel einer Kundin abscanne, spricht sie also von der Kasse nebenan über deren Kopf hinweg kurz mit mir über später:
»Wann genau soll ich dich denn wo abholen?«
Wir werden es nämlich etwas eilig haben, und alles muss sitzen. Ich habe direkt im Anschluss an die Schicht Musical-Probe, und da die leider früher beginnt, als meine Schicht hier endet, versuchen wir so schnell da zu sein wie irgend möglich. Ich spiele die Amber von Tussle in Hairspray.
Ab Punkt 13 Uhr gucke ich minütlich auf diese kleine Digitalanzeige in der Ecke meines Bildschirms, während ich den blöden Barcode bei einer Tüte Chips suche. Nur noch dreißig Minuten bis zum verdienten Feierabend! Ich rutsche mittlerweile ungeduldig auf meinem Drehstuhl hin und her. Obwohl, ungeduldig bin ich ehrlicherweise bereits seit zwölf Uhr – seitdem die Probe begonnen hat und ich nicht dort sein kann. Ich weiß jetzt schon, welche Blicke ich bei meiner Ankunft ernten werde. Eine Hauptrolle, die sich ständig verspätet, kommt leider überhaupt nicht gut an. Ich habe die Rolle zugesagt, bevor ich den Job hier angenommen hatte. Das Schauspielern gehörte schon immer zu meinen Leidenschaften, schon in der Grundschule habe ich mit meinem damaligen Chor ein Musical aufgeführt und dort eine Hauptrolle gespielt. Leider kann ich mir meine Arbeitszeiten nicht immer aussuchen. Manchmal passt es dann eben nicht so gut. Blöd ist das! Und mir sehr unangenehm. Aber was soll ich machen? Mein Führerschein bezahlt sich nicht von selbst. Und außerdem bin ich mir sicher: Ich kriege beides unter einen Hut. Ich bin ganz gut im Organisieren, und genug Power habe ich auch.
Während ich da so sitze und meine Akkordarbeit ableiste, summe ich das Lied meiner Rolle Amber.
Endlich ist es halb zwei. Ich werde von einer Kollegin abgelöst und gehe zügig durch den Laden, schlängle mich an dem einen oder anderen Kunden vorbei. Plötzlich bleibe ich abrupt stehen und muss mich wirklich konzentrieren – sonst kippe ich um, merke ich. Das ist heute schon das zweite Mal, dass mir das passiert. Wieder der Kreislauf? Allerdings sitzen mir die Zeit und ein schlechtes Gewissen im Nacken. Eines Tages werde ich vielleicht einfach so ohnmächtig, denke ich. Doch heute scheint nicht dieser Tag zu sein …
Mit meiner vollgepackten Tasche steige ich auf dem Beifahrersitz in das Auto meiner Mutter und knalle die Tür schwungvoll zu:
»Kann losgehen!«
Sie drückt mir lachend eine Bratwurst im Brötchen in die Hand, gekauft beim Grillwagen vor dem Supermarkt. Ich freue mich sehr über diese nahrhafte Überraschung und merke jetzt erst, wie ausgehungert ich bin. Das wird es wohl gewesen sein, was mich so schwach gemacht hat. Mit großem Hunger und totalem Genuss esse ich also und genieße meine paar Minuten Pause auf der Fahrt zur Probe.
»Wir proben bis um sechs, danach werde ich vom Vater von Sophie, die auch beim Musical mitspielt, zu Daniel mitgenommen. Ich komme dann morgen Vormittag mit dem Zug wieder heim. Kann mich einer vom Bahnhof abholen?«, frage ich meine Mama mampfend.
»Ja, schreib uns einfach noch mal, wann genau wir dich abholen sollen«, antwortet sie nickend, während sie auf die Fahrbahn schaut. Am Probenort angekommen, der neuen Aula meiner Schule, gebe ich ihr zum Abschied einen schnellen Kuss auf die Wange und springe aus dem Auto.
Die Probe verläuft nach anfänglich vorwurfsvollem Schweigen mir gegenüber dann zum Glück wirklich gut. Ich merke, wie der lange Tag mir in den Knochen sitzt, ziehe es aber durch. Nach der Probe fahre ich zu Daniel und bin froh, mich den Samstagabend bei ihm fallen lassen zu können.
Daniel ist mein Freund, wir sind seit fast einem Jahr ein Paar. Ich habe ihn über einen alten Freund, mit dem ich zusammen auf der Grundschule war, zufällig kennengelernt. Er ist meine erste große Liebe, ein ruhiger, ganz lieber Typ. Seine braunen Augen haben so einen warmen Blick drauf. Er ist der Typ Mann, bei dem ich nicht viel nachdenken muss, was richtig ist, der mir bei allem hilft und mich unterstützt. Weiß ich mal nicht weiter, hat er immer eine Lösung parat.
Bei ihm angekommen, bedanke ich mich beim Vater von Sophie fürs Mitnehmen und hoffe innerlich, dass ich nicht zu viele Umstände bereitet habe. Ich kann das gar nicht leiden: dass jemand meinetwegen womöglich einen Umweg fährt. Ich steige aus und mit schweren Beinen die Treppe zum Haus hinauf. Ich klingele erschöpft, und Daniel öffnet mir strahlend die Haustür. Ich lasse mich in seine Arme fallen und hoffe, den Abend über diese nicht mehr loslassen zu müssen. Seine Mama hat gekocht, und ich ziehe mit geschlossenen Augen den köstlichen Duft ein. Nach dem Abendessen schlurfe ich die Treppen nach oben in Daniels Zimmer. Mein Ziel ist nur noch die Dusche und meine Jogginghose danach. Ich bin froh, dass wir an diesem Abend einfach nur einen Film im Bett schauen werden.
»Okay, überredet«, willige ich wenig später in einen Film ein, den Daniel ausgesucht hat. Zum Glück mögen wir größtenteils dieselben Filme. Bei ihm hört’s bei Liebesfilmen auf und bei mir bei Horrorfilmen. Doch trotzdem diskutieren wir jedes Mal endlos, welchen Film wir schauen sollen. Das liegt vielleicht daran, dass er einmal einen Film ausgesucht hat, den ich total doof fand, sodass ich jetzt lieber vorsichtig bin, auch wenn er schon voll und ganz überzeugt ist von einem Streifen. Aber heute fühle ich mich einfach zu kraftlos für eine Diskussion und habe mir vorgenommen, gleich nachzugeben und den Film mit ihm zu schauen, den er ausgesucht hat.
Als der Vorspann läuft, kuschele ich mich schon an seine Schulter. Etwa zehn Minuten später sind meine Lider schon ganz schwer, ich bin auf dem besten Weg, einzuschlafen. Daniel merkt das und hält mir seine Hand vor die Augen. Das ist seine Methode, um zu prüfen, ob ich noch den Film schaue oder schon schlafe. Wenn ich die Hand wegschlage oder irgendein Geräusch von mir gebe, bin ich noch wach. Halbherzig wedele ich noch vor meinen Augen herum, doch lasse sehr bald kichernd meine Hand wieder sinken. Daniel ist gnädig mit mir und zieht mich noch näher an sich. Dann guckt er eben allein, während ich selig in seinen Armen schlafe.
Ich wache mit einem flauen Gefühl in der Magengegend auf und kann nicht mehr schlafen. Ich setze mich auf und versuche mich zu konzentrieren. Mir ist schlecht, und ich wünschte, es wäre nicht so. Ich hasse dieses Gefühl und würde am liebsten anfangen zu weinen. Plötzlich muss ich würgen und möchte mich übergeben, doch so einfach ist das am frühen Morgen leider nicht. Daniels Hände berühren meine Schultern und versuchen mich zu beruhigen. Ich schaue in sein verschlafenes, besorgtes Gesicht und verabscheue das Gefühl, dass es mir mies geht und er mich so sieht. Ich mag es nicht, Mitleid zu bekommen, ich fühle mich dann immer so schwach. Ich muss erneut würgen. Wieder weiß ich: Ich kann mich nicht übergeben, und ich will es auch nicht. Ich halte dem ekligen Gefühl stand und lasse es über mich ergehen. Nach weiteren zwei Malen ist es vorbei. Ich bin erschöpft, und obwohl es mir unangenehm ist, dass Daniel mich eben erlebt hat, hat mich seine Anwesenheit beruhigt. Ich lege mich wieder hin, er zieht mich zu sich. Ich schließe die Augen, versuche den Moment eben zu vergessen und nicht weiter darüber nachzudenken, bevor ich mich noch in etwas hineinsteigere.
Ja, zugegeben, solche »Anfälle«, wie ich sie nenne, bekomme ich des Öfteren in letzter Zeit. Wahrscheinlich bin ich einfach nur überlastet.
»Schließ bitte alle Türen richtig, es wird kalt!«, ruft mir meine Mama zu, bevor ich in die Küche komme. Es ist Herbst geworden, um genau zu sein, der zweite Sonntag im Oktober, gegen halb sieben Uhr abends. Meine Familie, Mama, Papa, Pinkus, Ira, Jan und Aaron, sitzt am Esstisch zusammen und wartet mit dem Sonntagsessen auf mich. Ich freue mich, alle in unserer kleinen Küche versammelt zu sehen. Es ist schon dunkel draußen, und meine Eltern haben Kerzen auf den Tisch gestellt, ich liebe diese Herbststimmung und die Wärme drinnen im Haus.
Alle beginnen zu essen. Was für ein schönes Beisammensein! Nur bekomme ich mal wieder nichts runter. Das Geräusch, wenn die anderen essen, löst in mir heute ein Ekelgefühl aus, und ich versuche krampfhaft-konzentriert, einfach meinen Bissen hinunterzuschlucken. Nach einer halben Portion muss ich aufhören zu essen, es geht nicht mehr, ich habe es wirklich versucht.
Stell dich nicht so an!, sage ich zu mir selbst. Doch ich weiß: Wenn ich jetzt weiteresse, bleibt es nicht lange in meinem Magen. Ich muss aufhören mir einzubilden, das Essen wäre eklig. Das war doch sonst nicht so bei mir. Irgendetwas scheint mich so sehr zu bedrücken, dass es mir auf den Magen schlägt. Wahrscheinlich ist es das. Die meisten Übelkeitsanfälle bekomme ich morgens, wenn Daniel dabei ist. Vielleicht bin ich unbewusst doch nicht so gern mit ihm zusammen, fühle mich unwohl, und mein Körper versucht mir das auf diese Art zu zeigen …? Klar, die Schmetterlinge flattern nach einem Jahr Beziehung nicht mehr so heftig herum wie am Anfang, aber das bedeutet doch nicht gleich, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Gedanken über Gedanken. Wahrscheinlich bilde ich mir das alles sowieso nur ein. Wenn ich meinen Eltern davon erzähle, dann denken sie bestimmt, ich mache aus etwas nicht Vorhandenem ein Riesendrama. Marlene, die kleine Dramaqueen. Zugegeben, da ist was dran: Als kleines Kind war ich schon sehr empfindlich, ich bin gern mal umgekippt bei kleineren Verletzungen und habe mich schnell in etwas hineingesteigert. An eine Situation aus der Grundschule kann ich mich noch gut erinnern: Bei einem Handstand im Sandkasten habe ich eine Hummel platt gedrückt, die mich zur Gegenwehr gestochen hat. Damals habe ich geheult und geschrien und geriet völlig in Panik, als hätte ich mir alle Finger gebrochen. Dabei habe ich mir in meinem ganzen Leben noch nie etwas gebrochen, nur ganz gern mal verstaucht. Aber ich habe immer Stein und Bein geschworen, dass es etwas ganz, ganz Schlimmes sein musste. Ich nehme mir also fest vor, wieder ganz normal zu essen, ohne das komische Gefühl in meinem Magen.
»Bitte ein Kollege an Kasse zwei!«, sage ich durch den Lautsprecher. Es muss mich dringend jemand ablösen, ich habe das Gefühl, ich muss mich gleich auf das Band übergeben. Wie wohl die Kunden reagieren würden, wenn ich vor ihren Augen in den Mülleimer neben mir spucke? Das ist auf einmal kein Gedankenspiel mehr, sondern die Realität. Ich muss aufs Klo, sonst passiert hier gleich was. Gott sei Dank sehe ich meinen Kollegen in Richtung Kasse kommen, ich lasse den Kunden vor mir einfach stehen, springe auf und gehe, so schnell es geht, ohne zu rennen, quer durch den Laden. Im Lager angekommen renne ich an einer staunenden Kollegin vorbei in Richtung Toilette, ich muss mir schon den Mund zuhalten.
»Wir machen einfach mal einen Termin. Wer weiß, vielleicht hilft es dir ja«, sagt mein Papa. Seit meinem Zwischenfall auf der Arbeit sind drei Wochen vergangen. Wenn ich wirklich eine Essstörung habe, bin ich froh, endlich Hilfe zu bekommen. Ich möchte wieder ganz normal und mit Appetit essen können. Circa zwei Wochen später werde ich ganz herzlich von der Therapeutin begrüßt. Wir betreten einen Raum, der eher nach Wohnzimmer als nach Praxis aussieht. Ich habe mir einen Therapieraum ganz anders vorgestellt, steriler irgendwie. Das hier ist das genaue Gegenteil. Die Therapeutin fängt an zu reden, stellt mir Fragen, die ich offen und ehrlich beantworte. Ich kann ganz ungezwungen mit ihr reden und fühle mich wohl. Am Ende meiner ersten Therapiestunde fühle ich mich gut, leicht irgendwie. Aber über meine Übelkeit und meine Einstellung zum Essen haben wir nicht geredet. Na ja, vielleicht möchte sie mich erst mal kennenlernen.
In den nächsten zwei Wochen komme ich noch zweimal wieder. Es macht richtig Spaß, sich alles von der Seele zu reden, und wir haben wirklich gute Gespräche, wie ich finde. Und obwohl ich nicht wirklich daran glaube, dass sich dadurch etwas an meinem »Magenproblem« ändert, fühle ich mich besser und gesünder. Oder rede ich mir das nur ein?
Eine ganze Weile später, das neue Jahr ist bereits angebrochen: 2017, peitscht mir der kalte Februarwind um die Ohren, und ich ziehe meinen riesigen Schal noch höher. Wird es noch kälter, sieht man mich gar nicht mehr. Ich schaue nach links und dann nach rechts, die Straße ist frei, und ich kann sie mit schnellen Schritten überqueren. In unserer Kleinstadt steht ein altes Haus, darin ist die Praxis meines Hausarztes. Dorthin bin ich auf dem Weg. Ich melde mich bei der netten Sprechstundenhilfe an und setze mich ins Wartezimmer. Wow, das ist um diese Uhrzeit ja knallevoll. Irgendwie logisch, fünf Uhr nachmittags, wenn alle Feierabend haben. Jeder Platz ist besetzt. Die Rentner sind in diesem Raum auf jeden Fall in der Überzahl. Ich senke deutlich den Altersdurchschnitt. Während ich hier sitze, frage ich mich immer wieder, ob es eine blöde Idee war, herzukommen. Ich beobachte die anderen Patienten und stelle mir zu ihnen ein Leben vor. Ich beobachte gern Menschen. Mir macht Kopfkino einfach Spaß, ein anderes Leben zu haben, wenn auch nur kurz und in Gedanken, zu sehen, wie andere Menschen sich verhalten, und mir vorzustellen, wie sie ihren Tag verbringen.
»Frau Bierwirth?«, reißt mich die Stimme der Sprechstundenhilfe aus meinem Tagtraum. Nach einer gefühlten Ewigkeit werde ich aufgerufen und in den Flur vor dem Behandlungszimmer versetzt, wo ich meine Blicke von dem Foto an der Wand nicht abwenden kann. Es zeigt ein hübsches, altes, öffentliches Gebäude der Stadt zur Weihnachtszeit. Ich erkenne es wieder, und es erinnert mich an meine Schulzeit: Ich hatte dort in der fünften und sechsten Klasse Theaterunterricht.
Ich hoffe, ich bin gleich dran, ich will noch zu Daniel fahren. Und wieder einmal freue ich mich riesig über meinen Führerschein, der mich so viel selbstständiger macht. Richtig gehört: Ich habe seit einem Monat meinen Führerschein und kann endlich selbst fahren! Gerade in so kleinen Orten wie meinem ist das ein super Gefühl der Unabhängigkeit, und es ist schön, nicht mehr auf den Bus oder die Eltern angewiesen zu sein.
Nach einer weiteren Viertelstunde werde ich ins Behandlungszimmer gerufen. Nach kurzer Untersuchung kommt der Arzt zu dem Ergebnis, dass meine Mandeln noch angeschwollen sind von einer zurückliegenden Erkältung. Ich bin froh über eine Erklärung, bekomme Medikamente und fertig. Hoffentlich lösen sich damit auch die Nackenschmerzen, die mich neuerdings plagen.
Etwa zwei Wochen später fahre ich nach der Schule dieselbe Strecke wieder, in Richtung meines Hausarztes. Die Nackenschmerzen sind nicht besser geworden, auch nicht das Ohrgeräusch – trotz der Medikamente. Ich gebe zu: Das Ohrgeräusch war beim letzten Mal gar kein Thema. Ich hatte mich nicht getraut, es meinem Arzt gegenüber anzusprechen. Ebenso wenig wie meine Übelkeit. Das tue ich auch heute nicht. Es kommt mir so vor, als würde ich da etwas aufbauschen. Das ist bestimmt nur vorübergehend. Und jemand anderes würde es vielleicht gar nicht weiter beachten.
Es ist 17.30 Uhr, das Wartezimmer wieder randvoll, und ich verfluche die Schule dafür, dass wir so lange Unterricht haben, und das so kurz vorm Abi. Also stelle ich mich auf eine längere Wartezeit ein und versuche, mich zu entspannen. Es kommt einem ja sonst nur schlimmer vor, als es ist. Nach einer ganzen Weile werde ich aufgerufen, komme eine Etappe weiter: sitze erneut vor dem Behandlungszimmer und starre wieder auf das Bild an der Wand. Ich denke über das Abitur nach und ob ich wohl genug dafür lerne.
»Frau Bierwirth?!« Ich werde wieder aus meinen Gedanken gerissen und öffne die Tür des Behandlungszimmers. Heute sitzt mir eine Ärztin gegenüber, sie kommt sehr sympathisch rüber, und ich beschließe spontan, ihr alles zu erzählen. Außer von der Übelkeit. Solange ich selbst noch nicht sicher weiß, ob es sich dabei nicht vielleicht doch um reine Kopfsache handelt. Ich erzähle ihr von meinen Verspannungen, die mittlerweile bis hinter mein rechtes Ohr gewandert sind, und spreche kurz mein Ohrgeräusch an. Eher so nebenbei. Ich füge rasch selbst hinzu, aber mit einem zaghaft mitgedachten Fragezeichen:
»Das geht mit der Zeit sicherlich von selbst wieder weg …«
Die Ärztin schaut sich meinen Kopf an und in meine Ohren. Die Verspannung ist wohl tatsächlich vorhanden, aber mit meinen Ohren scheint alles gut zu sein. Dann kann es sich bei dem Geräusch um nichts Schlimmes handeln, bestätige ich mir selbst.
»Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Krankengymnastik verschreiben, damit sollten die Verspannungen besser werden«, bietet mir die Ärztin an.
»Ja, gern«, antworte ich dankbar lächelnd. Ich war noch nie bei der Krankengymnastik und stelle mir schon vor, wie ich massiert werde und sich meine Verspannungen in Nichts auflösen.
Ein paar Tage später fahre ich mit gemischten Gefühlen zu meinem ersten Termin bei der Physiotherapie. Die Erleichterung über baldige Hilfe überwiegt meine Verunsicherung. Dort angekommen, werde ich von einem Mitarbeiter freundlich empfangen, der mich in eine helle, freundliche, warme Kabine begleitet. Er leitet mich an, mit meinen Armen einige Bewegungen durchzuführen, und schaut sich dabei meine Schultern und meinen Rücken an. Danach werde ich ordentlich durchgeknetet. Weil ich mich bis auf die Unterhose ausziehen muss, fällt es mir anfangs schwer, mich fallen zu lassen, doch zum Ende hin gelingt mir das ganz gut. Der »Massagemensch«, wie ich ihn nenne, verlässt die Kabine, und ich ziehe mich wieder an.
»Bis nächste Woche!« Ich verabschiede mich einigermaßen beschwingt, verlasse das Gebäude und hetze zu meinem Auto. Ich muss wieder in die Schule zu meinem Nachmittagsunterricht. Ich steige ein und … bleibe erst mal einfach sitzen. Von den schnellen Bewegungen dreht sich mir der Kopf und bewegt sich alles um mich herum.
Gleiche Situation, drei Wochen später: Die Massagen tun mir gut, und ich fühle mich schon nicht mehr so verspannt wie noch vor drei Wochen. Im Auto drücke ich auf »Anrufen«, und schon fängt es an zu tuten, drei, vier, fünf Sekunden lang, und ich hoffe jede davon, dass jemand am anderen Ende der Leitung abnimmt.
»Hallo, Augenarztpraxis Schmidt, was kann ich für Sie tun?«, meldet sich eine Frauenstimme, endlich!
»Hallo, Bierwirth mein Name, ich wollte dringend nach einem Termin fragen, ich sehe plötzlich sehr schlecht«, antworte ich etwas weinerlich. Ich hoffe so sehr, dass ich schnell einen Termin bekomme, denn so kann es nicht weitergehen. Daniel ist mir zufällig vor ein paar Tagen beim Autofahren entgegengekommen und hat erzählt, dass ich beim Fahren den Kopf sehr schief gehalten hätte, fast so, als würde ich rechts aus dem Fenster schauen. Mir fällt es schwer, Dinge an der Tafel zu lesen oder beim Schminken meine rechte Gesichtshälfte gut zu erkennen.
»Es tut mir leid, aber der nächste freie Termin ist erst in drei Monaten«, reißt mich die Stimme aus meinen Gedanken. Das kann doch nicht deren Ernst sein?! – Ich beiße verzweifelt auf meiner Unterlippe herum und überlege kurz, wie ich reagieren soll.
»Es ist wirklich dringend!«, flehe ich und hoffe auf das Herz der Dame.
»Wir haben viele Patienten, bei denen es dringend ist, in drei Monaten kann ich Ihnen einen Termin machen.«
»Das ist zu spät, aber danke«, sage ich mit leicht patzigem Unterton und lege auf.
Das kann doch nicht wahr sein: Ich sehe JETZT nicht mehr richtig und brauche JETZT so schnell wie möglich Hilfe! In drei Monaten habe ich wahrscheinlich längst einen Autounfall verursacht, weil ich beim Überholen nicht richtig habe einschätzen können, wie nah das entgegenkommende Auto schon war. Ich fahre genervt und sauer auf die Telefonfrau nach Hause und versuche, mich extra zu konzentrieren, damit ich ordentlich fahre. Zu Hause angekommen, laufe ich die Treppen zu meinem Zimmer hinauf und schmeiße mich frustriert auf mein Bett.
»Beruhige dich!«, sage ich laut zu mir selbst, während ich mich mit einem Ruck aufsetze. Ich reibe mir die Augen und blinzle ein paar Mal. Ich hoffe inständig, dass ich die Bilder von meinen besten Freundinnen Tabea und Lina und mir an der Wand normal sehen kann, nicht wieder doppelt. Doch tief in meinem Inneren weiß ich schon: Das wird nicht der Fall sein. Ich behalte recht. Das kann doch nicht sein! Wieso kann ich auf einmal so viel schlechter sehen? So etwas passiert doch nicht vom einen auf den anderen Tag. Schlechtes Sehen ist ein langsamer Prozess, bin ich der festen Überzeugung. Ich greife zu meinem Telefon und tippe Daniels Nummer ein. Ich erzähle ihm mit gemischten Gefühlen zum ersten Mal so wirklich davon. Irgendwie bin ich bei diesem Thema sehr unsicher, weiß nicht mehr, was ich mir vielleicht einbilde und was Realität ist.
»Wahrscheinlich brauch ich einfach nur eine Brille, aber es wäre trotzdem gut, wenn mir dazu mal jemand, der sich auskennt, etwas sagen kann«, teile ich ihm nachdenklich und mit einem fragenden Unterton mit. Aber Daniel nimmt mich zum Glück sofort ernst. Er schlägt sogar vor, gleich am nächsten Tag zu einem guten Freund seines Bruders Mathias zu gehen, der sei Optiker. In dem Laden, in dem er arbeitet, könne ich einen Sehtest machen. Gesagt, getan: Wir besuchen besagten Bekannten im Brillenladen. Während wir auf ihn warten, schaue ich mir schon mal ein paar Brillen an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine brauchen werde. Das stört mich nicht, ich finde die meisten Brillen sogar ganz schick. Als Kind wollte ich unbedingt eine haben, als mein Bruder nämlich seine bekam. Ich war diese Art von kleiner Schwester, die immer genau das haben und machen will wie der große Bruder. Das hat den Armen bestimmt ganz schön genervt.
»Na, was kann ich für euch tun?«, durchdringt eine Stimme meine Erinnerungen. Ich schaue in ein nettes Gesicht und fühle mich gleich gut aufgehoben. Wir folgen dem Optiker ein paar Stufen hinunter und in einen Raum. Dort setzt er mir ein paar Gläser auf, und ich muss damit Zahlen und Buchstaben lesen, die ein paar Meter vor mir an die Wand projiziert werden. Ein ganz normaler Sehtest eben, und dann noch ein Extra-Test, um die Hornhaut zu prüfen, sagt er. Am Ende, nach Auswertung meiner Tests, eröffnet er mir, dass ich nicht ganz »gerade« sehe, sondern Dinge versetzt.
»Dafür gibt es spezielle Gläser, also kann dir eine Brille hier bestimmt helfen«, klärt er mich auf und macht mir Mut.
»Geh aber lieber noch mal zu einem Augenarzt, der kann dir das genauer und sicher sagen. Ich kenne hier in der Nähe einen, der ist ganz neu, sodass du dort schnell einen Termin bekommst.« Er gibt mir die Nummer. Daniel und ich bedanken und verabschieden uns und verlassen ein Stück weit erleichtert den Laden.
Wie mir wohl eine Brille steht? Und was die wohl kostet? Was soll’s, wenn ich zum Arzt gehe, bekomme ich wenigstens die Gläser auf Rezept umsonst.