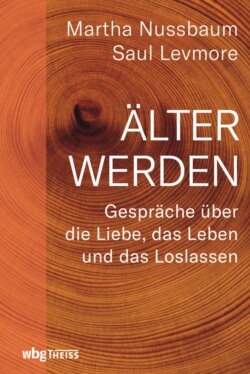Читать книгу Älter werden - Martha Nussbaum - Страница 9
Kapitel 1 Lernen von König Lear
ОглавлениеWorin besteht das Wesen von Lears Verletzbarkeit und warum ist er so unglücklich darüber? Was sollten wir aus Lears Fehler bei der Wahl zwischen seinen Töchtern lernen, und hätte er besser wählen oder sie gleich behandeln sollen? Wann ist es ratsam, erwartete Erbschaften zurückzuhalten? Wie lernt man, Kontrolle abzugeben?
Altern und Kontrolle in König Lear – und die Gefährlichkeit von Verallgemeinerungen
Martha
Aufführungen von König Lear sind heutzutage wie besessen von der Thematik des Alterns. So, wie in der Nachkriegszeit die Betonung auf Leerheit, Sinnverlust und völliger Zerstörung lag (in Peter Brooks denkwürdiger Inszenierung mit Paul Scofield, jedoch auch in unzähligen anderen seither), ist es in unserer Zeit das Thema des Alterns, das populär geworden ist, und dies kann vielleicht sogar teilweise erklären, warum die Popularität des Stückes in letzter Zeit so stark zugenommen hat. Inszenierungen folgen den Voreingenommenheiten des Publikums, für das sie bestimmt sind. Heute machen sich viele oder sogar die meisten Zuschauer einer Shakespeare-Inszenierung persönlich Sorgen über das Altern, pflegen einen alternden Verwandten, oder es trifft gleich beides auf sie zu. Wir sollten auch die große Anzahl ausgezeichneter älterer Schauspieler erwähnen, die die Rolle spielen wollen und von ihren extremen körperlichen Anforderungen nicht abgeschreckt werden. Laurence Olivier (der 76 Jahre alt war, als er die Rolle spielte), Ian McKellen (68), Stacy Keach (68), Christopher Plummer (72), Sam Waterston (71), John Lithgow (69), Frank Langella (76), Derek Jacobi (72) und kürzlich Glenda Jackson (80). Wir sind offensichtlich weit entfernt von Shakespeares eigenem Lear, Richard Burbage, der die Rolle mit 39 Jahren spielte, und noch weiter von Gielgud, der erst 29 Jahre alt war. (Scofield war übrigens erst 40 Jahre alt, aber das war ohne Belang, weil diese Inszenierung das Thema Alter nicht betonte.)
Ein Meisterwerk gewährt neue Einsichten, wenn es mit einer neuen Akzentsetzung auf die Bühne gebracht wird, und Lear bildet keine Ausnahme. Ich kritisiere Regisseure daher also nicht dafür, dass sie sich entschieden haben, das Thema des Alterns zu betonen, und das Stück, in dem Lear nach Liebesbezeugungen fragt und dann sein Königreich unter den beiden Töchtern (Goneril und Regan), die ihm schmeicheln, aufteilt und die eine (Cordelia), die ihn wirklich liebt, enterbt, erkundet Themen wie Enteignung, Verlust und schließlich Wahnsinn, den Shakespeare eindeutig mit Lears fortgeschrittenem Alter in Verbindung bringt. Dennoch gibt es da etwas, das bei dieser gemeinsamen Art und Weise der Akzentsetzung fehlt: Einige Entscheidungen der Regisseure führen uns weg von den Einsichten über das Altern, die das Stück wirklich bereithält. Beginnen wir mit einem repräsentativen Beispiel.
Eine vielgelobte Chicagoer Inszenierung von King Lear aus dem Jahr 2014 beginnt auf folgende Weise:1 Der Schauspieler Larry Yando spielt den König in einer mehr oder weniger modernen Inszenierung als alternden Tycoon. Er befindet sich in seiner eleganten Schlafzimmer-Suite, trägt einen teuren Morgenmantel und spielt einige Lieder von Frank Sinatra auf seiner noblen Stereoanlage an. Mit der Launenhaftigkeit eines langweilige Spielsachen wegwerfenden Kindes verwirft er „That’s Life“, „My Way“ und „Witchcraft“ – wobei er voller Frustration jedes Mal eine Fernbedienung aus Plastik zerschlägt, und von den aufmerksamen Dienern, die ihn umgeben, stets eine andere bekommt. (Diese wiederholte grundlose Zerstörung enthält eine unzutreffende Anspielung: Tycoons erreichen – anders als erbliche Monarchen – ihre Stellung nicht, indem sie verschwenderisch sind, und das Lied ließe sich leicht wechseln, ohne die Fernbedienung zu zerstören.) Schließlich kommt er zu „I’ve Got the World on a String“. Zufrieden tanzt er hocherfreut umher. Als Partner hat er nur sich selbst, aber er ist von großer Beweglichkeit. Chris Jones, der Kritiker des Chicago Tribune, merkt hierzu an, dies sei „eine billige Wahl, denn diejenigen, die, wie Lear, es nötig haben zu glauben, dass sie die Welt an ihren Fäden halten, entlarven sich selten durch die Vorliebe zu einem so offensichtlichen Text.“2
Aber Lear ist glücklich, und abgesehen von einer gewissen manischen Angst in seiner Gesamthaltung zeigt er keine Anzeichen des Alterns. Abgesehen von der ungeschickten Auswahl der Lieder ist es eine fesselnde Darstellung eines lieblosen, pedantischen Mannes, der zwar altert, aber noch sehr gesund ist: betört von seiner eigenen Macht, daran gewohnt, zu bekommen, was er will, immer und von jedem.
Nur wenige Augenblicke später fällt es Lear jedoch schwer, sich an die Namen seiner Schwiegersöhne zu erinnern – und als er nach Worten ringt, die ihm nicht einfallen wollen, steht auf seinem Gesicht ein Ausdruck des Entsetzens, während sich die Zerstörung der beginnenden Demenz offenbart. Es ist ein atemberaubender Augenblick. Doch ist es eine überzeugende Interpretation des Stückes? Die Regisseurin Barbara Gaines informiert uns im Programmheft, dass Lear von uns allen handelt, die wir entweder selbst altern, einen alternden Verwandten haben, oder auf die beides zutrifft. Im 4. Akt der 7. Szene beschreibt sich Lear selbst tatsächlich als „80 und mehr“ und gibt so sein Alter ziemlich exakt an. Yando sagte der Chicago Sun-Times jedoch, er spiele Lear „in meinem Alter, nicht 80-jährig“. Yando ist zu dem Zeitpunkt 58 Jahre alt. Was wir sehen, ist also eine extrem früh beginnende Demenz. (Dies passt schlecht zu der Art und Weise, auf die sich Yando in späteren Akten bewegt, mit dem Schlurfen eines sehr alten Mannes; doch wie dem auch sei – momentan geht es mir um den ersten Akt.) Also: ist es plausibel oder aufschlussreich, Lear als ein Stück über eine früh beginnende Demenz zu inszenieren?3
Zu tun, was Gaines und Yando tun, ist schon fast zu einem Klischee geworden: den Verfall und die geistige Hinfälligkeit in die Anfangsszene des Stückes zu verlegen. Tatsächlich wurde das Darstellungsmittel, die Namen zu vergessen, bereits von Plummer verwendet, obwohl ich nicht weiß, ob er es erfunden hat. R. A. Foakes, der Herausgeber der Arden-Ausgabe des Stückes, stellte in der Tat fest, dass es zu einem Markenzeichen der Inszenierungen in den 1990er-Jahren geworden ist, Altersschwäche gleich in der Eröffnungsszene des Stückes zum Thema zu machen: Es ist wahrscheinlich, dass Lear darin als „ein zunehmend bedauernswerter Alter“ erscheint, der „in einer gewalttätigen und feindseligen Umwelt gefangen“ ist.4 Die Popularität des auf diese Weise hervorgehobenen Altersthemas hat zu einer Flut von Inszenierungen des Stücks geführt, da seine mehr als nur ein wenig narzisstischen Zuschauer sich gerne mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigen, sei diese nah oder fern. Der Kritiker der Los Angeles Times, Charles McNulty, meldet in einem treffend formulierten Aufsatz Zweifel an der Weisheit dieses gesamten Trends an, den er auf plausible Weise dem Älterwerden der Generation der Babyboomer zuschreibt. Er erklärt, es könne an der Zeit sein, Versuche, das Stück zu inszenieren, generell auszusetzen.5
Also, was passt nicht an Yandos Gedächtnisverlust? Ein offensichtliches Problem ist, dass er im Text überhaupt nicht vorkommt. Erst als er in der Heidelandschaft steht, zeigt Lear ein seelisches Ungleichgewicht, und dann ist es eine Art „Wahnsinn“. Doch er passt, angesichts seiner sprachlichen Eloquenz und seiner Einsichten in die Natur der Menschen und ihrer Welt, gewiss nicht zu dem allzu bekannten Klischee der Alzheimer-Erkrankung. Eine sachgerechtere Kritik an Gaines – denn natürlich können und sollten Regisseure Dinge, die nicht direkt im Text vorkommen, in das Stück einfügen, wenn es dadurch anschaulicher gemacht wird – wäre in der Tat, dass dadurch, dass Lear von Anfang an in die Alzheimer-Schublade gesteckt wird, es ziemlich schwierig ist, den Lear der Eröffnungsszene mit dem zwar geistesgestörten, aber zutiefst einsichtsvollen Lear, der sich später zeigt, in Verbindung zu bringen. Dies ist ein Grund dafür, warum Yandos Darstellung dieser späteren Szenen die Zuschauer und Kritiker weniger beeindruckt hat als seine Darstellungsleistung in der Anfangsszene.
Im ersten Akt – und meine Betrachtung in diesem Essay beschränkt sich auf den ersten Akt – sind es Goneril und Regan, bei denen es sich nicht gerade um die vertrauenswürdigsten Zeugen handelt, die auf Lears Älterwerden eingehen – und zwar auf eine Weise, die nicht im Geringsten auf eine von Alzheimer verursachte Demenz hindeutet. Erstere sagt: „Du siehst, wie launisch sein Alter ist.“ (1.1.290) – aber sie bezieht sich darauf, dass er auf eine emotional unberechenbare Weise Cordelia enterbt, was, wie immer wir es erklären wollen, wohl kaum auf Demenz zurückzuführen ist. Letztere antwortet: „Es ist die Schwäche seines Alters: doch hat er sich von jeher nur schlecht gekannt.“ (294–95). Sie präzisiert daher den Altersbezug sofort durch eine Anspielung auf ein seit Langem bestehendes Problem – und dringt damit, wie wir sehen werden, zum Kern der Sache vor. Selbst die Töchter deuten nicht darauf hin, dass er an Demenz oder geistiger Schwäche leidet: höchstens an emotionaler Unbeständigkeit, und das, so vermuten sie, sei wahrscheinlich schon von jeher durch seinen Charakter verursacht worden.
Um zu erkennen, warum dies die angemessene Fragerichtung ist, betrachten wir Lears frühere menschliche Beziehungen, wie der erste Akt sie offenlegt. Gegenüber seinen Töchtern – selbst Cordelia, die er zu bevorzugen scheint – verhält er sich formell, kalt, dominierend, manipulativ. Er möchte starre Reden hören, die Unterordnung zum Ausdruck bringen. Was er mit Sicherheit nicht will, ist irgendeine Beteiligung an gegenseitiger Zuneigung.6 Was Freundschaft betrifft, gibt es nichts, was auch nur in die Nähe käme. Er hat weder eine Frau, noch erinnert er sich an die, die er irgendwann gehabt haben muss. In seiner Beziehung zu Kent – sowohl vor als auch nach seinem Fall – ist Lear der befehlende Herrscher, dazu entschlossen, Ungehorsam zu bestrafen, obwohl er (später) bereit ist, einen loyalen Untergebenen zu akzeptieren. Die einzige Beziehung, die die Möglichkeit von Freundschaft und Gegenseitigkeit bietet, ist diejenige zu dem Narren, dem (im Gegensatz zu den meisten wirklichen Hofnarren) königliche Macht gleichgültig ist. Es ist das Reifen dieser Beziehung im weiteren Verlauf des Stückes, das dazu führt, dass Lear als menschliches Wesen sichtbar oder sogar erst zu einem solchen wird.
Altern, Kontrolle und Selbsterkenntnis
Das größte Problem an einem Alzheimer-erkrankten Lear in der ersten Szene des ersten Aktes besteht darin, dass eine solche Darstellung uns hindert, eines der eindringlichsten Themen des Stückes zu verstehen: die Auswirkung plötzlicher Machtlosigkeit auf eine Person, die von ihrer eigenen Macht und eingebildeten Unverwundbarkeit vollkommen abhängig war. Denn Regan hat recht: Lear kannte sich selbst nicht und besaß noch nicht einmal ein grundlegendes Verständnis seiner eigenen Menschlichkeit. Er hatte sich als König für eine Art Gott gehalten, der alles und jeden kontrollieren könne. Daher ist er auf das Alter, das Kontrollverlust und Pflegebedürftigkeit mit sich bringt, schlichtweg nicht vorbereitet. Es ist schlecht für den eigenen Lebensweg in dieser Welt, wenn man glaubt, ein König zu sein; und wenn man einer ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich selbst nur oberflächlich kennt und also nicht versteht, dass man ein abhängiger und verletzlicher Mensch ist.
Janet Adelman, erkenntnisreich wie immer, sagt, was für Lear erschreckend sei, als er plötzlich erkennt, dass seine Töchter Macht über ihn haben, ist: „zu erkennen, dass er nicht nur auf erschreckende Weise von weiblichen Kräften außerhalb seiner selbst abhängig ist, sondern auch eine ebenso schreckliche Weiblichkeit in sich selbst“ trägt.7 Unter Weiblichkeit versteht sie Passivität, Nicht-Kontrolle und vor allem das Angewiesensein auf andere. Wie der Narr kurz darauf sagt, hat Lear seine Töchter zu seinen Müttern gemacht (1.4.163) und ist dennoch völlig unvorbereitet, ein bedürftiges Kind zu sein oder zuzugeben, dass er eins ist.
Man macht es sich viel zu einfach, wenn man Alzheimer hier zum Problem erklärt. Das ist eine Macht, die von außerhalb der Persönlichkeit zuschlägt. Es könnte jedem passieren und passiert jedem auf mehr oder weniger ähnliche Weise. Es hat nichts damit zu tun, wie man sein Leben bisher geführt hat, und die Krankheit lässt die eigene Identität in kurzer Zeit verblassen. Lears Problem besteht aber darin, dass er, während er immer noch er selbst ist, nämlich ein nörgelnder und manchmal gewalttätiger Mann, der es gewohnt ist, keine Beziehungen zu führen, in denen er nicht die Kontrolle hat, plötzlich feststellt, dass sich die Dinge in ihr Gegenteil verkehrt haben – und dass er auf Machtlosigkeit vollkommen unvorbereitet ist. Kontrolle macht aber seine Identität aus, weshalb die plötzliche Weigerung seiner Umgebung, ihn zu verehren und ihm zu dienen, das Innerste des Menschen trifft, der er zu sein glaubt. „Kennt mich hier jemand?“, fragt er (nach Gonerils hartem Einwand gegen sein Gefolge). Er meint, ihn zu kennen bedeute, seine totale Macht und sein Recht, zu tun, was er will, anzuerkennen. Aber er benutzt das königliche „Wir“ nicht mehr – und erkennt damit stillschweigend an, dass er an Autorität verloren hat. „Nein, das ist nicht Lear“, fährt er fort. „Wer kann mir sagen, wer ich bin?“ (1.4.217–21). In den dazwischen liegenden Zeilen sagt er von sich selbst: „Sein Kopf muss schwach sein, oder seine Denkkraft im Todesschlaf“. Kommentatoren interpretieren diese Zeilen auf plausible Weise so, dass er versucht sich selbst zu versichern, dass all dieses respektlose und ungehorsame Verhalten nur ein Traum sein könnte: „Ha, bin ich wach? Es ist nicht so.“ Allzu bald stellt er jedoch fest, dass Missachtung und Respektlosigkeit kein Traum, sondern Realität sind.
Keiner von uns ist auf Machtlosigkeit wirklich vorbereitet, aber Machtlosigkeit begegnet uns allen in verschiedenen Formen, wenn wir älter werden. (Am wenigsten betroffen sind vielleicht diejenigen, die tatsächlich an Alzheimer leiden, da sie bald nicht mehr wahrnehmen, was ihnen fehlt.) Aber für diejenigen, die ihre Identität durch die Kontrolle über andere definieren, kommt die Machtlosigkeit als verheerenderer Schock. Man kann nicht mehr sein, der man war, und dann muss man irgendeine andere Identität erfinden, eine andere Art, weiterzuleben. Yandos hervorragende Eröffnungssequenz zeigt einen Mann, der dieses Drama auf eine subtile und aufschlussreiche Weise hätte spielen können, indem er einen Machtverlust darstellt, der zu einer neuen Art der Suche nach dem Selbst führt. Die zweite Hälfte des Stückes zeigt den Beginn einer solchen Suche – allerdings erst, nachdem Lear durch den Zusammenbruch seiner früheren Identität teilweise verrückt geworden ist.
Solch eine quälende Suche stellte Yando tatsächlich dar, als er 2012 in der Chicagoer Inszenierung von Angels in America Roy Cohn, einen vergleichbaren Charakter, spielte, für die er verdientermaßen die höchste schauspielerische Auszeichnung Chicagos gewann. In Yandos Cohn, einer erfolgreicheren Gesamtleistung, und zwar ohne dass dem Publikum eine moralisierende Botschaft gefüttert wurde, sahen wir, wie sich der allmähliche körperliche Verfall und der bevorstehende Tod auf einen an totale Macht gewöhnten Mann auswirken (die Macht, andere zu verführen oder zu zerstören, die Macht, die Wahrheit zu schaffen und zu vernichten, eine schier körperliche Freude an der eigenen Destruktivität) – und die Ergebnisse faszinierten zutiefst, als wir schreckliche Angst, Boshaftigkeit und schließlich sogar einen Schimmer von Mitgefühl in der Seele eines bösartigen Mannes ohne Selbsterkenntnis umherwirbeln sahen.
Ich wünschte, Gaines hätte Yando erlaubt, Lear als Roy Cohn zu spielen. Dann hätten wir etwas über das Altern gelernt, statt ein sentimentalisiertes und verallgemeinertes Bild gezeigt zu bekommen, welches das Älterwerden zu etwas Mitleiderregendem macht und verwässert, statt zu dem moralischen Spiegel, der es in Wahrheit ist, und der moralischen Herausforderung, die es darstellt.
Nutzen und Missbrauch philosophischer Verallgemeinerungen
An dieser Stelle möchte ich mich einem Problem meines Berufes, der Philosophie, stellen. Die Philosophen lieben universale Verallgemeinerungen sehr, oft viel zu sehr. Nun, wenn wir nichts verallgemeinern würden, wären wir natürlich niemals in der Lage, etwas zu lernen oder andere zu unterrichten. Wenn die Vergangenheit jemals als Wegweiser für die Zukunft oder die Erfahrung einer Person für eine andere dient, dann deshalb, weil einige Arten von Verallgemeinerung nützlich sind. Nietzsche stellte fest, dass eine Spezies, die nicht verallgemeinern kann, schnell aussterben würde: Sie würde vor dem neuen Raubtier nicht davonlaufen, weil sie seine Ähnlichkeit mit einem vorigen nicht erkennen würde. Ferner widmen sich sämtliche Wissenschaften leidenschaftlich der Verallgemeinerung; doch sie prüfen auch immer wieder, welche der in einem konkreten Fall vorhandenen zahlreichen Faktoren ein Ergebnis wirklich erklären.
Unser Vergnügen an großen Werken der Literatur wie König Lear hängt ebenfalls mit Verallgemeinerung zusammen. Wenn wir annähmen, dass es sich bei der Geschichte von Lear lediglich um eine kuriose Begebenheit handelte, die sich tatsächlich einmal zugetragen hat, fände sie in uns nicht den Widerhall, den sie hervorruft. Wie Aristoteles sagt, ist die Dichtung „philosophischer“ als die Geschichtsschreibung, weil uns die Geschichtsschreibung sagt, dass dieses oder jenes Ereignis tatsächlich passiert ist, während uns Dramen Dinge vor Augen führen, „die [im Leben eines Menschen] passieren könnten“.8
Unser Interesse an Lear ist ein Interesse am Studium der allgemeinen Form menschlicher Möglichkeiten. Wir wollen Muster erkennen, die im Leben von Menschen, die uns wichtig sind, wiederkehren könnten.
Wir wissen allerdings nur zu gut, dass einige Formen der Verallgemeinerung die Realität verschleiern und den Fortschritt blockieren. Klischees über Frauen, ethnische Minderheiten, Muslime, Juden und andere benachteiligte soziale Gruppen waren eine wichtige Strategie, um ihre Unterordnung festzuschreiben. Im Jahr 1873 hat Myra Bradwell in Illinois ein Gesetz angefochten, das es Frauen verbot, als Anwältinnen zu praktizieren (was sie in Iowa bereits taten). Myra Bradwell hatte bereits ein juristisches Studium und eine praktische Ausbildung absolviert und praktizierte de facto als Anwältin, erhielt jedoch in Illinois keine Zulassung. Der Oberste Gerichtshof, der dieses Verbot der juristischen Praxis von Frauen aufrechterhielt, bot einige, durch religiöse Frömmigkeit gestützte Stereotypen auf: „Die natürliche und angemessene Ängstlichkeit und Zartheit“, die das weibliche Geschlecht auszeichneten, machten es „für viele Berufe des bürgerlichen Lebens offenbar untauglich (…). Das vorrangige Los und die Mission der Frau“ bestehe darin, „die edlen und huldvollen Ämter einer Frau und Mutter zu übernehmen“. Das sei „das Gesetz des Schöpfers.“9 Richter Bradley ging so weit, einzuräumen, dass es viele Frauen gebe, die unverheiratet seien und daher als Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel angesehen werden könnten. (Myra Bradwell war verheiratet.) Er gelangte jedoch zu dem Schluss, dass das Gesetz „an die allgemeine Verfassung der Dinge angepasst“ werden müsse und „nicht auf Ausnahmefällen beruhen“ dürfe.
So etwas passiert ständig, besonders bei Gruppen, die über weniger Macht verfügen. Eine beschreibende Verallgemeinerung wird vorgebracht, ohne Beweise und sogar angesichts deutlicher Gegenbeweise, und wird dann als Vorwand benutzt, Konformität durchzusetzen. Alternde Menschen, die schon lange Opfer abwertender Stereotypen sind, sollten, wie ich in einem anderen Kapitel noch ausführen werde, bei jeglichen Verallgemeinerungen misstrauisch sein. Da wir so wenig darüber wissen, was außergewöhnlich ist und was nicht, und da sich unser Wissen ständig ändert, scheint es besonders angebracht zu sein, sich in demütiger Weise auf spezielle Fälle zu beschränken.
Was sollte ein Philosoph also tun? Erstens sollten wir zwischen normativen und deskriptiven Verallgemeinerungen unterscheiden. Bei meinen Ausführungen über Lear habe ich auf eine Weise normativ verallgemeinert, die seit Platon und Aristoteles in der Ethik geläufig ist. Diese Lebensmuster sind tugendhaft und andere unmoralisch. Diese Art von Leben gedeiht und diese weniger. Menschen, die gerne andere kontrollieren – eine an sich problematische Eigenschaft –, werden mit zunehmendem Alter mit besonderer Wahrscheinlichkeit unangenehme Überraschungen erleben. Und diese Überraschungen, wie zum Beispiel der Verlust von Liebe und Verbundenheit, sind menschlich bedeutsam. Sie geben allen von uns Gründe – auch wenn sie bislang noch anfechtbar sind – nicht zu versuchen, so zu leben.
All das scheint in Ordnung, solange Arroganz nicht an die Stelle von Dialog tritt. Wir alle benötigen Ideale und Ziele, und normative Verallgemeinerungen sind unerlässlich, wenn wir darüber nachdenken, welche Möglichkeiten und Chancen für Menschen wirklich wichtig sind. Eine Theorie der Menschenrechte oder verfassungsmäßigen Freiheiten ist höchst allgemein, eine Form normativer Verallgemeinerung, doch das scheint so in Ordnung, weil Menschen durch Rechte nicht zu Konformität gezwungen, sondern ihnen stattdessen bestimmte geschützte Möglichkeiten gegeben werden. Das ist der Weg, den ich in Kapitel 7 einschlagen werde, wo es um wirtschaftliche Ungleichheit im Alter gehen wird. Ich werde dafür argumentieren, dass bestimmte „Fähigkeiten“ – wichtige Möglichkeiten – für alle Bürger von so zentraler Bedeutung sind, dass sie den Status verfassungsmäßiger Garantien haben sollten.
Wir sollten jedoch vorsichtig sein, wenn die normative Theorie auf einer übertriebenen oder dubiosen deskriptiven Verallgemeinerung beruht, und es ist im Bereich deskriptiver Verallgemeinerungen, dass Stigmatisierung und Diskriminierung mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit unser Urteil verzerren. Richter Bradley gelangte zu der normativen Schlussfolgerung, dass es für Frauen schlecht sei, als Anwältinnen zu arbeiten, weil er bereits von bestimmten stark verallgemeinerten, deskriptiven Behauptungen überzeugt war, wie etwa: Nur wenige Frauen können als Anwältin arbeiten. Die meisten Frauen wollen Ehefrauen und Mütter sein. Ehefrauen und Mütter können keine Anwältinnen sein. Wenn sie lernen, wie ein Anwalt zu argumentieren, macht Frauen dies Männern ähnlich und schlechter geeignet für die Ausführung ihrer familiären Aufgaben. Wie wir inzwischen wissen, ist jede dieser Behauptungen falsch.
Aber ausdrücklich die Falscheste ist – wie wir jetzt sehen – die Behauptung, dass es nur einen einzigen „Weg“ geben soll, der für Frauen bestimmt ist. Dies ist das Leben einer Frau, so hat ihre Lebensgeschichte auszusehen. Es ist gleichgültig, dass Sie, Myra Bradwell, eine verheiratete Anwältin, etwas anderes machen: Wir schieben das beiseite. Nein, wir behaupten einfach, dass Frau und Mutter zu sein, und nur das, die richtige Beschreibung der Rolle einer Frau ist. In diesem Fall ist das Beharren auf alternativlosen Beschreibungen keineswegs unschuldig, wenn es um versteckte oder nicht so versteckte normativen Ideen geht: So wollen wir (Männer), dass Frauen sind; dies ist es, wozu wir sie machen wollen.
Selbst in einer wohlwollenden und vollkommen nicht-normativen Form wirkt ein solcher einziger „Weg“ wie eine absurde Lüge, sobald Frauen das Recht beanspruchen, ihr eigenes Schicksal zu wählen und Individuen zu sein. Kürzlich besuchte ich eine Darbietung des eindringlichen Liederzyklus Frauenliebe und -leben von Schumann. Diese Geschichte einer „Frau“ ist eine singuläre und einfache Geschichte: Sie verliebt sich, sie bekommt einen Heiratsantrag, sie nimmt ihn an, sie heiratet, sie hat erst Angst vor Sex und ist dann glücklich, sie hat ein Baby, und sie erlebt dann durch den Tod ihres Mannes tiefe Trauer (da ein romantischer Liederzyklus traurig enden muss). Die Geschichte erscheint heute als lächerlich, wenn auch rührend. Die Aufführung, die ich besuchte, unterschied sich durch den sehr interessanten Umstand, dass die Lieder untypischerweise von einem Bariton gesungen wurden. (In der Welt der Lieder haben Frauen in der Regel Transgender-Privilegien, Männer jedoch nicht: Eine Sopranistin kann die Winterreise singen, aber Männer singen diesen „weiblichen“ Zyklus im Grunde nie.) Und dieser männliche Sänger leitete, ohne auch nur eine Pause zu machen, direkt in die gleichfalls bekannte männliche Lebensgeschichte über und sang Schumanns Dichterliebe. Wie in mehr als einem romantischen Liederzyklus ist die männliche Lebensgeschichte ebenfalls stereotypisch und einfach, wenn auch anders als die weibliche: Er verliebt sich, er gewinnt ihre Liebe, ihre Eltern protestieren jedoch, weil er arm ist; sie verheiraten sie mit einem reichen Mann und sie fügt sich der Entscheidung. Also geht er fort, irrt umher und stirbt schließlich. Die Fragen, die Matthias Goernes kühne, beide Geschlechter umfassende Aufführung uns stellen ließ, lauteten: Wessen Geschichte gehört wem? Ist eine dieser Geschichten die Geschichte einer konkreten Person? Sind beides nicht symmetrische Lügen, wenn auch von großer Schönheit? Niemand in diesem Publikum wurde von den deskriptiven Stereotypen getäuscht, und wir wurden eingeladen, sie als zwei ihrem jeweiligen Ort und ihrer jeweiligen Zeit verhaftete Geschichten anzusehen, aber gewiss nicht als Geschichten konkreter Personen in Vergangenheit oder Gegenwart. (Schumann selbst hatte ein glückliches Leben, bis er vorzeitig an den Komplikationen einer unbehandelten bipolaren Störung starb; seine geliebte Frau Clara war eine der begabtesten Pianistinnen und Komponistinnen der Geschichte sowie eine kompetente Geschäftsfrau, die die Hauptverdienerin der Familie war und ihre eigenen Konzertreisen mit viel Geschick organisierte. Das Einzige, was aus dem Zyklus über das Leben einer Frau auf sie zutrifft, ist, dass sie ihn überlebt hat – um 40 Jahre!)
Das Problem mit Erzählungen über das Altern ist, dass es bislang zu wenige von ihnen gibt, um uns die große Vielfalt im Alterungsprozess aufzuzeigen, also zu wenige, um uns so skeptisch zu machen, wie wir es Halbwahrheiten gegenüber sein sollten. Aristoteles’ Vorstellung der Tragödie war es nicht, dass eine von ihnen uns sämtliche menschlichen Möglichkeiten aufzeigt. Wie könnte sie das leisten? Seine Ansicht ist, dass uns stattdessen jede Tragödie einige menschliche Möglichkeiten veranschaulicht. Wenn wir uns daher immer wieder neue Tragödien anschauen (wie es die Griechen taten, und zwar jedes Jahr ziemlich viele), werden wir unser Verständnis der menschlichen Möglichkeiten erweitern und die Vielfalt der möglichen Interaktionen zwischen Charakteren und Umständen verstehen. Wir müssen also die Suche nach Erzählungen über das Älterwerden fortsetzen, um unser Verständnis zu erweitern.
Aber im Prinzip verstehen das die meisten von uns, wenn sie sich mit literarischen Werken beschäftigen. Lear verführt Menschen nur zu unklugen Verallgemeinerungen, weil es sich um ein Stück von Shakespeare handelt und weil es nur relativ wenige große literarische Werke über das Altern gibt. Aber wenn jemand wie ich sagt: „Halt: Lear ist ebenso wenig ein Durchschnittsmann wie Kleopatra eine Durchschnittsfrau ist“, werden die Leser dem wahrscheinlich zustimmen und bedenken, dass wir in den meisten Fällen innerhalb der literarischen Kategorien von Menschen – Frauen, Männer, Jugendliche, Könige und so weiter – eine große Vielfalt anerkennen. Zum Beispiel erkennen wir leicht eine zentrale Tatsache von Shakespeares historischen Dramen, die jeder Bürger in einer erblichen Monarchie kennt: Könige erfahren ihr Königsein und spielen ihre Rolle auf sehr unterschiedliche Weise, mit gewichtigen Konsequenzen für Millionen von Menschen.
Wenn wir uns den Werken der Philosophie zuwenden, eröffnet sich ein viel schwierigeres Problem. Philosophen sind keine kreativen Künstler, die eine Geschichte nach der anderen schreiben. Sie sind auch keine Historiker, die über die verschiedenen Ereignisse berichten, die tatsächlich stattgefunden haben. Sie sind durch und durch Generalisten. Wir sind nicht überrascht, dass Cicero nur ein Werk mit dem Titel Über das Altern schrieb, dass Simone de Beauvoir (1908–1986) ebenfalls nur ein Buch über das Altern schrieb, wenn auch ein wesentlich umfangreicheres. Gewiss: Philosophen greifen Themen wiederholt auf, aber sie schreiben normalerweise nicht einen Text nach dem anderen mit dem einfachen Ziel, die menschliche Vielfalt innerhalb eines Themas auszuleuchten. Diese Singularität der Aussage kann eine Tugend sein, kann klären und klassifizieren, aber sie kann auch eine Gefahr darstellen.
Altern ist offensichtlich ein Thema, bei dem Verallgemeinerungen mit Gefahren verbunden sind. Erstens gibt es, sogar in einem noch wesentlich höheren Maße als im Kindes- oder Jugendalter, viele unterschiedliche Lebensgeschichten. Manche Menschen sind gesund bis in die Neunziger; andere befallen schon viel früher gefährliche oder tödliche Krankheiten. Manche Menschen werden nicht dement, obwohl sie ihr hundertstes Lebensjahr überschritten haben. Andere erkranken bereits in den Fünfzigern an einer Demenz. Darüber hinaus existieren viele verschiedene Arten von Demenz. Manche Menschen können zwar geistige Arbeiten ausführen, aber ihren Weg von A nach B nicht finden. Bei anderen ist der Rückgang der geistigen Fähigkeiten umfassender. Dann gibt es so viele charakterliche Unterschiede, wie uns der Fall Lears zeigt; und wie wir noch sehen werden, haben wirtschaftliche und soziale Umstände (Armut oder Wohlstand, erzwungene Pensionierung oder fortgesetzte Arbeit) einen großen Einfluss auf die Gesundheit, das Gefühlsleben und die allgemeine Produktivität. In diesem Buch versuchen Saul und ich unseren Lesern diese unterschiedlichen Wege aufzuzeigen, da sowohl Individuen als auch Gesellschaften Entscheidungen treffen müssen, während die Bevölkerungen altern.
Zweitens ist das Älterwerden, wie wir noch oft sagen werden, Gegenstand einer weit verbreiteten, ja praktisch universalen sozialen Stigmatisierung. Die Sozialgeschichte des Alterns ist beladen mit Klischees, von denen die meisten alternde Menschen herabwürdigen, indem sie ihnen Hässlichkeit, Inkompetenz und Nutzlosigkeit zuschreiben. Diese Stereotypen dringen auch in das Bewusstsein der alternden Menschen selbst ein und verfälschen ihre Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung. Man denke an Myra Bradwell. Zu ihren Lebzeiten glaubten die meisten Menschen, einschließlich der meisten Frauen, dass Frauen, und vor allem jene, die verheiratet sind, nicht Anwältin sein könnten. Heute glauben fast alle zum Mittelstand gehörenden weißen und asiatischen Frauen, dass sie, auch wenn sie verheiratet sind, selbstverständlich Anwältinnen sein können, wenn sie hart arbeiten und über ein akademisches Talent verfügen, und praktisch sämtliche juristischen Fakultäten und Anwaltskanzleien stimmen ihnen zu. In dem Maße, in dem afro- und lateinamerikanische Frauen diese Selbstwahrnehmung nicht teilen, lässt sich dieser Unterschied auf irrige ethnische Vorurteile zurückführen, die bei potenziellen Arbeitgebern allmählich verschwinden, wenn auch etwas langsamer als aus der Mentalität möglicher Aspiranten. Wie könnten, da die modernen Gesellschaften gerade erst damit begonnen haben, ihre Vorstellungswelt hinsichtlich des Alterns neu zu bewerten, jegliche Verallgemeinerungen frei vom Einfluss von Stereotypen sein?
Und endlich ist eines der unheilvollsten aller Klischees über alternde Menschen, dass sie über keine Handlungsmacht verfügten, dass sie nur Opfer des Schicksals seien. Natürlich spielt das Schicksal eine Rolle, und normalerweise wissen wir nicht, wo oder wann. Aber es gibt auch viel Raum für aktive Entscheidungen, wie uns die Geschichte Lears mit ihren schlechten Entscheidungen und deren noch schlimmeren Folgen ermahnt. Wenn man alternden Menschen durch die Art, wie man sie beschreibt, ihre Handlungsmacht und Entscheidungsfreiheit raubt, entmenschlicht und objektiviert man sie auf eine besonders beleidigende Weise.
Wie könnte ein Buch über das Altern dem Problem der unklugen deskriptiven Verallgemeinerung entgegentreten, wenn nicht durch die Betrachtung einer kaleidoskopischen Vielfalt von Werken? Ein Weg bestünde darin, Literatur und Geschichte (und empirische Daten, wo solche existieren) dazu zu verwenden, eine Palette von Beispielen zu liefern, die dann auf ihre möglichen Gemeinsamkeiten untersucht werden könnten. Ein anderer Weg wäre das Schreiben in Dialogform, sodass die Schlussfolgerungen einem bestimmten Charakter oder bestimmten Charakteren und nicht unbedingt dem Autor zuzuschreiben wären. Die Versuchung der vorschnellen Verallgemeinerung geistert jedoch durch beide von mir angeführten Werke, welche die einzigen bedeutenden philosophischen Abhandlungen der abendländischen Tradition über unser Thema sind.
Auf den Text von Cicero werde ich in Kapitel 3 genauer eingehen. Cicero sieht das Problem und geht bis zu einem gewissen Punkt sehr gut darauf ein. Über das Altern ist voll von lebhaften Diskussionen über die Vielfalt der Reaktionen auf das Altern. Das Buch verwendet die Dialogform, um die Grenzen der darin zum Ausdruck gebrachten Verallgemeinerungen zu kommentieren: Cato wird behutsam für einige seiner Besessenheiten bespöttelt (zum Beispiel, was die Förderung der Gesundheit durch Gartenarbeit betrifft). Doch ich werde behaupten, dass Ciceros Briefe uns viel mehr vom wirklichen Wesen und der Vielfalt des Alterns zu erkennen geben, von Komplexitäten, die die Abhandlung aus dem Blickfeld fernhält.
Als meinem Paradebeispiel für die Gefährlichkeit philosophischer Verallgemeinerungen möchte ich mich nunmehr jedoch Beauvoirs La Vieillesse zuwenden (das ins Englische irreführend mit The Coming of Age übersetzt wurde, obwohl es lediglich Das Alter bedeutet).10 Das Buch wurde 1970 veröffentlicht. 1974 folgten ihm Gespräche, die schließlich als Les Adieux veröffentlicht wurden, wobei es sich um eine Reihe von Dialogen mit Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) handelt. (Ins Deutsche übersetzt als Die Zeremonie des Abschieds und Gespräche mit Jean-Paul Sartre.)11
Das Alter ist ein sehr umfangreiches Buch: In der englischen Übersetzung hat es 585 Seiten, im Gegensatz zu Ciceros prägnantem Text von etwa 50 Seiten. Wie in Das andere Geschlecht stellt Beauvoir gern alle möglichen Beispiele aus Literatur und Geschichte zusammen, die sie nicht besonders gut sortiert, was einen chaotischen Eindruck machen kann. Doch wie in jenem berühmten Buch liefert sie auch in Das Alter jede Menge nützliche Informationen. Der erste Teil des Buches ist wertvoll, da er empirische Tatsachen über das tatsächliche Leben alternder Männer und Frauen in Frankreich liefert, speziell solcher, die nicht wohlhabend sind, und insbesondere über die deprimierenden Bedingungen in Pflegeheimen.
In der zweiten Hälfte des Buches wendet sich Beauvoir der subjektiven Erfahrung des Alters zu.12 Wie die finnische Philosophin Sara Heinämaa in einer überzeugenden und einsichtsvollen Interpretation ausführt, lehnt sie sich eng an die phänomenologische Methode Edmund Husserls an, die den Philosophen bei der Suche nach wesentlichen Verallgemeinerungen auf die Introspektion verweist. Das man jemandem etwas zu verdanken hat, ist jedoch keine Entschuldigung. Husserls Methode mag einige Phänomene sehr gut beleuchten, aber es muss dennoch gefragt werden, ob sie sich auf dem Gebiet des Alterns, einem wahren Minenfeld von Gefahren, ebenfalls bewährt. Ich werde meine Schlussfolgerung im Voraus verkünden: Dies ist eines der groteskesten berühmten philosophischen Werke, die ich jemals gelesen habe. Es ist grotesk aus allen drei Gründen, die ich angeführt habe: Es tritt die Vielfalt mit Füßen, es wertet kontingente und abfällige Klischees auf, und es beraubt alternde Menschen ihrer Handlungsfähigkeit.
Beauvoir hat darüber, wer ich bin, das Folgende zu sagen. (Sie gibt nicht genau an, über welches Alter sie spricht, aber die Analyse in Teil I scheint mit dem 65. Lebensjahr einzusetzen, dem Alter, in dem man traditionellerweise zum Eintritt in den Ruhestand gezwungen wurde.) Altern ist weder graduell noch fortschreitend: Es kommt in Form einer plötzlichen Erkenntnis. Der grundlegende Inhalt dieser „Überraschung“, „Metamorphose“ oder „Offenbarung“ ist, dass sich die Art und Weise, wie man früher von anderen erlebt wurde, eine Art und Weise, die Teil der eigenen subjektiven Identität geworden ist, plötzlich dramatisch zum Schlechteren verändert hat. Auf einer Ebene mag man sich innerlich noch jung fühlen, doch indem man plötzlich die Geringschätzung der Gesellschaft wahrnimmt, erlebt man eine dramatische subjektive Veränderung, da dieses Gesehenwerden auch ein Teil dessen darstellt, wer man subjektiv ist.
Machen wir hier eine Pause. Woher stammt die Plötzlichkeit? Vielleicht denkt sie an eine erzwungene Pensionierung, die die soziale Bedeutung eines Menschen gewiss plötzlich verändern kann, doch dies ist ein rein zufälliges Phänomen, und wohl kaum eines, das uns das Wesen von irgendetwas erschließt. Und warum, so würde ich gerne wissen, sollte ich es einer französischen Philosophin, die sieben Jahre jünger ist, als ich es jetzt bin (69), erlauben, mir den Sinn meines Lebens als Philosophin im 21. Jahrhundert mitzuteilen? Ich erkenne meine eigenen Erfahrungen darin überhaupt nicht wieder, ebenso wenig wie die meiner Freunde in ähnlichem Alter. Dies liegt zum Teil daran, dass sich viele Dinge verändert haben, da wir ein besseres Verständnis von Gesundheit und Ernährung entwickeln. Doch es ist auch so, dass es schon immer eine große Mannigfaltigkeit gab. Beauvoir beansprucht eine wesentliche Einsicht, indem sie versucht, mich dazu zu bringen, zu sagen: „Oh je, so muss ich mich fühlen, ob es mir bewusst ist, oder nicht.“ Verzeihung: nein. Es tut mir leid, dass sie nicht glücklich ist, aber warum sagt sie nicht einfach: „Ich mache folgende traurige Erfahrungen?“ Was mich selbst betrifft, so fühle ich mich gesund und kräftig, und ich wurde wahrscheinlich nie mehr bewundert als jetzt, obwohl ich zugeben muss, dass mir nicht mehr so viel an der Ehrerbietung anderer liegt, wie mir nach Beauvoir daran liegen müsste.
Richter Bradley würde sagen: „Aber Martha, Hillary und ein paar andere sind Ausnahmefälle, wir können Gesetze nicht auf Ausnahmen gründen.“ Es tut mir leid, ich lehne das vollkommen ab. Die meisten Menschen meines Alters, die ich kenne, sind kraftvoll und stehen mitten in sie umfassend beanspruchenden Lebensaktivitäten, seien es solche meiner Art oder nicht. Natürlich wurden einige von Krankheiten heimgesucht, aber das kann in jedem Alter passieren, wie Cicero zu Recht bemerkt. Beauvoirs Wesensbehauptungen verraten nicht nur eine irritierende Neigung der Franzosen, anderen Menschen zu sagen, worin die richtige Art und Weise besteht, dies oder jenes zu sein (eine Frau, ein Bürger).13 Sie haben ein tieferes Problem. Zufälligerweise entsprechen sie nur allzu gut bekannten abfälligen Klischees der Gesellschaft, und mittlerweile, da es jetzt genug alternde Menschen gibt, die diese Stereotypen in Frage stellen, beginnen wir sie als das zu erkennen, was sie sind. Geteilte Erfahrungen bestärken sich gegenseitig, und die Generation der Babyboomer hat sich schlicht geweigert, sich durch diese Fiktionen von gestern definieren zu lassen.
Ich halte ihr Buch daher für noch schlimmer als nur grotesk: Ich sehe es als einen Akt der Zusammenarbeit mit sozialer Stigmatisierung und Ungerechtigkeit. Es ist, als ob ein Jude ein Buch schreiben würde, welches behauptet, das Wesen der Juden bestehe darin, dass sie das Leben als körperlich schwache, unheroische, zu Kreativität unfähige Wesen erleben, die lediglich zu niederträchtigen Intrigen, nicht aber zu tiefen Einsichten fähig sind. Doch halt: Das Buch wurde bereits geschrieben – von Otto Weininger! Weiningers Geschlecht und Charakter (1903) war einst die Bibel der europäischen Intellektuellen, und die Tatsache, dass er selbst Jude war, veranlasste viele Menschen dazu, ihm zu glauben, als er ihnen das Wesen der Juden erklärte. Dennoch handelt es sich um ein Stück grotesker Propaganda. Man könnte sich auch ein Buch eines Afroamerikaners vorstellen, der sagt, Afroamerikaner erlebten sich selbst als im Wesentlichen gewalttätig, bereit zu vergewaltigen und zu töten. Nochmals halt: Auch dieses Buch wurde bereits, zumindest teilweise, geschrieben, und zwar in dem Abschnitt der Autobiographie des Richters Clarence Thomas, in dem er zugibt, dass er sich mit Richard Wrights gewalttätigem Helden Bigger Thomas identifiziert.14 Kurzum: Wir sollten Verallgemeinerungen nicht einfach deshalb glauben, weil ihr Autor zur stigmatisierten Gruppe gehört. Solche Beschreibungen können durch „adaptive Präferenzen“ oder sogar durch Selbsthass beeinträchtigt werden.
Das dritte und größte Problem mit Beauvoirs behaupteten Einsichten in das Wesen des Alters ist ihr düsterer Fatalismus, der der alternden Person keinerlei Handlungsfähigkeit zugesteht. Das Alter kommt als eine Metamorphose. Es stößt einem einfach zu. Ciceros Gesprächspartner Cato ist viel scharfsinniger: Er sieht ein, dass man sich in gewisser Weise sein Schicksal schafft, durch die eigene Disziplin, regelmäßiges körperliches Training, Ernährung, Lesegewohnheiten, Gespräche und Freundschaften. Selbst der alternde Körper ist keine rein faktische Gegebenheit: Er umfasst vielmehr eine Reihe von Möglichkeiten, die man auf viele verschiedene Arten verwirklichen kann. Wenn Menschen älter werden, müssen sie möglicherweise regelmäßiger trainieren, um das gleiche Maß an Muskelfitness zu erhalten. Aber diese Idee, die bereits Cato hatte, unterscheidet sich völlig von Beauvoirs Vorstellung eines einheitlichen Schicksals, das jeder passiv erleidet. Natürlich kann man sich nicht unsterblich machen, aber man kann viel tun, um glücklicher, kräftiger und aktiver zu sein.
Das Absprechen von Handlungsfähigkeit bringt möglicherweise eine eigenartige europäische Lebenseinstellung zum Ausdruck, ebenso wie meine Betonung von Arbeit und körperlichem Training sehr amerikanisch ist. Aber auch diese Beobachtung bezichtigt dieses die Wahrheit entstellende Buch der Lüge. Wenn sie einfach gesagt hätte: „Als Französin einer bestimmten Epoche wurde ich dazu erzogen, so und so zu denken“, könnte ich ihr kaum etwas vorwerfen – obwohl mir auffällt, dass selbst in Frankreich Frauen in meinem Alter nicht mehr eine solche Einstellung zu haben scheinen. Was mich betrifft, so bin ich froh, dass ich in einem Land lebe, in dem, wenn man mit einer Laufverletzung zu einem Physiotherapeuten geht, dieser einem nicht sagt: „Sie sind zu alt, um zu laufen“, sondern „Sie machen zu wenig Grundtraining, und wie wäre es mit einer Kräftigung der Fußgelenke?“ Trotzdem, hätte sie ihre Erfahrung einer ungerechten Hintergrundkultur zugeschrieben, hätte ich mich kaum beschweren können. Wenn sie hingegen vorgibt, mir zu sagen, wer ich bin und wie ich mein Leben wahrnehme, muss ich dem Beispiel jener Muslime folgen, die gegen Terrorakte protestiert haben, und antworten: „Nicht in meinem Namen.“
Beauvoir sieht einen schmalen Weg der Handlungsfähigkeit – jedoch nur für einige Menschen. „Es gibt nur eine Lösung, wenn das Alter keine lächerliche Parodie unserer früheren Existenz sein soll, und die besteht darin, weiterhin Ziele zu verfolgen, die unserem Leben einen Sinn geben: die Hingabe an Individuen, an Gruppen, an gute Zwecke sowie an soziale, politische, intellektuelle oder kreative Arbeit“. Diese Beschreibung scheint es den meisten Menschen, ja allen, die nicht an einer schweren Demenz leiden, zu ermöglichen, einen Weg zur Ausübung ihrer Handlungsfähigkeit zu finden. Und sie fügt hinzu, dass eine Art, eine Zukunft zu haben, darin besteht, einen Beitrag für zukünftige Generationen zu leisten. In Das Alter gibt es jedoch bereits Hinweise darauf, dass sie diesen Ausweg nur als Möglichkeit für außergewöhnliche Menschen wie Künstler und Denker sieht. „Das Leben der Mehrzahl alter Menschen ist unfruchtbar, und sie verbringen es in Isolation, Wiederholung und Langeweile.“15 Ihre Position wird in der Zeremonie des Abschieds noch klarer. Sartre vertritt die Position, dass Menschen durch jede Art von kooperativer Aktivität einen politischen oder sozialen Beitrag zu künftigen Generationen leisten können. (Er bestreitet, dass Künstler und Intellektuelle einen derartigen Beitrag leisten: Ihre Werke, so behauptet er, seien auf persönliche und nicht auf gesellschaftliche Ziele gerichtet.) Beauvoir besteht darauf, dass eine die Generationen überschreitende Zukunft nur für außergewöhnliche Persönlichkeiten wie Künstler und Intellektuelle möglich ist.16
Ich würde sagen, dass beide sich unverantwortlicher Verallgemeinerungen schuldig gemacht haben: Beauvoir durch die persönliche Bedeutung, die sie intellektueller Arbeit beimisst, Sartre dadurch, dass er politischem Handeln so verhaftet ist. Beide sind in ihrer abgehobenen Art des Bohémiens kurzsichtig. Keiner von beiden glaubt, dass die Unterstützung der Erziehung von Kindern und Enkelkindern ein sinnvoller Weg ist, etwas zur Welt beizutragen. (Sie lehnt die Idee brüsk ab, er erwähnt sie nicht einmal.) Und wie steht es um generationenübergreifende Freundschaften mit jüngeren Kollegen, mit Studenten, den Kindern und Enkeln anderer Menschen? Was ist mit der Sorge um den Planeten und nichtmenschliche Tiere? Was ist mit der Arbeit, die weniger außergewöhnliche Menschen regelmäßig in alle möglichen wertvollen Projekte, an die sie glauben, investieren: durch ehrenamtliche Arbeit und Fundraising während ihres Lebens oder in Form von Vermächtnissen nach ihrem Tod? In Kapitel 8 werde ich auf Altruismus eingehen, aber es scheint höchst seltsam, dass sie diese Fälle nicht berücksichtigen. Vielleicht schien es einfach zu kapitalistisch auf dem Sterbebett ein Gespräch über Geld zu führen.
Was lernen wir aus diesen traurigen Texten, die den Lesern (ohne Anzeichen von Selbstzweifel oder Ironie) auf eine empörende Weise sagen, dass es unser Wesen ist, traurig zu sein? Und die dadurch so viele weniger hochbegabte Menschen beleidigen? Ich denke, ich würde sagen, dass wir Philosophen lernen, uns vor dem Schreiben, besonders über das Altern, die folgenden Worte ins Gedächtnis zu rufen: Erinnere dich, Philosoph, dass deine Erfahrung nur deine ist. Also lerne. Sei neugierig auf andere Menschen. Frage sie, wie sie das Leben erfahren, bevor du ihnen einen Vortrag darüber hältst, wie sie das Leben seinem Wesen nach erfahren müssen. Sei darauf vorbereitet, Sinnhaftigkeit in Lebensweisen zu erkennen, die anders sind als deine eigene. Respektiere Vielfalt.
Und auch: Sei vorsichtig, damit deine eigenen Verallgemeinerungen nicht durch gesellschaftliche Vorurteile und Stigmatisierungen deformiert werden – einschließlich der Vorurteile der akademischen Subkultur gegenüber Nicht-Intellektuellen und Geldverdienern.
Demut hilft. Ein Sinn für Humor ebenfalls. Hüte dich vor Philosophen, denen diese Eigenschaften fehlen, sogar – und insbesondere – dann, wenn sie dir sagen, dass sie wichtig genug sind, um dir zu sagen, wie du dich fühlen solltest. Ist das alles nicht König Lear allzu ähnlich, der seinen Töchtern vorschreibt, wie sie ihn zu lieben haben?
Güterverteilung, Enterben und die Kosten der Pflege seit Lear
Saul
Die Tragödie von König Lear setzt mit der Thematik des Alterns ein und geht dann bald zu den Themen Verteilen, Enterben und schließlich zum Thema der Reue über. Das eigene Vermögen anderen zu hinterlassen, kann durch Gefühle und Bedenken belastet sein und das noch stärker, wenn man sich entscheidet, seine materiellen Güter den Mitgliedern der Familie nicht anteilig weiterzugeben. Der Elternteil oder sonstige Wohltäter werden sich wahrscheinlich mit der Entscheidung und der Frage, wie sie ausgelegt werden wird, intensiv auseinandersetzen. Die Begünstigten, ob sie den Erbteil nun akzeptieren oder darüber verärgert sind, müssen mit den Konsequenzen leben. Dies sind wichtige Themen für alternde Menschen und insbesondere für solche Personen, die das Glück haben, Vermögenswerte verteilen oder empfangen zu können. Lear war weder der erste noch der letzte fiktive oder reale Mensch, der glaubte, dass Liebe, oder gar Liebesbezeugungen, Teil des Verteilungsschlüssels sein sollten. Er hat Reichtum und Macht zu verteilen, und das sind Vermögenswerte, die nicht leicht aufzuteilen sind. Außerdem hat Lear eine unverheiratete Tochter und zwei weitere, die mit machthungrigen Männern verheiratet sind. In der heutigen Zeit hat sich dieser Aspekt des Verteilungsproblems von Kindern in unterschiedlichen Familiensituationen hin zu einem bei Nachkommen in ungleichen wirtschaftlichen Verhältnissen verschoben, ganz zu schweigen von solchen in Patchworkfamilien. Manchmal bedingen sich diese Unterschiede gegenseitig, da unterschiedlich viele Enkel verschiedene wirtschaftliche Umstände zur Folge haben. Ein Großelternteil könnte etwa bei der Bezahlung von Studiengebühren helfen wollen, erwachsene Kinder könnten es jedoch als ungerecht empfinden, dass ein Geschwisterteil, das sich dafür entschieden hat, viele Kinder zu haben, den Großteil ihres potenziellen Erbes genießt. Anderen wiederum könnte missfallen, dass ein Vermögen zugunsten von Stiefenkelkindern, die in Geldübertragungen oder Vermächtnisse mit aufgenommen wurden, in allzu kleine Teile zerlegt wird. Dasselbe gilt für die Berufswahl sowie für Entscheidungen über Anteile an einem Familienunternehmen und Möglichkeiten, darin Arbeit zu finden. Wenn wirtschaftliche Umstände mehr auf Entscheidungen als auf Zufälle zurückgeführt werden, gibt es oft ernsthafte Reibereien, ähnlich wie Lear und seine Familie auf den Kopf gestellt wurden, nachdem er die wirtschaftlichen Umstände seiner Töchter von ihren Antworten auf seine Forderung abhängig gemacht hat, ihm ihre Liebe zu bezeugen. Im Gegensatz zu Lear gehen die meisten von uns an Entscheidungen über Verteilungen innerhalb der Familie mit einer Denkweise heran, bei der wir um Gleichbehandlung bemüht sind.
Die moderne Überzeugung – im Anschluss an Lear –, dass man seine Kinder gleichermaßen lieben und bei der Verteilung materieller Güter keine Bevorzugungen vornehmen sollte, steht häufig mit festen Überzeugungen hinsichtlich der Konsequenzen einer Gleichbehandlung und in Bezug auf individuelle Bedürfnisse in Konflikt. Bei besonders wohlhabenden Personen kann sich diese Spannung durch die Möglichkeit oder Alternative, philanthropisch tätig zu werden, noch verstärken. Wir könnten unsere eigene Verantwortung für Projekte außerhalb der Familie, die unsere Unterstützung verdienen, als vergleichbar mit den Verpflichtungen Lears gegenüber seinen Landsleuten ansehen. Man kann Lear vorwerfen, das Wohl seiner Untertanen nicht berücksichtigt zu haben. Zumindest auf den ersten Blick denkt er nicht daran, welches seiner Kinder am besten regieren oder wie eine Teilung seines Reiches auf die eine oder andere Art politische Stabilität oder Wohlstand begünstigen würde.17 Die meisten von uns können ihre Sache viel besser machen. In den Mittelpunkt stellt Shakespeare Lears Eitelkeit und seine Unfähigkeit, sich selbst, Liebe innerhalb der Familie und seine eigene Zukunft nach dem Rückzug in den Ruhestand zu verstehen. Dies sind wichtige Dinge, die wir alle berücksichtigen sollten – wenn es auch nicht die einzigen Dinge sind.
Die Vorsorge für den eigenen Nachlass ist ein wichtiges Thema für ein Buch über das Altern, ebenso wie für einen Aufsatz über König Lear, aber es ist nicht das Thema, mit dem man beginnen sollte. Ein besserer Ausgangspunkt ist Martha Nussbaums Essay über die Verletzlichkeit von Lear. Ich frage mich, welchen Rat Martha Lear erteilt hätte. Woher wissen wir, ob wir bereit sind für den Eintritt in den Ruhestand und für die Realität des Angewiesenseins auf andere? Und wenn wir spüren, dass wir auf körperliche Schwäche nicht wirklich vorbereitet sind, was können wir dagegen tun? Menschen im Ruhestand wird oft geraten, dass sie sich neuen Herausforderungen stellen sollen, und tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass diejenigen, die weiterhin Neues lernen und ausprobieren, dabei glücklich werden. „Triumphe der Erfahrung“ sind den Klagen über die verlorene Jugend sicherlich überlegen – und bereiten mehr Freude.18 Wir wissen auch, dass es für alternde Personen – und für das Gesundheitssystem – besser ist, wenn eine Person durch die Art ihrer Betreuung nicht zu einem Kind gemacht wird, sondern wenn Kontrolle und Entscheidungen, wann immer es möglich ist, in den Händen des einzelnen Menschen bleiben. Lear ließ sich wenig Handlungsspielraum, als er auf seiner Suche nach Respekt von Tochter zu Tochter irrte. Sterblich zu sein, wie wir es alle sind, verlangt nach Gesprächen über Erwartungen und Verantwortlichkeiten, und die Tragödie von Lear mahnt uns, vorauszudenken.
In mehrfacher Hinsicht ist Lear ein zu einfaches warnendes Beispiel. Bei der Verteilung von Vermögenswerten scheint es offensichtlich, dass man sie nicht proportional zu Liebesbekundungen abgeben sollte. Jeder Theaterbesucher kann sofort sehen, dass die Herausforderung oder der Liebestest, den Lear verlangt, einen Fehler darstellt. Vielleicht sollen wir erkennen, dass Lears Dummheit sich von anderen Eitelkeiten, die unsere Entscheidungen beeinflussen könnten, nicht so sehr unterscheidet. Wir wissen zum Beispiel, dass wir möchten, dass sich wohltätige Organisationen für unsere Geschenke bedanken; doch es wäre töricht, zu denen am großzügigsten zu sein, die uns am überschwänglichsten danken. Lears Eitelkeit ist verwirrend; selbst wenn er die Antworten seiner Töchter durchschauen könnte, ist es mit Sicherheit unklug, dass er seine Vermögenswerte nach der realen Größe ihrer Liebe zu ihm aufteilt. Man stelle sich, statt des tatsächlichen Anfangs des Stückes, eine Eröffnungsszene vor, in der Lear mit anhört, wie seine Töchter über ihre Gefühle reden, wobei er darauf vertraut, dass die Szene nicht eigens inszeniert wurde, um ihn zu täuschen. Er könnte verständlicherweise verletzt sein, wenn eine Tochter, Cordelia, Gleichgültigkeit ihm gegenüber oder Ungewissheit über ihre künftige Beziehung zum Ausdruck brächte. In der ersten Szene des ersten Aktes schmeicheln Cordelias niederträchtige Schwestern, Goneril und Regan, ihrem Vater, während Cordelia sich Lears Forderung, ihm ihre Liebe zu bezeugen, widersetzt und sagt, dass sie ihren Vater, den König, liebe wie es ihrer „Pflicht geziemt, nicht mehr, nicht minder“.19 Sie fährt fort, indem sie Liebe als begrenzt darstellt und sagt: „Würd’ ich je vermählt, so folgt dem Mann, der meinen Schwur empfing, halb meine Treu’, halb meine Lieb’ und Pflicht.“ Man stelle sich vor, sie hätte, im Einklang mit ihrem Charakter, gesagt:
Ich weiß nicht, ein wie guter Vater er war,
Da ich keinen and’ren hatte.
Ich kann mein Herz nicht auf meine Lippen heben.
Ich liebe ihn, wie es meine Pflicht ist,
Und selbst das zu sagen mag nur schlüpfrig glatte Kunst sein.
Würd’ ich je vermählt, so folgt’ halb meine Liebe meinem neuen Herrn,
Der gegen früh’re Zusagen von Pflicht und Fürsorg’ Einwände erheben könnt’.
Die meisten dieser Zeilen spricht Cordelia so nicht aus; sie sind eine modifizierte und verdrehte Version der Worte, die Shakespeare sie sagen lässt. Hätte sie diese kühlen, rationalistischen Gedanken zum Ausdruck gebracht, wäre Lear vielleicht vor Wut zerplatzt und hätte erst dann beschlossen, sie zu enterben und seinen Besitz und sein Königreich den anderen zu geben. Er hätte Zusagen künftiger Liebe und Unterstützung – auch wenn dies bloße Versprechungen sind – wohl Cordelias vernünftigem Zögern vorgezogen.
Wenn Shakespeare Lear mit diesem alternativen Anfang auf den Weg und sodann in die Wildnis geschickt hätte, wäre Lear etwas weniger töricht erschienen, denn er hätte auf solidere Beweise von Zuneigung reagiert, statt auf das, was Cordelia bloße „schlüpfrig glatte Kunst“ nennt. Seine Enterbung von Cordelia wäre dennoch nicht weniger eitel gewesen. Es wäre offensichtlicher gewesen, dass Lears Pflicht darin bestand, sein Königreich in gute Hände zu übergeben, damit seine Untertanen nicht Hunger und Krieg ausgesetzt sein würden. Und was wäre, wenn er, bevor er den Thron aufgab, die Pläne seiner Töchter für seinen Ruhestand eingeholt oder belauscht hätte? Vielleicht hätte eine von ihnen eine große Gefolgschaft von Rittern und eine gemeinsame Herrschaft versprochen, während sich eine andere aufrichtig vorstellte, viel Zeit miteinander zu verbringen, selbst als Cordelia unentschlossen oder unverbindlich blieb. Ein Teil dieser Ungewissheit bleibt uns in unserem eigenen Ruhestand erspart, weil wir über stabile Institutionen und Anwälte verfügen, an die wir uns wenden können. Wir können einen Vertrag über einen Platz in einer Seniorengemeinschaft abschließen oder unser Vermögen verwalten, ohne dass Menschen eingreifen, denen wir nicht voll vertrauen. Aber es gibt eine Grenze für diese Eigenständigkeit, ob es uns gefällt oder nicht: Sofern wir nach Anzeichen dafür suchen, wie man uns, wenn wir wahrscheinlich pflegebedürftig sein werden, behandeln wird, ähneln wir alle Lear.
Es ist sehr bedauerlich, dass Shakespeare uns nahelegt, eher für Lear als für Cordelia Mitgefühl zu haben. Sie ist ein ehrlicher Mensch, und im vierten Akt kehrt sie sogar zurück, um sich um ihren Vater zu kümmern. Es ist zu spät; sie muss dies büßen und wird getötet. Lear führt sein eigenes Unglück herbei und verschlechtert seine Beziehung zu seinen Untertanen, deren Wohlergehen, wie ich nochmals betonen möchte, bei seinem Rückzug in den Ruhestand und seiner Nachfolgeplanung keine Rolle spielte. Hätte Lear sein Königreich zu gleichen Teilen aufgeteilt und gesagt, er wolle sich zurückziehen und die Kontrolle abgeben, weil er wisse, dass es – statt erfreulich – qualvoll werden könnte, seine Töchter regieren zu sehen, dann könnten wir vielleicht Mitgefühl für ihn aufbringen, während sie gegeneinander kämpfen und die Stabilität ihrer Länder gefährden. Vielleicht bestünde die tragische Lehre von Lear dann einfach darin, dass wir, wenn wir uns in den Ruhestand zurückziehen, gezwungen sind, die Leistungen derer zu beobachten, die uns nachfolgen. Manche Menschen würden darüber vielleicht lieber nichts wissen.
Andererseits hätte Lear auch beschließen können, das Königreich ungeteilt zu belassen und einen Alleinerben zu finden. Shakespeare ließ Lear wahrscheinlich Töchter statt Söhne haben, da die Zuschauer bei Männern erwartet haben würden, dass ein einzelner männlicher Erbe, wahrscheinlich der älteste, als Thronfolger ausgewählt worden wäre. Lear hätte vielleicht mit der Beteiligung fremder Mächte und der Bildung von Bündnissen gerechnet, aber das Publikum würde an ein vereintes statt ein geteiltes England gedacht haben. In der uns vorliegenden Form ignoriert oder umgeht das Stück die Regeln der Thronfolge. Zur Zeit Shakespeares hätte das Publikum die Thronfolge wahrscheinlich als ein Märchen betrachtet oder als völlig jenseits seiner eigenen Alltagserfahrung. Ein moderner Leser kann sich Lears Entscheidung jedoch als eine vorstellen, der wir uns alle stellen müssen, auch wenn wir kein Königreich zu übergeben haben. Das Erbrecht lehnte sich eine Zeit lang an die Regeln der Thronfolge an, doch der moderne Leser erwartet, dass ein Königreich als Ganzes erhalten bleibt, auch wenn die meisten von uns nicht vorhaben, ihren Nachlass ungeteilt einem einzelnen Erben zu übergeben. Es ist schon ein wenig rätselhaft, warum Lear es eilig hatte sein Königreich aufzuteilen, als Cordelia – die angeblich sein Lieblingskind ist – noch nicht verheiratet war. Vielleicht dachte er, dass sein Zuneigungstest die Liebe Cordelias ans Licht bringen und es ihm leichter machen würde, ihr den größten Anteil zu übergeben. Der moderne Leser könnte die Situation provokant finden, wenn ein Kind Lear am meisten liebte, während ein anderes zum Regieren fähiger wäre. Lears Blindheit jedoch macht die Geschichte zu einer Warnung vor der Verwundbarkeit älterer Menschen statt zu einem Lehrstück über die Strategie und Moral von Vermächtnissen.
Es gibt Gründe, Königreiche und sogar Familienunternehmen intakt zu halten, doch die Geschichte ist voller Beispiele für verwerfliches und sogar mörderisches Verhalten, das sich – ungeachtet der geplanten Nachfolge – im Schatten von Plänen zur Weitergabe von Vermächtnissen zutrug. Das Erstgeburtsrecht hat zu Morden geführt, und mit der britischen Geschichte und Literatur vertraute Zuschauer neigen zu der Ansicht, dass das Erstgeburtsrecht dem Erstgeborenen oder nächsten Thronfolger eine Zielscheibe auf den Rücken heftet. Aber es ist schwer, dieses Problem zu vermeiden; selbst ein System mit gleicher Aufteilung kann dazu führen, dass Begünstigte Mitbewerber aus dem Weg räumen. Jedes Prinzip schafft gefährliche Anreize. In einigen Systemen ist die Übergabe des Throns mit einem Element des Ermessens verbunden; der Souverän könnte unter seinen Kindern eine Wahl treffen, oder eine Gruppe von hochrangigen Ältesten wird damit beauftragt, den nächsten Herrscher zu wählen. Ein Verdacht auf unehrliches Verhalten könnte die Auswahlchancen verringern. Vielleicht entstehen diese Systeme also, weil sie die Mordrate verringern. Andererseits ist ständige Konkurrenz zwischen potenziellen Erben möglicherweise von Nachteil und kann zur Folge haben, dass die letztendlichen Verlierer in diesem Prozess sich der Ausbildung, die für die Nachfolge erforderlich ist, vergeblich unterzogen haben.
König Lear mahnt uns, dass die Gefahr von schlechtem Verhalten nicht endet, wenn der Herrscher die Nachfolge plant. Geteilt oder nicht: Ein Königreich oder ein Geschäft kann schlicht zum Schlachtfeld für nachfolgende Auseinandersetzungen unter den Erben werden. Und wenn es geteilt ist, hat jeder Plan seine Gefahren. Drei ist eine gefährliche Zahl, wie viele Kinder wissen; zwei können sich gegen einen zusammenschließen, und aus verschiedenen Gründen ist drei eine instabile Zahl. Ein Land oder Geschäft in zwei Teile zu zerlegen, kann jedoch auch zu Instabilität und Streit führen. Lears Eitelkeit kam ihn teuer zu stehen, aber es hätte ebenso schlimm ausgehen können, wenn er allein der besten Schmeichlerin ein ungeteiltes Königreich hinterlassen hätte oder wenn es, entsprechend der Liebesbezeugungen, dreigeteilt worden wäre.
Lears Problem beginnt lange bevor er seine Vermächtnisse macht. Seine beiden älteren Töchter sind jetzt unwiederbringlich verdorben, und vielleicht leidet Lear, weil er sie nicht sorgfältig erzogen und ausgebildet hat. Andererseits ist das Problem möglicherweise älter als Lear. Seine Vorfahren hätten ein Modell vorgeben müssen, dass ihre Nachfahren nicht ohne Weiteres hätten umstoßen können. Manche Gesellschaften entwickeln ausgeprägte Erwartungen bezüglich der demokratischen Nachfolge oder irgendein Erbfolgemuster, das es einem aus der Rolle fallenden und enttäuschten Anwärter schwer macht, größeren Schaden anzurichten. Hätten die Adligen und das gemeine Volk eine friedliche Nachfolge mit einem leicht auszumachenden Erben erwartet, so wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass auf das Abtreten von Lear eine Zeit der Instabilität folgte. Stabilität kann das Ergebnis vieler verschiedener Nachfolgepläne sein; aber es ist bemerkenswert, dass ein Plan oder eine Tradition erforderlich zu sein scheint, um ein Königreich intakt zu halten. Ein Königreich zu teilen, um jedem der Nachkommen des Herrschers gleiche Anteile zu geben, ist keine nachhaltige Strategie. Ein interessantes Kennzeichen der Moderne und des Aufkommens der Kaufmannsschicht ist die Abspaltung der Erbkonventionen, denen die Bevölkerung folgt, von denen, die auf den Sitz der Macht angewendet werden. Ich kann mein Eigentum zu gleichen Teilen meinen Kindern vererben, und eines Tages können sie dasselbe für ihre Kinder tun, und auf lange Sicht könnte dies eine stabile Vorgehensweise sein. Bei den meisten Monarchen ist das nicht der Fall und könnte bis etwa ins 17. Jahrhundert hinein auch bei irgendeiner begüterten Person nicht der Fall gewesen sein. Die königliche Thronfolge mag in den Zeiten zwischen Shakespeare und uns ein Modell für einige wohlhabende Familien gewesen sein, doch es kommt uns nicht mehr in den Sinn, dass die Machtübergabe in Washington, im Buckingham Palace oder in Riad irgendetwas mit dem Prinzip zu tun haben sollte, das wir befolgen, wenn wir Vermögenswerte innerhalb unserer eigenen Familien übertragen. Trotzdem können wir in Lear ein Lehrstück über die Liebe und das Hinterlassen von Vermögenswerten finden.
Wenn Lear erwartet hatte, Cordelia den Thron zu überlassen, dann hätte er, nachdem sie ihn in Wut versetzt hatte, zwischen den beiden anderen wählen sollen, basierend auf ihrer Eignung als Herrscherinnen, oder – auf egoistischere Weise – nach der Glaubwürdigkeit ihrer Zusage, hingebungsvoll für ihn zu sorgen. Eine Interpretation, die Lear schmeichelt, ist die, dass er sich in den Ruhestand zurückziehen und den Thron übertragen wollte, solange er noch bei vollem Verstand war, jedoch durch die Tatsache, dass Cordelias noch unverheiratet war, daran gehindert wurde. Eine andere Version ist, dass Lear an einer Koalition souveräner Mächte arbeitete, einschließlich seiner Töchter und ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Gatten. Wir wissen nicht, ob nur Cordelia als Herrscherin akzeptabel gewesen wäre, und es ist plausibel, dass die Zuschauer gedacht haben, ein respekteinflößendes Paar sei erforderlich gewesen, um die ehrgeizigen Schwestern und deren Ehepartner beherrschen und abwehren zu können.
Wir wollen nun Lears Präferenz, seine Güter im Verhältnis zur Liebe ihm gegenüber zu verteilen, von seiner Strategie trennen, sich auf Liebesbezeugungen zu verlassen. Letzteres enthüllt seine Eitelkeit und bedeutet einen tragischen Fehler. Aber wenn wir uns Lear als praktisch und nicht als eitel vorstellen, so stellen wir fest, dass Lear mit einer Entscheidung konfrontiert ist, die derjenigen, die viele wohlhabende, nichtfiktionale Menschen unserer Zeit nicht loslässt, nicht unähnlich ist. Mögen wir auch keine Königreiche zu übertragen haben: Viele von uns verstehen dennoch, dass wir, sofern wir Vermögenswerte hinterlassen können, die Möglichkeit haben, diejenigen zu kontrollieren, die uns wahrscheinlich überleben werden – oder dass die Gefahr besteht, dass wir dies tun.
Lear weiß, wie die meisten von uns, Dankbarkeit zu schätzen. Es gibt eine einfache und egozentrische Form dieser Einstellung, aber auch eine ebenso nachvollziehbare, weniger egoistische Sichtweise. Wenige von uns möchten Empfängern, die undankbar, manipulativ oder unfähig sind zu erkennen, dass ihr Glück in der Regel dadurch möglich wurde, dass manche Opfer gebracht wurden, größere Geschenke machen. Diese Tendenz ähnelt der Überzeugung eines Arbeitgebers, dass eine Bewerberin, die nach einem Vorstellungsgespräch „Danke“ sagt, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine gute Mitarbeiterin sein wird als eine, die dies nicht tut, und die das Vorstellungsgespräch einfach als einen Informationsaustausch betrachtet oder mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit von Nutzen für den Arbeitgeber wie für sie selbst. Auf ähnliche Weise könnte ein Wohltäter dankbare Empfänger nicht deshalb bevorzugen, weil er eitel ist, sondern weil man Dankbarkeit mit einem guten Charakter in Verbindung bringt.
Ein Wohltäter wünscht vielleicht auch, dass man sich nach seinem Tod an ihn erinnert, und dieser Wunsch kann auch das gesellschaftliche Wohl fördern. Es mag vielleicht nicht völlig rational oder mit der Idee des Todes als eines Endpunkts philosophisch unvereinbar sein, zahlreiche Menschen haben jedoch trotzdem den Wunsch, in Erinnerung zu bleiben, der stärker wird, je näher der Tod rückt. Professionelle Fundraiser wissen, dass viele wohlhabende Menschen ihre Namen mit Gebäuden oder anderen dauerhaften Projekten verbinden möchten. Häufig ist ein Spender schon damit zufrieden, wenn sein oder ihr Name für etwa fünfzig Jahre mit etwas in Verbindung gebracht wird – lang genug, um seinen oder ihren Kindern und Enkelkindern Gelegenheiten zu geben, sich an ihren Vorfahren zu erinnern. Die meisten von uns versuchen nicht, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn unsere Ururenkel oder andere Menschen, die wir nie getroffen haben, sich an uns „erinnern“. Der menschliche Drang mag hier weniger auf Unsterblichkeit oder evolutionäres Überleben abzielen, als vielmehr darauf, Bekannten oder Menschen, die man sich leicht vorstellen kann, in Erinnerung zu bleiben; oder Einfluss auf sie auszuüben. Anders ausgedrückt könnte die scheinbare Eitelkeit oder Verwundbarkeit, die man beobachtet, als eine Strategie verstanden werden, andere zu guten Taten anzuspornen.
Über den Wunsch, in Erinnerung zu bleiben und den Hang, zu versuchen auf die Zukunft Einfluss zu nehmen, gibt es noch mehr zu sagen, doch ich verschiebe diese Themen ebenso wie die Gepflogenheit, Kinder gleich zu behandeln, auf Kapitel 8, wo ich sowohl philosophische Argumente als auch Anreize und Motive hierfür untersuchen werde. Im Augenblick reicht es zu erkennen, dass die Dankbarkeit von Begünstigten eine wesentliche Rolle bei den Verteilungsentscheidungen der Wohltäter spielen könnte.
Dankbarkeit kann an die Stelle von Vertrauenswürdigkeit treten, wie ich im Fall eines Arbeitgebers angemerkt habe, der von den Bewerbern auf eine Stelle gern Dankesbekundungen hört, es könnte allerdings auch andere Erklärungen für die Präferenz des Arbeitgebers geben. Vielleicht sind Leute, die sich bedanken, gut erzogen und neigen dann auch dazu, ordentlich zu sein, unnötige Konfrontationen zu vermeiden oder selbstsicher aufzutreten. Eine Vorliebe für Dankbarkeit kann mit der Suche nach Zuverlässigkeit verbunden sein. Lear muss die Kontrolle aufgeben, aber er wünscht sich auch etwas Respekt und Fürsorge. Er hofft, ein Gefolge von Rittern zu haben, und sicher auch, dass er ein Dach über dem Kopf und eine Küche haben wird, in der er und sein Gefolge bekocht werden. Wie soll er, in Zeiten vor Ruhestandsgemeinschaften, ganz zu schweigen von individuellen Ruhestandskonten, dieses Ziel erreichen? Manche Eltern denken vielleicht, dass sie, wenn ihre Kinder ewige Zuneigung bekunden und öffentliche Versprechen abgeben, in ihren alten und verletzlichen Jahren sicher sein werden. Selbst wenn ein Kind dazu neigte, sein Wort zu brechen oder das dazu erforderliche Opfer schlichtweg zu unterschätzen, wird es das Versprechen aufgrund des Drucks von Familie und Gemeinschaft halten. Andere potenzielle Betreuungspersonen (und Empfänger von Vermögenswerten) könnten bei einem heiligen Gegenstand schwören oder auf eine andere Weise versuchen, das Versprechen glaubwürdig erscheinen zu lassen, um von der alternden Person Gefälligkeiten oder Vermögenswerte zu bekommen oder einfach nur ihre Ängste zu beschwichtigen. Interessant ist, dass keine von Lears Töchtern zur Steigerung des Werts ihrer Liebesbekundung das Übernatürliche beschwört.
Mit einem gewissen finanziellen Aufwand kann ein Elternteil einen Treuhandvertrag oder ein anderes Dokument aufsetzen, welches ein Kind belohnt, das für den alternden Elternteil sorgt. Ich werde dies weiterhin als eine Eltern-Kind-Angelegenheit beschreiben, jedoch ist die Angst natürlich noch größer, wenn die alternde Person keine Kinder hat oder keines von ihnen in der Lage ist, für sie zu sorgen. In derartigen Situationen können explizite Angebote und Versprechen sogar noch wichtiger sein, weil es weniger offensichtlich ist, welche entfernten Verwandten die Pflege übernehmen sollten, und weil es wahrscheinlicher ist, dass niemand sich schämen muss, wenn die alternde Person gebrechlich, einsam und verlassen ist. Übernimmt jedoch ein Familienmitglied die vertragliche Regelung der Pflege, so kann dies noch schwieriger sein, als es herzlos ist. Neben anderen Gründen wird es häufig der Fall sein, dass letztlich irgendjemand über die zu leistende Pflege subjektiv entscheiden muss. Wenn ein Elternteil in das Haus oder die Wohnung eines Kindes einzieht, kann er oder sie für angemessene Mietzahlungen sorgen und dies möglicherweise auf eine Weise tun, die andere Kinder, die an Gleichbehandlung gewöhnt sind, oder die glauben könnten, dass der aufnehmende Geschwisterteil die Eltern ungünstig beeinflusst, nicht verärgert. Es gibt konkrete und gesetzliche Institutionen, die Lear sich noch nicht vorstellen konnte, die wir aber einschalten können. Ein angenehmer Aspekt dieser Instrumente besteht darin, dass ihre Verwendung die jüngere Generation nicht beleidigt. Zumindest sollte es einfach sein, ein zuverlässiges Familienmitglied, einen Freund oder einen amtlichen Treuhänder damit zu beauftragen, ein bestimmtes Vermögen zu verwalten, um Familienmitgliedern die Ausgaben zu erstatten, die sie im Interesse der alternden Person tätigen. Zur sicheren Version dieses Plans gehört die Verwendung einer Versorgungsrente, das heißt eines Finanzinstruments, das dem Rentenempfänger zu seinen Lebzeiten ein Einkommen zahlt. Renten werden manchmal als das Gegenteil von Lebensversicherungen beschrieben, weil sie einen gegen das „Risiko“ eines langen Lebens versichern. Ich kann in eine Versorgungsrente investieren und die jährlichen Zahlungen mir selbst überweisen lassen, aber bestimmen, dass sie an ein Mitglied meiner Familie oder an eine andere Person gehen sollen, sobald ich nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten eigenständig zu regeln, oder ab einem bestimmten Alter. Ich kann ausdrücklich festlegen, dass die jährlichen Zahlungen für meine Unkosten zu verwenden sind. Die Zahlungen werden Zeit meines Lebens fortgesetzt und die Versorgungsrente wird, bei gleicher Anfangsinvestition, umso größere jährliche Zahlungen leisten, je kürzer meine Lebenserwartung zum Kaufzeitpunkt ist. Versorgungsrenten können lange im Voraus gekauft werden, mit späteren Startterminen, sodass sie eine relativ günstige Absicherung gegen die mit einer sehr langen Lebensdauer verbundenen Kosten darstellen. Aus praktischen Gründen ist es dabei äußerst wichtig, sich für einen Rentenanbieter mit sehr niedrigen Gebühren zu entscheiden, seien diese nun versteckt beziehungsweise tief im Vertrag verborgen. Mit ein wenig Aufwand kann man – wenn man es lange vor einer Beeinträchtigung des Urteilsvermögens oder des finanziellen Scharfsinns erledigt – kostengünstige Anbieter finden, ohne dass man Finanzberatern oder Maklern, die als (gut bezahlte) Vermittler fungieren, Gebühren dafür zahlen muss.
Manchmal ist mehr erforderlich, wenn wir hoffen, die für uns durchgeführte Pflege garantieren zu können, statt lediglich ihre Kosten erstattet zu bekommen. Wie Lear finden auch wir die Aufmerksamkeit, die wir von anderen zu bekommen hoffen, erfreulicher, wenn wir glauben, dass sie uns aus Liebe – oder zumindest aus Sympathie und Pflichtbewusstsein – geschenkt wird. Einige Leute haben keinen Zweifel daran, dass ihnen solche Fürsorge zuteilwerden wird. Jede Generation gibt ihren Kindern eine felsenfeste Unterstützung, und wenn die Empfänger dieser Hilfe älter werden, scheint es nur angemessen, dass sich diejenigen um sie kümmern sollten, die sie in die Welt gebracht und unterstützt haben. Familien können jedoch zerrüttet, übermäßig berechnend oder aber streitsüchtig sein. Kindern kann sich ihr eigenes Elternhaus in der Erinnerung verzerrt darstellen, manchmal von einem Ehepartner gefördert, der oder die sich von seinen bzw. ihren Schwiegereltern nicht akzeptiert fühlt.
Wir sind oft nicht sicher, ob unsere Familien sich so weiterentwickeln werden, wie wir es uns wünschen. Aus diesem Grund greifen viele Menschen auf eine Methode zurück, die weit verbreitet und der Prüfung wert ist. Sie halten Geld zurück: Entweder, indem sie das Verfassen eines Testaments aufschieben; indem sie damit drohen, ein Testaments zu ändern; oder aber indem sie einfach die einzelnen Verfügungen des Testaments geheim halten. Andererseits kann eine wohlhabende Person klarstellen, dass sie im Verlauf ihres Alters großzügige Geschenke verteilen wird, die ihr Vermögen erschöpfen werden, und dass sie durch das Testament, das sie verfasst hat, nur wenig hinterlassen wird. Ob es absichtlich geschieht oder nicht: Menschen schieben die Aufteilung ihrer Vermögenswerte auf, um Verhalten zu motivieren, das sie explizit nicht beeinflussen wollen – oder können. Im Gegenzug sorgen potenziell Begünstigte für wohlhabende Einzelpersonen, und nach meiner Erfahrung tun sie dies manchmal bis zu dem Punkt, dass sie jedem ihrer Wünsche entgegenkommen, während diese potenziellen Wohltäter älter werden.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass die Konvention, „Verteilungsentscheidungen aufzuschieben“, attraktiv oder effektiv ist. Wenn es Kinder dazu bewegt, sich ihren Eltern gegenüber freundlich zu verhalten – so lautet das Argument –, was ist dann so schlimm an der Vorstellung, dass Kinder durch eine Kombination aus Zuneigung, Dankbarkeit und finanziellem Eigennutz motiviert sein könnten? Doch es gibt hier gleich mehrere Probleme. Erstens wird das Alter von Eltern (oder eines anderen Wohltäters) unnötig von Stress oder Zynismus erfüllt; sowohl Eltern als auch Kinder sind ständig damit beschäftigt, irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, statt einfach sie selbst zu sein. Jeder Besuch und jede Freundlichkeit werden durch den Gedanken beeinträchtigt, dass es statt um Liebe letztlich um Geld geht. Jemandem jeden seiner Wünsche von den Augen abzulesen und ihm Gründe für die Vermutung zu liefern, man habe es auf sein Vermögen abgesehen, kann seltsam eng miteinander verbunden sein. Da gibt es den ständigen Wunsch, Zuneigung möge die bloße Pflicht überwiegen, aber der zurückhaltende Verteiler seines Vermögens muss sich auch fragen, ob die Strategie des verzögerten Verteilens wirklich gut funktioniert. Jeder introspektive oder skeptische Mensch, der sich einmal in der Rolle eines Vorgesetzten befand, kennt dieses Gefühl. Mitarbeiter haben allen Grund, sehr entgegenkommend zu sein; ihre guten Wünsche und freundlichen Hinweise sind weniger wertvoll als diejenigen, die von anderen Personen ausgesprochen oder gegeben werden. Auch ein wohlhabender, alternder Mensch bringt sich in eine ähnliche Situation, wenn er gutes Verhalten belohnt. Manche Menschen würden Wissen Trost vorziehen, andere möchten Dinge lieber nicht wissen. Vielleicht war es für Lear besser, selbst zu sehen, wie seine Töchter ihn behandelten, sobald er nichts mehr besaß, was er ihnen hätte geben können. Die meisten von uns wünschen keine Erkenntnis der Wahrheit um diesen Preis.
Ein weiteres Problem, dem man begegnet, wenn man Verteilungsentscheidungen aufschiebt, um die Pflege sicherzustellen, besteht darin, dass sich Zuneigung nur schwer genau vergüten lässt. Es ist wahrscheinlich, dass die Wohltäter die Freundlichkeiten und Kränkungen aus jüngster Zeit überbewerten oder sich nur an diese erinnern, sodass Übertragungen von Vermögen kein genaues System der Bezahlung für Pflege und Zuneigung darstellen. Wenn ich meinen Verteilungsplan bis zu meinem Tod jährlich revidiere, ist es wahrscheinlich, dass ich in der letzten Revision zu viel Gewicht auf meine jüngsten Erfahrungen legen werde. Eine kleine Kränkung, die ich im letzten Lebensjahr erfahren habe, könnte dazu führen, dass ich jemanden, der für viele Jahre davor ein liebevoller Betreuer war – oder einfach ein vernünftiges und eigenständiges Kind – deshalb benachteilige. Die Gefahr wird dadurch noch vergrößert, dass meine Fähigkeit, Signale wahrzunehmen oder kurz- und langfristige Erinnerungen zu koordinieren, wie ich es fast das ganze Leben lang getan habe, wahrscheinlich abnehmen wird. Es ist wahrscheinlich, dass wir im Laufe des Alters unsere Fähigkeit verlieren werden, diese komplexen Emotionen und Reaktionen zu kontrollieren. Andererseits könnten diejenigen, die wir anspornen möchten, in ihren Bemühungen nachlassen oder den Glauben an das Belohnungssystem verlieren; und wenn das Zurückhalten von Erbanteilen überhaupt einen Sinn haben soll, müssen potenziell Begünstigte davon überzeugt sein, dass sie für ihre Bemühungen belohnt werden. Möglicherweise werden sie sehr bemüht sein, sich als gefällig zu erweisen, da sie jedes Jahr als das möglicherweise letzte Jahr der Pflege ansehen werden. Aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie auf Distanz gehen werden, um dem potenziellen Wohltäter nicht zu nahe zu treten. Sie könnten davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der sein Erbe Aufteilende in einem bestimmten Jahr verstirbt, gering und es daher sinnvoll ist, zu warten, bis der Tod in ein oder zwei Jahren eintreten wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die strategisch denkende Person auf den Plan treten und so liebevoll und hilfsbereit wie möglich sein – während sie riskiert, zu bemüht zu wirken und so Verdacht zu erregen. Ich habe mitbekommen, dass einige sehr wohlhabende Menschen das Leben von Familien auf diese Weise beschrieben haben, und insofern das von ihnen beschriebene Verhalten nicht irrational ist, lohnt es sich, darüber nachzudenken.
Eine sehr reiche Wohltäterin könnte einen Teil dieser Schwierigkeiten durch regelmäßige Geschenke umgehen. Wenn sie beispielsweise bereit ist, ungleiche Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke zu machen, kann gutes Verhalten belohnt werden und dennoch genug übrig bleiben, um auch das Verhalten in späteren Jahren noch zu belohnen. Doch lässt sich dies nur schwer umsetzen, und es besteht die Gefahr, sich die Begünstigten zu entfremden, die ansonsten für Pflege und Zuneigung sorgen würden. Zieht ein Elternteil beispielsweise ein Kind einem anderen deutlich vor, ist es unwahrscheinlich, dass sich das zurückgewiesene Kind so verhalten wird, wie es der Elternteil wünscht. Üblicherweise wird der Wohltäter sein Erbe zurückhalten und nur für den Fall seines Todes ungleiche Verteilungen vornehmen – wonach dann keine Möglichkeit mehr besteht, die Verbitterung (oder Dankbarkeit) zu erleben, die er oder sie dadurch verursacht hat.
Ich habe mit dieser harten und kalten Analyse versucht zu zeigen, dass es gefährlich ist, sein Erbe zurückzuhalten, um auf diese Weise Hilfsbemühungen und Zuneigung zu bewerten oder dazu anzuspornen. Doch es ist gleichfalls gefährlich, Lear nachzuahmen und alles wegzugeben, um die Zuneigung dann in einem ungefilterten Licht zu sehen. Ich für meinen Teil habe vor, finanzielle Mittel zu behalten, damit ich über genug Einkommen verfüge, um für meine eigenen Bedürfnisse aufkommen zu können. Sollte ich Pflege benötigen, so hoffe ich selbstverständlich, dass ich die pflegende Person entschädigen kann. Ich denke nicht, dass ich wissen möchte, wer für mich sorgen und über meine alten Witze lachen würde, wenn Pflege und Besuche mit finanziellen Belastungen einhergingen und es keinerlei Aussicht auf eine finanzielle Belohnung gäbe.
Wir müssen erkennen, dass sich – wenn unsere Kinder in unsere Pflege einbezogen werden – Unmut entwickeln kann. Was mich betrifft, so habe ich das Glück, großzügige und rücksichtsvolle Geschwister zu haben, die näher bei meinen Eltern lebten als ich, und die unsere Eltern unter schwierigen Umständen umsorgt haben. Ihrerseits haben sie großzügige und unterstützende Ehepartner. Alles, was ich tun kann, ist dankbar zu sein. Ich vertraue meinen Geschwistern, sich zum Ausgleich für finanzielle Belastungen je nach Bedarf der vorhandenen Mittel zu bedienen; in unserem Fall scheinen diese im Vergleich zu den Investitionen an Zeit und emotionaler Energie allerdings nur gering zu sein. Ich habe jedoch auch andere Familien beobachtet, in denen die Dinge schwieriger sind, und wo die Familienmitglieder das Vertrauen zueinander verloren haben, was oft mit einer wirklichen Meinungsverschiedenheit über wichtige Pflegeentscheidungen begann. Pflege wird nur selten gleichmäßig verteilt geleistet, und wenn eine Familie einem Mitglied, das große Anstrengungen unternimmt, Geld gibt, werden andere möglicherweise denken, dass sie von diesem Empfänger unter Druck gesetzt wurden, oder dass ihre eigenen, bescheideneren Bemühungen ebenfalls einen finanziellen Ausgleich verdient hätten. Wird die den Hauptteil der Pflege leistende Person nicht belohnt, kann sie (oder ihre bzw. seine unmittelbare Familie) darüber verärgert sein und das Gefühl haben, dass andere Familienmitglieder die Leistung nicht ausreichend zu schätzen wissen. Wenn dankbare Geschwister aber zum Beispiel eigenes Geld anbieten, kann es sein, dass sich der pflegende Geschwisterteil über die darin möglicherweise enthaltene Andeutung ärgert, die Motivation seiner Mühen sei Geld und nicht Liebe oder Pflichtgefühl. Zuneigung und familiäre Pflichten lassen sich nicht kommerzialisieren; die Ungleichheit der Anstrengungen ist unvermeidbar, und jede Asymmetrie in den Bemühungen enthält das Potenzial von Feindseligkeiten. Natürlich sollten finanzielle Auslagen aus dem Nachlass des Elternteils bestritten werden, und Geschwister, die dazu eindeutig in der Lage sind, sollten die Kosten der Betreuung eines Elternteils untereinander aufteilen. Aber all dies ist wenig hilfreich, wenn es um die Pflege geht, die von den Familienmitgliedern selbst geleistet wird. Wenn wir unsere Kinder gut erzogen oder einfach nur Glück gehabt haben, müssen wir uns über nichts dergleichen Sorgen machen, aber es gibt Tausende von unglücklichen Lears und verbitterten Geschwistern, um uns zu mahnen, wachsam zu sein.
Auch Verstimmungen zwischen Eltern und Kindern sind nicht unbekannt. Es ist nicht ungewöhnlich, emotional und finanziell aufgeladene Kollisionen zwischen einer alternden Person und deren Kindern zu beobachten. So könnte ein erwachsenes Kind beispielsweise seine Berufstätigkeit aufgeben, um sich um einen Elternteil zu kümmern, die Familie es jedoch versäumt haben, die finanziellen Auswirkungen dieses Opfers, beziehungsweise dieses Ausdrucks von Liebe oder Kindespflicht, zu diskutieren. Die Eltern haben vielleicht ein Testament geschrieben, das den Besitz unter mehreren Kindern gleichmäßig aufteilt; nun hat jedoch eines der Kinder ein finanzielles Opfer gebracht und hält sich für berechtigt, eine materielle Anerkennung dafür zu bekommen. Ein Kind könnte sich aufopfern, indem es in das Elternhaus einzieht, aber der Elternteil könnte die Sache so sehen, dass dieses Kind mietfrei wohnt.
Ich werde mir größte Mühe geben, meine Betreuer für ihre finanziellen Opfer zu entschädigen, und vielleicht werde ich andere Familienmitglieder in diese Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Ich würde es bevorzugen, wenn keines meiner Kinder (bzw. kein angeheirateter Verwandter) seine Arbeit aufgibt, um sich um mich zu kümmern, und ich glaube, ich habe das meinen Kindern zu verstehen gegeben. Aber sollte es dennoch irgendwie so kommen, würde ich das andere Kind bitten, mir bei der Berechnung des finanziellen Opfers zu helfen, damit der Betreuer mit so wenigen Ressentiments wie möglich entschädigt werden kann.
Hatte Lear darin einen Fehler begangen, dass er nicht an seine Landsleute dachte, so tun wir das Gleiche, wenn wir nicht über philanthropische Spenden nachdenken, während wir unseren eigenen Lebensabend planen. Eine vernünftige wohlhabende Person wird in der Regel mit einem Vermögen sterben, weil sie das Datum ihres eigenen Todes nicht kennt. Ich kann nicht mein ganzes Geld für gute Zwecke ausgeben, nachdem ich entschieden habe, wie viel ich meinen Kindern hinterlassen soll, weil ich nicht weiß, wie viel ich für mich selbst noch benötigen werde. Wir haben bereits gesehen, dass es unverantwortlich ist, sein gesamtes Hab und Gut wegzugeben und dann darauf zu hoffen, dass die Begünstigten schon für einen sorgen werden. Dies gilt insbesondere, wenn man mehrere Kinder hat. Mit einem verlässlichen Einzelkind könnte ich über die Situation sprechen und darauf vertrauen, dass das Kind die Kontrolle über meine gesamten Vermögenswerte übernimmt und sich in meinem Alter dann um mich kümmert. Wir sahen auch, dass man, um ein jährliches Einkommen für den Rest seines Lebens sicherzustellen, in eine Versorgungsrente investieren kann. Ich sollte noch hinzufügen, dass ein Paar problemlos eine Versorgungsrente kaufen kann, die den Hinterbliebenen bis zu ihrem Tod gezahlt wird. Die Versorgungsrentenstrategie löst allerdings nicht die Frage der Philanthropie, da die meisten von uns nicht das gesamte Jahreseinkommen aus der Rente ausgeben werden, sodass es also auch hier einen Überschuss geben und sich die Frage stellen wird, ob man es spenden, den Kindern überlassen oder an Andere abgeben soll, die es verwalten oder verteilen. Ich habe versprochen, später auf dieses Thema zurückzukommen, und werde dies in Kapitel 8 tun.
Es sollte klar sein, dass auch wohltätige Organisationen an unsere Spendenbereitschaft appellieren können. Eine eitle oder einsame Person, die sich Besucher mit ausgestreckten Händen wünscht, sollte Ressourcen zurückhalten, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen möchte. Die beste egoistische Strategie könnte darin bestehen, bestimmten Wohltätigkeitsorganisationen Geldgeschenke zu machen und anzudeuten, dass diese bevorzugten Organisationen, wenn man gestorben ist, mit noch mehr rechnen können. Ein weniger selbstsüchtiger Wohltäter kann versuchen, seine oder ihre Kinder für gemeinsame gute Zwecke zu interessieren. Eine Wohltätigkeitsorganisation könnte erfolgreich versuchen, eine Spenderin davon zu überzeugen, dass eine größere Spende zu ihren Lebzeiten ihren Kindern ein gutes Beispiel geben und es ihr selbst Freude bereiten könnte, die Spende noch mitzuerleben.
Im Allgemeinen ergeben sich bei diesen Spenden oder Vermächtnissen die zuvor behandelten Probleme nicht, weil es keine Rolle spielen sollte, ob die Wohltätigkeitsorganisation übertrieben hat und bei den Bekundungen ihrer Zuneigung unehrlich gewesen ist. Feststellen zu müssen, dass das eigene Kind eine Goneril ist, wird schmerzhaft sein, doch solange die eigene Alma Mater wirklich Stipendien vergibt oder das örtliche Krankenhaus tatsächlich eine gute Notfallversorgung bietet, sollte es keinen Unterschied machen, ob der Präsident dieser Organisation den Spender beim nächsten jährlichen Festessen weniger freundlich als gewohnt behandelt, um sich einem anderen, bisher noch unentschlossenen Wohltäter zuzuwenden. An der Zuneigung des Präsidenten sollte mir nichts liegen, sondern daran, dass er ein erfolgreicher Fundraiser ist und die finanziellen Mittel gut verwendet. Der einzige Grund, Geld für einen solchen Begünstigten zurückzuhalten, besteht darin, dass man sich nicht wirklich sicher ist, welche Mittel man zur eigenen Unterstützung noch benötigen wird. Aber philanthropische Strategien verdienen ein eigenes Gespräch. Einstweilen soll es genügen, zu dem Schluss zu gelangen, dass es von den Fehlern Lears viel zu lernen gibt. Doch die Lehre, die man aus Lear zieht, sollte nicht lauten, guten Zwecken und allen Kindern finanzielle Ressourcen vorzuenthalten.
Anmerkungen
1 Die Aufführung fand am Chicagoer Shakespeare Theater statt. Die Regisseurin war Barbara Gaines.
2 18. September 2014.
3 Jones ist typisch dafür, seine Krankheit auf diese Weise zu beschreiben. Man sollte beachten, dass das Vergessen von Namen ein separates Problem darstellt und nicht typischerweise mit einer globaleren Demenz verbunden ist, sodass die medizinische Beschreibung voreilig ist.
4 R. A. Foakes (Ed.), King Lear, Arden Shakespeare (New York: Bloomsbury, Erstausgabe 1997), Einleitung, 27.
5 Charles McNulty, “With Age, the Wisdom of Staging Lear Becomes Less Clear”. Los Angeles Times, August 13, 2014.
6 Siehe Stanley Cavell, „The Avoidance of Love: A Reading of King Lear“. In Must We Mean What We Say?. Aktualisierte Ausgabe. (New York: Cambridge University Press, 2002).
7 Janet Adelman, Suffocating Mothers: Fantasies of Maternal Origin in Shakespeare, „Hamlet“ to „The Tempest“ (New York: Routledge, 1992), 104.
8 Aristoteles, Poetik, Kapitel 9.
9 Bradwell vs. Illinois, 83 U.S. 130 (1873).
10 La Vieillesse (Paris: Gallimard, 1996); deutsche Übersetzung von Anjuta Aigner-Dünnwald und Ruth Henry (Berlin: Rowohlt, 2014).
11 Französische Ausgabe, Gallimard 1981. Die Gespräche fanden jedoch 1974 statt; die deutsche Übersetzung von Uli Aumüller und Eva Moldenhauer wurde 1986 vom Rowohlt-Verlag herausgegeben.
12 Sehr hilfreich fand ich Sara Heinämaas Aufsatz „Transformations of Old Age“. In Simone de Beauvoir’s Philosophy of Old Age. Ed. Silvia Stoller (Bloomington: Indiana University Press, 2014), 167–89.
13 Vgl. Joan Scott, The Politics of the Veil (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007).
14 Siehe Justin Driver, „Justice Thomas and Bigger Thomas“. In Fatal Fictions: Crime and Investigation in Law and Literature. Hrsg. Alison LaCroix, Richard McAdams und Martha C. Nussbaum (New York: Oxford University Press, 2016).
15 Heinämaa, „Transformations of Old Age“. 182. Zusammenfassend.
16 Siehe Heinämaa, „Transformations of Old Age“, 185f.
17 Die entgegengesetzte Auffassung wird in dem folgenden, bemerkenswerten Essay von Harry V. Jaffa vertreten: „The Limits of Politics: An Interpretation of King Lear, Act 1, Scene 1“, in American Political Science Review 51 (1957), 405–27. Leider geht Jaffe (ohne passende Erklärung) davon aus, dass eine Dreiteilung grundsätzlich stabiler ist als eine Zweiteilung. Die moderne Public-Choice-Theorie legt uns nahe, dem zu widersprechen, verschiedene Geschichten in der Bibel ebenfalls. Wie dem auch sei, dies ist kein Essay über Lear als vielmehr über die Aufteilung unseres Vermögens und über unsere Pflege an unserem Lebensabend.
18 Die Referenz bezieht sich auf Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study, von George E. Vaillant (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2012). Hierbei handelt es sich um ein hervorragendes Buch über die größte Längsschnittstudie der menschlichen Entwicklung. Der Titel bezieht sich auf die Beobachtung des Autors, dass viele der Probanden in ihren späteren Jahren dazu kamen, ein befriedigendes Leben zu führen, selbst wenn frühere Anzeichen scheinbar nichts Gutes erwarten ließen. Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, von Atul Gawande (New York: Metropolitan Books, 2014) ist die intendierte Referenz im folgenden Text. Dies ist ebenfalls ein wichtiges Buch über das Altern, abgesehen davon, dass es ein Bestseller ist. Es bestärkt die Leser darin, die Pflege in Hospizen positiv zu sehen und die Schlussfolgerung des Autors zu teilen, dass Ärzte darin fehlgehen, dass sie zur Lösung medizinischer Probleme intervenieren, ohne dabei die wahrscheinlichen Konsequenzen für alternde Patienten zu berücksichtigen.
19 Anm. d. Übers.: Eine deutsche Übersetzung ist als gemeinfreier Text verfügbar unter www.zeno.org.