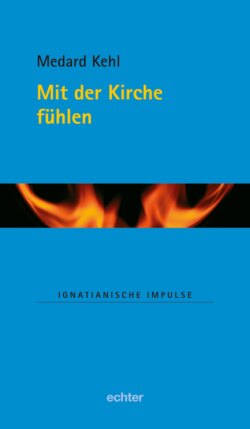Читать книгу Mit der Kirche fühlen - Medard Kehl - Страница 7
1. Eine biographische Annäherung
ОглавлениеEs war in der Zeit meines Theologiestudiums in Frankfurt/Sankt Georgen, also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Es war zugleich die erste Phase der Rezeption des 2. Vatikanischen Konzils mit all ihren Unruhen und zunehmend stärker werdenden Polarisierungen in der Kirche. Da empfahl mir mein damaliger, von mir sehr verehrter theologischer Lehrmeister, P. Otto Semmelroth, dessen Nachfolger in Sankt Georgen ich einige Jahre später werden sollte, ein Buch des zu dieser Zeit sehr berühmten französischen Jesuiten und Theologen Henri de Lubac SJ zu lesen: »Méditation sur l’Église«. Ich las es in der kongenialen Übersetzung von Hans Urs von Balthasar: »Die Kirche. Eine Betrachtung« (Einsiedeln 1968). Diese aus der ganzen Fülle der patristischen, mittelalterlichen und neuzeitlichen Kirchenspiritualität und Kirchentheologie schöpfende Meditation über die Kirche hat mich einfach begeistert. Ich konnte den Sätzen von Hans Urs von Balthasar in seinem Vorwort voll zustimmen: »Es ist ein Betrachtungs-, kein Lehrbuch über die Kirche; aber Weisheit kann mehr sein als Wissenschaft. Es ist ein Buch der Liebe mehr als des Verstandes, und Liebe, die erleuchtet und geordnet ist, ist auf jeden Fall mehr als Verstand« (S. 9). Im Nachhinein sehe ich es als eine glückliche Fügung, dass dies das erste größere Buch über die Kirche war, das ich gelesen habe. Die Kirchenmeditation von Henri de Lubac hat nachhaltig die Weichen für mein eigenes geistliches Verhältnis zur Kirche und nicht minder für mein theologisches Verständnis von Kirche gestellt.
Aber noch tiefer als die vielen guten Gedanken dieses Buches hat sich in meinem Gedächtnis eingeprägt, was P. Semmelroth mir über die Begleitumstände der Entstehung dieses Buches erzählt hat: Henri de Lubac war ja in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts einer der großen Vordenker der so genannten »Nouvelle Théologie« und damit auch der geistigen Überwinder des starren, ungeschichtlichen Denkens der seinerzeit dominierenden Neuscholastik. 1962 sollte er zu einem der bedeutendsten Konzilstheologen aufsteigen. Gerade die großen dogmatischen Konstitutionen über die Offenbarung (Dei Verbum) und über die Kirche (Lumen Gentium) verraten deutlich seine Handschrift. Aber in den Jahren davor musste Henri de Lubac einen schweren Kreuzweg in der Kirche gehen: 1950 wurde ihm von seinen römischen Ordensoberen (auf Anweisung des Hl. Offiziums) die Lehrerlaubnis am Institut Catholique in Lyon entzogen, und alle seine Veröffentlichungen wurden unter eine scharfe Vorzensur gestellt. Was mich bei diesem Vorgang bis heute tief beeindruckt und worin ich ein authentisches Modell für das ignatianische Fühlen mit der Kirche (»Sentire cum ecclesia«) in unserer Zeit sehe, ist die Reaktion von Henri de Lubac auf dieses offenkundige, schon damals von vielen Theologen und Gläubigen so empfundene Unrecht: Er nahm diese Entscheidung im Gehorsam an; er verzichtete auf jeden öffentlichen Protest, veranstaltete keinen Medienrummel (wie wir es zur Genüge aus der nachkonziliaren Zeit kennen); nein, er zog sich in seine Studierstube zurück, überarbeitete viele noch unveröffentlichte Vorträge und Betrachtungen zum Thema Kirche und fasste sie zu einem der schönsten Bücher der neueren Theologiegeschichte über die Kirche zusammen: eben zu dieser »Meditation über die Kirche«, die 1953 auch erscheinen durfte.
Dieses Buch erlebte innerhalb eines Jahres drei Auflagen und nahm sehr viel von den späteren Aussagen des Konzils über die Kirche vorweg. Henri de Lubac brachte damals die Geduld des Wachsens und Reifens auf, ohne die ein fruchtbares Leben und Denken innerhalb und mit der Kirche nicht möglich ist. Diese Art und Weise, einen schweren innerkirchlichen Konflikt aufzuarbeiten und auf Dauer zu einem Segen für die Kirche werden zu lassen (eine Weise, die übrigens auch Madeleine Delbrêl ungefähr zur gleichen Zeit im Konflikt um die französischen Arbeiterpriester anwandte), gab mir und anderen jüngeren Theologen damals einen Maßstab für gute kirchliche Theologie und für das rechte Verständnis des ignatianischen »Sentire cum ecclesia« an die Hand.
Ein solcher Maßstab war seinerzeit auch sehr nötig; hat sich doch in diesen Jahren nach dem Konzil nicht nur das theologische Selbstverständnis der Kirche tiefgreifend gewandelt, sondern – wirkungsgeschichtlich gesehen – wohl noch viel entscheidender die grundlegende Wahrnehmung der Kirche, die leitende Perspektive, unter der sie seitdem von einem Großteil der Gläubigen angeschaut wird. Denn je mehr sich im Prozess der Pluralisierung und der Ausdifferenzierung unserer westlichen Gesellschaften die relativ homogenen, geschlossenen »katholischen Milieus« auflösten, umso weniger wurde die Kirche noch als Heimat, als bergender Raum im Glauben oder gar als »Mutter Kirche« wahrgenommen. Viel stärker traten zum einen die Ortsgemeinden mit ihrer Aktivierung vieler Glaubenden zur Gestaltung des Gemeindelebens in den Blickpunkt. Zum anderen – gleichsam als Kontrast dazu – aber auch die so genannte »Amtskirche« als institutionelles Gegenüber zu den Gemeinden und den einzelnen Gliedern des Volkes Gottes. Diese waren sich inzwischen ihres eigenständigen Subjektseins im Glauben neu bewusst geworden und konnten sich als Kinder ihrer Zeit mit vielem in dieser Kirche nicht mehr identifizieren. So ergab sich für die Kirche hierzulande eine ungewohnte Situation: Sie war auf einmal der offenen Kritik sowohl der gesellschaftlichen Öffentlichkeit generell als auch ihrer eigenen Mitglieder ausgesetzt.
Ich werde in einem ersten Schritt (Kapitel 2) versuchen, diesen typisch neuzeitlichen Wandel in der leitenden Perspektive, wie Kirche von den Gläubigen selbst wahrgenommen wird, auch theologisch zu bedenken. Ich frage also: Ist das alles nur ein zeitbedingtes empirisches Phänomen oder tritt darin auch eine theologische Dimension von Kirche anders als bisher gewohnt zutage? Diese Frage legt sich deswegen nahe, weil die Kirche seit dem 2. Vatikanischen Konzil grundlegend als »Sakrament« (Zeichen und Werkzeug) des Heils (LG 1) verstanden wird; das bedeutet (wie bei jedem einzelnen Sakrament): theologischer Gehalt und empirische Gestalt der Kirche sind »ungetrennt und unvermischt« (vgl. LG 8) miteinander verbunden. Nur in dieser Einheit existiert die theologische Größe »Kirche« hier auf Erden. Darum hat ein Wandel der empirischen Gestalt der Kirche bzw. der empirischen Wahrnehmung der Kirche durch ihre Mitglieder auch Konsequenzen für das theologische Selbstverständnis der Kirche.
Für eine theologische Deutung der oben skizzierten neuen Kirchenwahrnehmung bietet sich vielleicht am ehesten das zweite der vier wichtigsten »Kennzeichen der Kirche« (der so genannten »notae ecclesiae«) im Credo an. Dort bekennen wir ja die Kirche als die »eine, heilige, katholische und apostolische Kirche«. Nun scheint gerade das Bekenntnis zur »Heiligkeit« der Kirche seit dem genannten Perspektivenwechsel doch viel an empirischer wie an theologischer Plausibilität verloren zu haben. Diese konkrete Kirche soll »heilig« sein!? Das ist doch purer Platonismus! Die Rede von einer »sündigen« Kirche scheint doch bedeutend ehrlicher, weil wirklichkeitsnäher zu sein; rechnet sie doch auch aus theologischer Sicht mit der Möglichkeit einer legitimen Kritik an der Kirche, vor allem an ihren Strukturen und ihren Amtsträgern. Dieser Spannung zwischen »heiliger« und »sündiger« Kirche wollen wir zunächst etwas gründlicher nachgehen; denn hier kann die theologische Basis für die folgenden Überlegungen zum geistlichen »Fühlen mit der Kirche« gelegt werden.