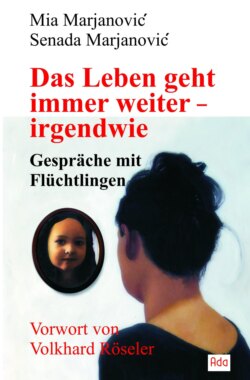Читать книгу Das Leben geht immer weiter – irgendwie - Mia Marjanović - Страница 6
Vorwort
ОглавлениеMan kann dieses Buch auf verschiedene Weise lesen: als Sammlung von Erfahrungsberichten aus dem Inneren eines Flüchtlingsstroms, als biografische Zwischenberichte von Menschen, die jung aus ihrem Land fliehen mussten, oder auch als „Coming of Age“-Geschichten von Kindern, die in besonders schwierigen Verhältnissen groß wurden und sich daraus ihren Weg ins Erwachsenenleben suchen und bahnen.
Vor 20 Jahren hatte Senada Marjanović, die Co-Autorin diese Buches, Aufnahmegerät und Schreibzeug eingepackt und war losgezogen, um in Flüchtlingsunterkünften in Berlin und den Niederlanden Kinder von Flüchtlingsfamilien aus Bosnien zu interviewen. Europa befand sich mitten in den kriegerischen Auseinandersetzungen, unter denen das ehemalige Jugoslawien Stück für Stück auseinanderbrach. Besonders schlimm waren die Geschehnisse im einstigen jugoslawischen Herzland Bosnien, in dem die serbischen, kroatischen und muslimisch-bosnischen Volksgruppen bis dahin untrennbar miteinander verwoben zusammengelebt hatten.
Über Nacht waren aus Nachbarn, Schulkameraden und Freunden plötzlich Feinde und tödliche Bedrohungen geworden. Hunderttausende versuchten dem täglichen Terror durch Flucht zu entkommen, vor allem Frauen und Kinder, viele durch schreckliche Erlebnisse traumatisiert. Es war eine Reise ins Ungewisse. Bei Nacht und Nebel und oft zu Fuß schlugen sie sich bis in die Nachbarländer durch und häufig noch weiter nach Österreich, Deutschland, die Niederlande oder Skandinavien. Nur raus aus dem gefährlichen Schlamassel und möglichst weit weg vom kriegerisch tödlichen Chaos in der Heimat.
In den Zielländern angekommen landeten sie in improvisierten Flüchtlingsunterkünften. Statt im eigenen Haus mit Garten, lebten sie nun in einem Zimmer für die ganze Familie, in einer fremden Umgebung mit unbekannten Regeln und einer Sprache, die sie nicht verstanden. Wie erleben Kinder einen solch radikalen Umbruch? Wie bewegen sie sich in dieser scheinbar verrückt gewordenen Welt der Erwachsenen? Was macht eine solche Entwurzelung mit ihrer Seele? Das waren die Fragen, die Senada Marjanović, selbst aus Bosnien stammend und in Berlin lebend, bewegten. Also ging sie in die Flüchtlingsheime, um mit den Kindern zu sprechen.
Das Ergebnis ihrer Recherchen wurde 1994 in dem Buch „Herzschmerzen – Gespräche vom Krieg mit Kindern aus dem ehemaligen Jugoslawien“ veröffentlicht. Der Band vereinigt Interviews mit 20 Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren. Er vermittelt Einblicke in das Erleben vom Krieg aus der Kinderperspektive und erste Versuche, noch mitten im Schock, das Erlebte einzusortieren und zu verstehen. Von Verarbeiten konnte noch keine Rede sein, zu präsent waren die Bilder noch, das gesehene Grauen, das sich der Fassung in Worte zu entziehen schien. Und doch können wir in diesem ersten Buch viele Geschichten lesen, manche fast nüchtern aus Kindermund erzählt. Erinnerungen „wie im Film“, wie einer sagt.
Nun, 20 Jahre später, ist Senada Marjanović noch einmal losgezogen, diesmal begleitet von ihrer Tochter Mia, um nachzuschauen, was aus diesen 20 Kindern, denen sie damals so tief ins wunde Herz geblickt hatte, geworden ist. Wie ist ihr Leben weitergegangen? Was ist aus ihren Familien geworden? Wo sind sie gelandet? Wie blicken sie heute auf das Erlebte zurück? Und wie, wenn überhaupt, haben sie die Erfahrungen von Krieg, Flucht und Flüchtling Sein verarbeitet, jetzt da sie erwachsen sind, 25 bis 35 Jahre alt, und vielleicht selbst schon Familie und Kinder haben?
Was wir lesen, sind 20 individuelle Geschichten, 20 Versuche, mit dem Leben zurechtzukommen, einen Platz zu finden, einen Weg, über dem Bodensatz von Gewalt, Vertreibung und Rechtlosigkeit der eigenen Lebensgeschichte so etwas wie ein „normales“ Leben aufzubauen, eines, das Alltag und ein Gefühl von Sicherheit bieten kann.
Zunächst geht es in den Gesprächen aber darum, wie es ist, in einem Flüchtlingsheim und als Flüchtling aufzuwachsen, mit ungesichertem Status, von Abschiebung bedroht, mit seelisch und körperlich verwundeten Eltern, die sich streiten, auseinanderleben und trennen, ihre Schwermut im Alkohol ertränken oder sich den Strick nehmen, die ihre Kinder lieben wollen, sie aber oft in der eigenen Verzweiflung wegstoßen, anschreien und misshandeln. Und die Kinder selbst, wie sie rebellisch aufbegehren, ungenießbar für ihre Umgebung werden oder sich zurückziehen, fest davon überzeugt, dass sie nichts wert sind und dass man sie nicht lieben kann.
Und wieder gibt es Nachkriegsgeschichten, die einen sprachlos machen können. So wie die von dem Vater, der, aus dem Krieg in Bosnien zur Familie im Exil „heimgekehrt“, die Mutter mit einem anderen Mann im Bett findet, sie erwürgt und sich dann selbst erschießt. Oder von dem Jungen, der bei einem älteren Deutschen Wärme, Heiterkeit und Bestätigung findet, zum ersten Mal Vertrauen aufbaut, bevor dieser nette Mann sich an ihn heranmacht und ihn sexuell missbraucht, vier Jahre lang, bis der Junge sich durch Flucht nach Schweden retten kann.
Was uns die fortgesponnenen Geschichten dieses zweiten Buches zeigen, jede in eigener Weise, sind die Verheerungen, die der Krieg noch anrichtet, wenn er äußerlich schon lange zu Ende gegangen ist: durch die Erinnerungen und Bilder im Kopf, die Träume, die Nacht für Nacht das Erlebte zurückholen, die Schlaflosigkeit, die daraus folgt, die erloschenen Seelen der Väter, die gedemütigt und geschwächt keinen Anschluss mehr an einen neuen Alltag finden, die Mütter, die vergewaltigt und geschändet gegen ihre Scham anleben. Dazu die allgegenwärtige Angst, dass der Krieg zurückkommen könnte, dass das Serbisch auf der Straße aus dem Mund eines Tschetniks kommt, die Angst vor der Rache der Anderen und vor den eigenen Rachegelüsten.
Vieles kommt einem im Nachkriegsdeutschland Geborenen bekannt vor, aus den eigenen Geschichten nach 1945: die vertriebenen und geflüchteten Verwandten aus dem Osten, die gebrochenen Väter und Großväter, die zwangsweise lebenstüchtigen, kraftvollen Mütter, die die Familien durchbrachten und über das, was sie im Krieg und nach seinem Ende erlebt hatten, schwiegen, die Schuldgefühle und unterdrückten Aggressionen, das Verdrängen und große Schweigen in den Familien, das erst nach Jahrzehnten – manchmal – durchbrochen wurde.
Das Leben geht weiter, irgendwie, auch für die aus Bosnien Geflüchteten. Nach Ende der Jugoslawienkriege gingen viele zurück, ob freiwillig oder gezwungen. Manche blieben und fanden neuen Boden in der alten Heimat, manche hielten es nicht aus und gingen zurück in den Norden, nach Deutschland, Österreich, die Niederlande, oder noch weiter in die Vereinigten Staaten, nach Kanada oder Australien. Die Kinder mussten mit, ob sie wollten oder nicht. Manchmal gefiel es ihnen dort im neuen Land, manchmal nicht. An diesen Geschichten kann man auch einmal mehr lernen, was Schicksal bedeuten kann – in alle Richtungen.
So wie der Junge oben in dem netten älteren Deutschen seinen späteren Vergewaltiger traf, so fand eine bosnische Mutter auf einer Berliner Parkbank einen Obdachlosen, der sie heiratete, ihr und ihrer Tochter damit ein Bleiberecht sicherte, unter der Bedingung, dass er sich täglich wusch und sie ihm Bier besorgte. Dieses Zweckbündnis scheint ein Glücksfall für die drei geworden zu sein, denn schließlich eroberte der Stiefvater sogar das Herz der zunächst so widerspenstigen Stieftochter. Er lebt noch immer mit ihrer Mutter zusammen. Manchmal ist es auch wie im Märchen.
Heute leben wir in Zeiten neuer Flüchtlingsströme. Jetzt fliehen die Menschen vor Krieg und Terror in Syrien, vor der Unsicherheit im Irak und Afghanistan, vor Armut und Perspektivlosigkeit in Afrika. Sie landen zu Zehn- und Hunderttausenden in neuen Flüchtlingsunterkünften, improvisiert auf die Schnelle errichtet, und suchen einen Ankerplatz, wo sie bleiben und ein neues Leben aufbauen können.
Bei allen Unterschieden der Herkünfte und Kulturen, kann einem dieses Buch eine Ahnung davon vermitteln, wie es sich anfühlt, die lebensfeindlich gewordene Heimat verlassen zu müssen, in einem fremden Land zu landen, in vorläufigen Strukturen, eng zusammengepfercht mit anderen Menschen in Not, und wie wichtig das Gefühl ist, an einem Platz ankommen zu dürfen, den Anker werfen und sich einrichten zu können, ohne ständig in der Angst leben zu müssen, dass die Duldung aufgehoben wird und Abschiebung droht. Selbst wenn sie tatsächlich nicht passiert, allein die immerwährende Möglichkeit gräbt sich als Angst tief in das Unterbewusstsein der Menschen ein. Für viele ist es auch nach 20 Jahren noch schwer zu vertrauen, Wurzeln zu schlagen und Nähe zuzulassen.
Vor allem aber lassen uns diese 20 Lebensgeschichten Flüchtlinge als Menschen erfahren, mit eigenem, manchmal durch Pseudonym geschützten Namen, unverwechselbarem Schicksal, eigener Würde. Indem sich die Autorinnen auf sie einlassen, erfahren sie, und wir mit ihnen, dass sich im Leben der hier Befragten zwischen Kindheit und jungem Erwachsenensein, unter außergewöhnlichen Umständen, auch ganz normale Fragen stellen: Wer bin ich eigentlich, wie nabele ich mich von meinen Eltern ab, wie finde ich einen Partner und wo ist mein Platz in dieser Welt, wie lebe ich mein Schwulsein, soll, kann ich eine Familie gründen, und was ist meine Berufung?
Letztlich sind es Menschen aus Fleisch und Blut, deren Geschichten uns dieses Buch präsentiert, mit Kopf und Herz, aber auch mit ganz normalen Sehnsüchten und Nöten junger Leute auf ihrem Weg in die Erwachsenenwelt. Anders als der anonymen Menschenmenge, die wahlweise als „Flut“ oder „Welle“ beschrieben durch die Medien schwappt, kann ich diesen Menschen hier wie unter vier Augen begegnen, sie kennenlernen, mich in sie einfühlen, mit ihnen mitfühlen in Freud und Leid, und sei es nur, indem ich mir die Zeit nehme, ihre Geschichten zu lesen.
Volkhard Röseler