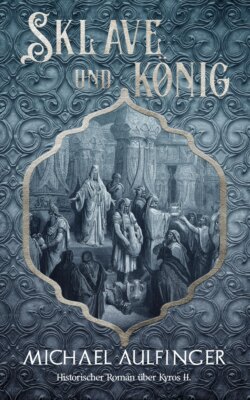Читать книгу Sklave und König - Michael Aulfinger - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеMeine Eltern hatten Glück im Unglück. Ein wohlhabender Gutsbesitzer hatte sie getrennt voneinander gekauft. Da sie sich nicht aus Ninive kannten, begegneten sie sich auf dem Gut des Kaufmanns Merep, welches nördlich von Ekbatana gelegen war, zum ersten Mal. Selbstverständlich beachteten sie sich am Anfang überhaupt nicht, da sie noch halbe Kinder waren. Ihre Aufmerksamkeit war außerdem von weit Wichtigerem belegt. Zu groß war die Angst um das eigene Leben in diesem fremden Land. Der Aufseher Satepe, ein brummender Bär, dessen Herz auf dem rechten Fleck saß, nahm ihnen zunehmend die Furcht. Es war zwar eine harte Arbeit, die ihnen aufgebürdet wurde, jedoch war sie nicht unmenschlich zu nennen. Nach einiger Zeit schlug die Peitsche immer weniger auf ihre Rücken hernieder. Die Fehler nahmen ab und so geschah es, dass meine Mutter Nakina und mein Vater Borsip bald nach getaner Sklavenarbeit auch Zeit für sich selbst fanden. Nach wenigen Jahren waren sie zu jungen Erwachsenen herangereift. Da sie sich allmählich ihrem Schicksal als Sklaven ergeben hatten, kamen sie mit ihrem Leben zunehmend zurecht. Sie lieferten ihre Arbeit ordentlich ab und verhielten sich nicht aufsässig. Mit rebellischen Leibeigenen wurde nicht zaghaft umgegangen. Nicht selten endete ihr Dasein mit aufgerissener, blutiger Haut, nachdem sie für ihren Ungehorsam mit der Peitsche bestraft worden waren.
So kam es, dass sich Nakina und Borsip immer häufiger in ihrer Freizeit trafen. Bald entdeckten sie ihre Gefühle füreinander, die dann nicht mehr zu verheimlichen waren.
An einem kalten Wintertag, der in dem bergigen Mederland umso intensiver zu fühlen war, fasste sich Borsip ein Herz und trat zu Satepe. Fest in der Stimme, doch unsicher im Innern, brachte er dem Aufseher sein Anliegen hervor. Satepe wollte beinahe nicht mit dem Lachen aufhören, als er den irritierten Borsip vernahm. So hatte mein Vater den Aufseher niemals zuvor erlebt. Das steigerte seine Unsicherheit und sein Unbehagen zusehends. Aber Satepe schlug seinen rechten Arm um den kleineren Sklaven und ließ den aufgewühlten Borsip wissen, dass er schon lange auf diese Frage gewartet hatte. Ihm waren die verliebten Blicke nicht entgangen.
Satepe wies darauf hin, dass Merep, als ihr Eigentümer, seine Zustimmung geben musste. Mein Vater nickte verstehend. Wohl war ihm nicht bei dem Gedanken. So begaben sich die beiden ungleichen Männer auf den Weg zum Gutsbesitzer.
Sein Haus war weiß getüncht und ausreichend groß für einen Gutsbesitzer mit Familie. Nachdem sie gewartet hatten, fand Merep Zeit, sich um Borsips Anliegen zu kümmern. Merep lachte nicht, sondern sah meinem Vater fest in die Augen. Dieser hielt dem Blick stand, und versuchte Mereps Gedanken zu lesen. Doch das war nicht einfach. In dem durch den Bart verzierten Gesicht war keine Gefühlsregung zu erkennen. Auch seine Augen verrieten nichts von den Gedanken, die ihn beherrschten. Nach endlos scheinenden Sekunden des Verharrens drehte sich Merep abrupt um, während er in dieser Bewegung seinen Kopf zum Sklaven noch einmal nach hinten drehte und diesem seine Entscheidung knapp mitteilte.
»Meinen Segen habt ihr.«
Damit war diese Angelegenheit für ihn erledigt. Aber nicht für meine Eltern. Sie konnten ihr Glück nicht fassen. Die Hochzeit wurde relativ ausgiebig gefeiert, schließlich waren sie Sklaven. Selbst Merep und Satepe kamen und brachten Geschenke mit.
Nach zwei Jahren kam, mit meiner Schwester Simine, die erste Frucht dieser Ehe auf die Welt. Sie war ein lebensfrohes Kind und ungetrübt in ihrem Gemüt. Es sollten noch einige Jahre vergehen, ehe ich das Licht der Welt erblickte. Ich wurde als Sklave geboren, aber einem Säugling ist das egal.
Als unbedarfter Junge lief ich zwischen dem Gutshaus, den Ställen, Pferchen und Unterkünften der Sklaven umher, als sei die ganze Welt ein einziger Spielplatz. Ich kannte keine Grenzen, wo es in dieser Welt doch auch so viel Spannendes zu entdecken gab.
Andere Sklaven hatten auch Kinder bekommen, so dass ich genügend Spielkameraden hatte. Dementsprechend wuchs ich in einer großen Familie auf. Der Zusammenhalt untereinander war deutlich. Es gab wenig Grund zur Klage.
Merep behandelte uns alle gut und gerecht, so dass wir uns nicht über ihn zu beklagen brauchten. Dass ich das Kind von Sklaven war, spürte ich von keiner Seite. Mereps Familie und Satepe, nahmen mich ab und zu zur Seite und behandelten mich wie einen von ihnen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mich Satepe einmal vom Pferd aus mit seinem langen Arm ergriff und mich mit einem Ruck zu sich auf das Pferd zog. Er setzte mich vor sich auf den Rücken des Pferdes. Damals war ich sechs Jahre alt. Stolz blickte ich zum ersten Mal in meinem Leben von einem Pferd auf die Welt herab. Es erfüllte mich ein Gefühl, als wenn ich sie beherrschen würde. Wie jauchzte ich vor Glück, als Satepe das Pferd zum Galopp antrieb. Die Erde raste unter den ausgreifenden Beinen des Pferdes dahin. Die Geschwindigkeit berauschte meine Sinne. Ich empfand unendliche Freiheit. Von da an liebte ich das Reiten. So einem Tag sollten noch viele folgen. Eigentlich kann ich rückblickend sagen, dass ich eine glückliche Kindheit hatte.
Dass ich das Kind von Sklaven war, die eigentlich aus dem einst großen Assyrien stammten, wurde mir jedes Mal bewusst, wenn ich abends mit meinem pitar, meinem Vater im Kerzenschein sprach. Von den großen und stolzen Königen sprach er, als wären sie immer noch lebendig. In seinen Geschichten und Gedanken waren sie es wohl auch noch. Seufzend und wehmütig berichtete er mir von dem ehemals herrlichen Ninive. Wie stolz diese Stadt doch einst strahlte. Sie bestand aus herrlichen Bauten und breiten Straßen. Die Frauen trugen schöne Kleider und schmückten ihr gepflegtes Haar. Fröhliche Kinder spielten in den Straßen.
Ninive war gänzlich von riesigen Mauern umgeben. Darin lebten Assyrer, die mit stolz geschwellter Brust umhergingen. Kein anderes Volk hatte es je mit Assyrien aufnehmen können, bis ... ja, bis ...!
Die unauslöschlichen Bilder aus seiner Kindheit konnte er nicht vergessen, immer wieder brachen sie aus ihm hervor. Auch ich konnte die Geschichten aus seiner Heimat nicht vergessen. Mein Leben lang haben mich die Erinnerungen meiner Eltern so fasziniert und bewegt, dass sie mich immer in Gedanken begleiteten. In meinem Herzen habe ich mich – egal wem ich gerade diente – immer als Assyrer gefühlt. Zusätzlich war ich anhaltend stolz darauf, ein Sohn des Gottes Assur zu sein. Niemand konnte mir meine Herkunft verleiden.
Die Jahre gingen ins Land. Allmählich wuchs ich heran. Die Zeit der unbeschwerten Kindheit, in der das Spielen das Wichtigste war, verging und wich zusehends der Arbeit, in die ich gedrängt wurde.
Was ich vom Landgut nicht schon vom Umhertollen kannte, wurde mir auf einem Rundgang gezeigt, damit ich ein guter arbeitender Sklave wurde. Da waren die Kornspeicher, daneben die Gebäude mit ihrem kühlen Keller und die vielen Ställe. In Tonkrügen, die in der kühlen Erde eingegraben waren, lagerten Bier und Most. Hühner und Gänseherden liefen herum und pickten die Getreidekörner auf, die auf dem Boden lagen. Schafe, Rinder und Pferde weideten auf den verschiedenen Wiesen.
Dahinter zogen sich Felder bis zu den Bergen hin, auf denen Gerste und Hirse wuchsen. Dieses ganze Land gehörte Merep, der mein Herr und Gebieter war.
Wenn dieser ausritt, brauchte er drei Stunden, um die Obst- und Weingärten, die gepflügten und ungepflügten Äcker, die Weideländer und die nötigen Bewässerungskanäle seines Landgutes zu besichtigen.
Eines Tages trottete ich mit dem Sklaven Target zurück von den Feldern, auf denen wir tagsüber unsere Arbeit verrichtet hatten. Target war ein ausgewachsener Mann von ungefähr vierzig Jahren, ich hingegen war gerade mal sechzehn. Wenige Haare bedeckten seinen Schädel. Seine Nase hing wie ein Haken in seinem Gesicht. Aber das war bei den Völkern, die im großen Bereich des Zweistromlandes wohnten, keine Seltenheit.
Er war genau wie ich auf dem Gut geboren, allerdings noch unter Mereps Vater. Mit Target verstand ich mich gut. Er war ein ruhiger Mensch und mit seinem Los als Sklave zufrieden. Wenn ich ihm sagte, dass wir keine freien Männer wären, entgegnete er mir stets:
»Was willst du denn noch? Bekommst du nicht etwa genug zu essen und hast du kein Dach über den Kopf? Wenn du ein sogenannter freier Mann wärst, müsstest du Tag für Tag dafür Sorge tragen, dass du nicht verhungerst. Vor allem, wenn du noch Familie hast, ist es schwer. So wird uns die Sorge wenigstens abgenommen, denn der Herr muss für uns sorgen. Ich kann mich jedenfalls nicht beklagen.«
Auf dieses Argument konnte ich wegen meiner geringen Erfahrung nichts entgegnen, und so beließ ich ihn bei seiner Meinung.
Wir sprachen ständig miteinander und er brachte mir viel über das Bauernleben bei. Wir waren tagsüber damit beschäftigt gewesen, eine neue Mauer zu errichten, damit das weidende Vieh nicht auf die neu ausgestreute Saat des Nachbarfeldes trampelte.
Als wir an dem Tag, der mein Leben für immer verändern würde, auf dem Gut ankamen, wollte ich sofort zu meiner Mutter ins Haus gehen, die bereits mit dem Essen auf mich wartete. Aber so weit kam ich nicht. Durch ein Stimmengewirr angelockt, traten Target und ich um die Sklavenunterkünfte herum und schritten auf die Ansammlung von Menschen zu, die sich vor Mereps Gutshaus aufgetan hatte. Alle dreißig Sklaven waren versammelt. Target und ich waren nun die Letzten, die hinzutraten. Wir waren ahnungslos über den Grund der Versammlung. Aus den durcheinander rufenden Stimmen war nichts Konkretes zu erfahren.
Merep war mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern auf den Stufen, die zu seinem Haus führten. Neben ihm stand Satepe mit verschränkten Armen. In seiner rechten Hand hielt er die Peitsche fest, die er zwar immer bei sich hatte, aber selten benutzte. Ohne Peitsche ging er nie aus dem Haus. Mit fragendem Blick sah ich meinen Herrn an, der nun ermutigend die Arme erhob.
»Jetzt beruhigt euch erst einmal. Ich sagte euch doch schon, dass sich für euch nichts ändern wird.«
»Das glauben wir aber nicht.«
»Doch. Der neue Herr hat es mir zugesichert. Ich danke euch allen für die Dienste, die ihr mir und meiner Familie in all den Jahren geleistet habt. Nun geht in eure Häuser und dient ihm genauso hingebungsvoll, wie ihr mir gedient habt.«
Mit gesenkten Köpfen trotteten wir Sklaven zurück in unsere Hütten und Häuser. Ich erblickte dabei meinen Vater und hielt ihn an. Meine Frage muss mir im Gesicht gestanden haben, denn mein Vater beantwortete sie mir, bevor ich in der Lage war, sie überhaupt zu stellen.
»Wir bekommen einen neuen Herrn, mein Sohn.«
»Aber warum? Merep gehört doch hier alles. Das ganze Tal zwischen den Bergen gehört unserem Merep. Seinem Vater und dessen Vater gehörte es auch schon. Sag mir Vater, was ist geschehen?«
Borsip selbst wusste auch nur das, was Merep den Sklaven gesagt hatte. Das gab er jetzt an Target und mich weiter.
»Merep hat alles verloren, alle seine Länder und seine Häuser. Ob er sein Gut beim Glücksspiel oder bei riskanten Geschäften verloren hat, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht ist er auch in Ekbatana beim neuen König Astyages in Ungnade gefallen und muss deshalb verschwinden. Ich weiß es nicht. Jedoch werden er und seine Familie in zwei Tagen abreisen. Wohin er reist, weiß niemand. Jedenfalls wird in den nächsten Tagen der neue Herr ankommen. Sein Name ist Daiaukas. Er wird alle Sklaven übernehmen. Für uns soll sich nichts ändern.«
Target fletschte hörbar die Zähne.
«Und das glaubst du? Ich bin vorsichtiger. Warten wir es ab.«
Mein Vater nickte. Auch er sträubte sich innerlich, bald einen neuen Herrn zu haben.
»Uns kann es doch egal sein, wem wir dienen. Ein Herr ist wie jeder andere. Merep war zwar ein guter Herr, doch ähnlich sind sie sich alle. Wir sind nur Sklaven, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen tun, was unsere Eigentümer sagen und ihnen gehorchen.«
»Dann werden wir also weiterhin so gute Arbeit leisten wie bisher und nichts wird sich für uns ändern?«
Mein Vater nickte, als er meine Frage vernahm. »Genau, Luskin, nichts wird sich für uns ändern.«
Der nächste Tag wurde damit zugebracht, die Kutschen mit den Habseligkeiten von Mereps Familie zu beladen. Die Sklaven, die nicht mit dem Beladen beschäftigt waren, gingen ihren täglichen Arbeiten nach. Die Sklaven versorgten die Tiere wie ehedem und gingen auf die Felder. Dennoch war es an diesem Tage anders. Wegen der ungewissen Zukunft für alle hatte sich eine bedrückte Stimmung auf dem Gut verbreitet.
Es war am Nachmittag, als plötzlich ein Reitertrupp auf dem Gut auftauchte und vor Mereps Haus anhielt. Der Anführer ließ seine sieben Männer absitzen, die ihre Pferde anbanden und sich dann in der Nähe aufstellten. Er selbst ging in das Haus, wo er von Merep empfangen wurde. Eine Stunde verging, ehe sie wieder hinaus kamen. Merep ließ sich sein Pferd bringen und ritt mit dem neuen Eigentümer und dessen Männern auf seinem Landgut, welches er für immer verlassen sollte, umher. In den Abendstunden kehrten sie gemeinsam wieder zurück. Inzwischen hatte der Koch den Männern ein Essen zubereitet worden. Anschließend wurde den Gästen gezeigt, wo sie die Nacht verbringen sollten.
Ich selbst ging an diesem unseligen Abend mit einer dunklen Vorahnung ins Bett. Ständig ertappte ich mich dabei, wie ich nervöse Blicke zum Haupthaus warf und so versuchte, irgendwelche Informationen aufschnappen zu können. Natürlich vergebens. Aber ich konnte die innere Unruhe nicht ignorieren. Von meiner Unterkunft aus war nur ein Stimmengewirr zu vernehmen. Es hielt so lange an, dass ich in dieser Nacht keine Ruhe mehr fand. An Schlaf war nicht zu denken. Aber am nächsten Tag erfuhr ich, dass es auch anderen so ergangen war.
Der Morgen graute. Bald waren alle Bewohner sowie die Gäste auf den Beinen. Wir hatten uns vor dem Haupthaus versammelt. Was würde nun mit uns geschehen? Mein Vater hatte recht, ging es mir durch den Kopf. Egal wer unser neuer Herr war, an unserer Situation würde sich dennoch nichts Grundlegendes ändern. Wir hatten zu gehorchen und zu arbeiten.
Merep trat auf die Stufen, die zu seinem Haus führten. Seine Familie stand regungslos etwas abseits. Der neue Eigentümer hatte sich links von Merep aufgestellt. Mereps Stimme klang beschlagen, als er das Wort an uns richtete.
»Männer und Frauen, ihr habt mir in all den Jahren gut gedient. Dafür möchte ich euch danken. Dies ist euer neuer Herr, Daiaukas. Seid ihm genauso gute Diener, wie ihr es mir und meiner Familie ward. Ich wünsche euch ein langes Leben.«
Das waren die letzten Worte, die ich von Merep vernahm. Er verabschiedete sich von Daiaukas und schritt mit gesenktem Kopf, gefolgt von seiner Familie, zur Kutsche. Er drehte sich nicht noch einmal um, als die Kutsche anfuhr und er sein ehemaliges Gut mit all seinen Habseligkeiten verließ. Wie fühlte es sich wohl an, das Land seiner Ahnen zu verlieren?
Im Gedenken an die gute Zeit mit dem gerechten Herrn Merep hatte sich bei uns Sklaven Wehmut im Herzen breitgemacht. Einige Frauen hatten Tränen in den Augen. Jeder fühlte den Verlust eines guten Menschen. Allen erging es so, bis auf Daiaukas und seinen Männern. Er war es auch, der uns aus unserer sentimentalen Träumerei an vergangene Zeiten in die Realität zurückholte. Daiaukas war ein Mann der Tat. Er verlor keine Zeit. Das sollten wir alsbald erfahren.
Daiaukas war ein Mann von ungefähr fünfzig Jahren. Stark und kräftig gebaut stand er vor uns. Seine Hände hatte er mit den Handflächen nach außen in den Seiten verschränkt. Sein voller Bart zeigte erste grauen Strähnen auf. Die Augen funkelten wie die eines Tigers, der zum Sprung bereit war. Er machte den Eindruck eines Mannes, der genau wusste, was er wollte. Imposant war seine Erscheinung, die darauf schließen ließ, dass er keine Widerrede dulden würde.
»Sklaven, hört mich an. Ich bin euer neuer Herr Daiaukas. Gestern habe ich das Gut von Merep übernommen und mir einen ersten Eindruck vom Zustand des Anwesens gemacht. Und ich muss euch sagen, dass mir nicht gefallen hat, was ich sah. Ihr seid ein faules Pack, doch das wird sich bald ändern. Ab heute werden hier andere Seiten aufgezogen. Es gibt zu viele Sklaven, deren Mäuler gestopft werden müssen. Einige von euch werde ich morgen in Ekbatana verkaufen.«
Abrupt drehte sich Daiaukas um und wandte sich an seine Männer, um ihnen Anweisungen zu geben. Derweil wurden wir zur Arbeit getrieben. Getrieben war das richtige Wort, denn mit dem gemütlichen Gang war es nun vorbei.
Den ganzen Tag über hingen meine Gedanken an der ungewissen Zukunft, die vor uns lag. Es dünkte mich, dass großes Unheil auf uns einströmte. Ein Gefühl der Schwäche und Hilflosigkeit hatte mich deshalb ergriffen und beinahe gelähmt. Denn die Unfähigkeit, nicht zu wissen, was in solchen Situationen das Richtige ist, führt zur Untätigkeit.
Schweigsam verbrachte ich mein Tageswerk. Target, der mit mir zusammen arbeitete, war ebenfalls in sich gekehrt. Nur einmal blickten wir auf, als zwei Reiter, die wir als Daiaukas Männer erkannten, zu uns kamen und unsere Arbeit beobachteten. Sie sprachen kein Wort, sondern sahen nur wenige Minuten zu und verschwanden bald darauf. Sie verschafften sich wohl einen Überblick über die Sklaven und deren zugewiesenen Arbeiten. Sobald sie weg waren, mutmaßte ich, dass sie mich wohl als unbrauchbar einstuften und dies Daiaukas mitteilen würde. Für so einen jungen, starken Mann wie mich, würde er auf dem Sklavenmarkt bestimmt einen guten Preis erzielen. Ich sah mich bereits entfernt von meiner Familie und dem Ort meiner Kindheit. Angesichts dieser Zukunft, die ich mir einredete, verdüsterte sich mein Gemütszustand zusehends. Aber wen interessiert schon der Gemütszustand eines Sklaven?
Später als sonst machten Target und ich uns auf den Heimweg. Es drängte uns nicht danach, die unausweichlichen Entscheidungen zu hören. Wir wollten sie zumindest hinauszuzögern. Andererseits ergriff mich auch die Furcht, dass sie nach uns suchen würden, wenn wir zu lange fortblieben. Also ergaben wir uns in unser Schicksal und betraten unsere Hütten.
Wie ich erwartet hatte, waren meine Eltern zu Hause und ihr Minenspiel verhieß mir nichts Gutes. Meine Matar, meine Mutter, sah mit verweinten Augen weg, als würde sie dadurch das schwere Los erträglicher oder gar ungeschehen machen können, während mein Vater niedergeschlagen vor sich hinsah. In seiner Hand hielt er seine wenigen persönlichen Gegenstände. Also wussten sie schon davon, dass ich verkauft werden sollte, redete ich mir währenddessen ein.
»Vater, sag mir, wer wird verkauft? Es ist doch schon bekannt, oder?« Das Reden fiel mir schwer, als hätte ich einen Kloß im Hals. Aber es musste raus. Ich war bereit, das Unausweichliche zu vernehmen.
»Ja, mein Sohn, es ist bekannt.«
»Deine Mutter und ich werden verkauft. Du bleibst hier. Außerdem gehen noch vier andere. Wir werden hier nicht mehr gebraucht, weil wir zu alt sind. Wir werden zwar getrennt, aber im Geiste werden wir immer bei dir sein, Luskin.« Die letzten Worte schluchzte er hervor. Ich konnte es nicht fassen. Es kam ganz anders, als ich es mir gedacht hatte. Nicht ich, sondern meine Eltern mussten gehen. Das war eine ganz neue Situation, mit der ich erst einmal fertig werden musste. So oder so, das Ergebnis war trotzdem das Gleiche. Wir würden getrennt werden.
»Was ist mit Simine?«
Mein Pitar lächelte mich gequält an. Doch dann schüttelte er sich leicht, als wolle er wieder zu sich kommen. Nun klang seine Stimme wieder fester.
»Sie bleibt hier bei dir. Bitte pass auf sie auf. Sie ist ein so zartes Geschöpf. Bei dir weiß ich sie in Sicherheit, jedenfalls soweit es in deiner Macht steht. Mehr kann ich leider nicht für sie tun.«
»Ich werde für sie da sein, Vater.«
Mehr sprachen wir nicht. Jedes weitere Wort an diesem Abend hätte die Wunde nur noch weiter vergrößert. Wir trauerten, ohne zu sprechen.
Am nächsten Morgen erwartete uns die Sonne wie gewohnt. Der Sonne war es gleich, welches Schicksal – ob grausam oder erfreulich – ein jeder Mensch oder Sklave zu ertragen hatte. Sie ging am Morgen auf und am Abend verschwand sie wieder. Was in dieser Zeitspanne geschah, war außerhalb ihrer Macht und ihres Interesses.
So war die Sonne nur ein stiller Beobachter, als Satepe die Kutsche vorfuhr. Danach ging alles ganz schnell. Die sechs Sklaven wurden mit ihren wenigen Habseligkeiten auf den Wagen beordert. Satepe führte den Sklaventransport an. Neben dem Kutscher begleiteten ihn noch drei von Daiaukas Männern. So waren für sechs Sklaven fünf Männer als Aufsicht abgestellt worden. Daiaukas wollte wohl sicher gehen, dass unterwegs kein Sklave flüchten und ihn somit um seinen Gewinn bringen konnte. Satepe hatte die nötigen Besitzurkunden bei sich, die er wohl verstaut an seinem Körper in einer Tasche trug. Auf dem Sklavenmarkt in Ekbatana würden die Sklaven jetzt noch einen erträglichen Preis erzielen. Auf dem Gut dagegen würden sie alt und vermutlich noch krank werden, und so nur noch mehr Kosten verursachen.
Als der Wagen anfuhr, stand ich schon mit Target auf einer Anhöhe weit vom Transport entfernt. Wir waren vorher zu unserer Arbeit gescheucht worden. Trotzdem ließ ich es mir nicht nehmen, meine Eltern zum Abschied zu umarmen. So blieben wir zum Zeitpunkt der Abfahrt in weiter Entfernung auf dem Weg zur Arbeit einfach stehen und sahen zu, wie der Wagen anrollte. Wir sprachen nicht und standen unbeweglich da, bis der Wagen hinter dem Berg in südlicher Richtung verschwunden war. Uns war klar, dass jeden von uns dieses Schicksal hätte treffen können. Wir waren nur Eigentum, regelrecht Spielbälle, mit denen der Eigentümer machen konnte, was ihm in den Sinn kam. Auch Target hätte es treffen können, da er selbst schon zu den älteren zählte. So war er selbst berührt und schwieg. Was hätten unsere Worte zu diesem Zeitpunkt auch bewegen können.
Am Abend war es ein seltsames Gefühl, als ich in unsere Hütte kam und die Leere mich empfing. Niemand fragte nach meinem Tageswerk, niemand nach meinem Befinden, oder ob ich großen Hunger hätte. Niemand war da, auch Simine nicht. Getreu dem Versprechen an meinen Vater, mich um meine Schwester zu kümmern, suchte ich sie sogleich. Dabei trieb mich nicht nur die Sorge um sie an, sondern auch mein Bedürfnis, mit einer Person meines Vertrauens sprechen und sie umarmen zu können. Doch war sie nirgends zu finden.
Ratlos lief ich einige Zeit umher und fragte andere Sklaven in der Nachbarschaft, doch niemand konnte mir eine befriedigende Auskunft geben. Als ich am Brunnen vor dem Gutshaus vorbeikam, war gerade eine Bedienstete des Haushalts des Daiaukas dabei, mit einem Eimer Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Durch sie erhielt ich eine Antwort, die mich erst völlig verwirrte und dann in den Zustand extremer Wut versetzte.
»Segetan, der Sohn von Daiaukas, hat sie zu seinem Kebsweib auserwählt. Sie wird jetzt immer das Bett mit ihm teilen.«
Nachdem meine erste Verwirrung vorüber war, hakte ich weiter nach.
»Aber war es denn ihr Wunsch? Wollte sie es?«
Sie sah mich mitleidig an, als hätte ich eine widersinnige Frage gestellt.
»Fragt uns jemand danach, was wir wollen?«
Mit diesen einfachen, aber alles erklärenden Worten verschwand sie mit ihrer schweren Last in dem Gutshaus.
Augenblicklich ergriff mich die Wut auf Segetan. Daiaukas Sohn war mir bis dahin nicht besonders aufgefallen. Ich erinnerte mich an einen jungen Mann mit pechschwarzem Haar und dünner Gestalt, der bei Daiaukas kurzer Rede neben ihm gestanden hatte. Das musste sein Sohn gewesen sein. Sein Alter schätzte ich auf Anfang zwanzig und somit war er ein paar Jahre älter als Simine. Sein schwarzer Bart war noch nicht so füllig. Das Gesicht wies keine besonderen Merkmale auf, außer dass er den entschlossenen Blick seines Vaters geerbt zu haben schien.
Ratlos stand ich da. Wie lange weiß ich nicht mehr. So bekam ich auch nicht mit, als die Sonne hinter den Bergen versank und die langen Schatten das Tal überzogen. Mit den letzten Sonnenstrahlen betrat ich die Hütte, die ich nunmehr alleine bewohnen würde. Meine Eltern waren verkauft und meine Schwester von einem von Geilheit getriebenen jungen Mann in sein Bett geholt worden. Sie würde erst wieder aus dem Gutshaus herauskommen, wenn er ihrer überdrüssig geworden war. Wann das aber geschehen würde und was dann aus meiner kleinen, zierlichen Schwester geworden sein würde, konnte niemand vorhersagen. Meine Sorgen um Simine wuchsen ins Unermessliche.
Ich hatte mich in meine Hütte, die mir so unendlich groß und leer vorkam, zurückgezogen und versuchte Ruhe zu finden. Doch stellte sie sich nicht ein.
Es war noch mitten in der Nacht, als mich die Ungeduld hochfahren ließ. Mein Lager gewährte mir nicht die Ruhe, die ich brauchte. So stand ich unvermittelt auf und trat langsam zum Gutshaus hinüber.
Natürlich war es den Sklaven untersagt, nachts ohne Grund herumzuschleichen, und schon gar nicht in der Nähe des Herrenhauses. Aber dies war mir zu diesem Zeitpunkt egal. Die Sorgen, die ich mir um Simine machte, trieben mich voran.
Ich hatte bereits meine Eltern verloren, also fühlte ich mich dazu verpflichtet, meine Schwester zu beschützen. Dieser Beschützerinstinkt ließ mich nicht mehr los. Kein Mensch war in dieser nächtlichen Stunde zu sehen. Anscheinend hatte Daiaukas keine Wachen aufgestellt. Jedenfalls sah ich keine. Auch brannten keine Fackeln. Dies alles ließ mich unvorsichtig werden, so dass ich mutig an die Hauswand treten konnte, an der ich Segetans Räume vermutete. Ich presste mich an die Wand und lauschte. Worauf ich wartete, wusste ich selbst nicht genau. Vielleicht auf irgendein Lebenszeichen von Simine. Es war schon eine gewisse Zeit vergangen, als ich es schließlich doch vernahm. Ein schluchzendes Weinen. Unverzüglich zogen sich meine Muskeln zusammen.
Simines Weinen erstarb jedoch gleich, nachdem ich mehrere klatschende Geräusche vernommen hatte, gefolgt von der herrischen Stimme eines Mannes. Seine genauen Worte waren nicht zu verstehen, dennoch konnte ich sie mir denken. Meine Faust ballte sich zusammen. Zorn stieg in mir auf, als ich ein rhythmisches und quietschendes Geräusch vernahm. Da ich damals jünger als meine Schwester war, wusste ich noch nicht genau, was dort auf der anderen Seite vor sich ging. Aber mit Sicherheit gefiel es Simine nicht. Es irritierte mich so sehr, dass ich mich zügig von der Hauswand löste und zurücktorkelte wie ein Mann, der zu viel Gegorenes getrunken hatte, unschlüssig, was ich nun tun sollte. Ein Gefühl der Ohnmacht stieg in mir auf. Es war niemand da, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit vergangen war, aber irgendwann hatte ich meine Hütte wieder erreicht und war auf mein Lager gefallen. Es dauerte zwar eine Weile, aber schließlich übermannte mich der Schlaf doch.
Am nächsten Tag merkte ich, dass Target schlechte Laune hatte. Er sprach zwar nicht davon, aber ich hatte gespürt, dass ihn etwas belastete. Versuche, ihn anzusprechen, wurden mit einer kurzen Handbewegung abgetan. Bald ließ ich es sein und ging meiner Arbeit nach.
Die Mauer wuchs zusehends. Mit den Ochsen, die vor dem Karren gespannt waren, hatten wir neue Steine gesammelt und sie zur Mauer gebracht. Wir waren dabei, die Steine auf der Mauer zu stapeln, so dass sie in sich stabil war und nicht umkippte. Insgesamt erreichte sie eine Höhe, die mir bis zur Hüfte reichte. Target bückte sich, hob die Steine vom Karren auf und reichte sie mir. Ich stapelte sie auf. Bald waren wir gut aufeinander eingespielt. Unverhofft unterbrach Target jedoch seine eintönige Tätigkeit und blickte nach Westen, wo das Gut lag. Als ich bemerkte, dass etwas seine Aufmerksamkeit erregt hatte, schaute ich ebenfalls in die Richtung und entdeckte zwei Reiter. Sie ritten geradewegs auf uns zu.
»Ich habe geahnt, dass heute etwas Unangenehmes passieren wird.« Das war Targets einziger Kommentar zu dem unerwarteten Besuch.
Als die beiden Reiter über die spärlich mit Gras bewachsenen Weide ritten, erkannte ich sie bald. Einer von ihnen war Segetan. Der andere war einer seiner Männer, mit dem ich noch nichts zu tun gehabt hatte und dessen Namen mir nicht geläufig war.
Während die Reiter auf uns zukamen und schließlich vor uns anhielten, standen wir bewegungslos am Karren. Segetan saß aufrecht auf seinem schwarzen Hengst. Vor sich auf dem Sattel hielt er eine einschwänzige Peitsche mit beiden Händen umschlossen. Sein Blick wirkte arrogant und ließ eine Spur von Spieltrieb erkennen. Das überhebliche Lächeln ließ mich nichts Gutes ahnen. Sein Begleiter dagegen wirkte teilnahmslos und verhielt sich still.
»Wie ich sehe, seit ihr hier fleißig.« Mit diesen Worten stieg Segetan von seinem Pferd und trat zur Mauer. Dort blieb er einen Moment stehen, bevor er sich plötzlich bewegte. Ein kräftiger Tritt seines rechten Fußes brachte einen Teil der Mauer zum Einsturz, wodurch die Steine polternd auf der anderen Seite hinabpurzelten.
»Aber wie ich sehe, macht ihr das nicht ordentlich.« Ein teuflisches Lächeln huschte über sein Gesicht. Target und ich blieben wie angewurzelt stehen. Uns war klar, dass er uns provozieren wollte, um uns auf diese Art seine Macht zu demonstrieren.
Mit einem Wink ließ er seinen Begleiter ebenfalls vom Pferd absteigen. Dieser stellte sich mit verschränkten Armen neben Segetan auf.
»Seht zu, dass ihr hiermit bald fertig werdet. Ich habe für euch beide noch eine andere und wichtigere Arbeit. Sie betrifft deine Schwester Simine. Sie ist doch deine Schwester, oder etwa nicht?«
Bei der Erwähnung von Simines Namen konnte ich mich nicht mehr zurückhalten.
»Was ist mit Simine?«, brüllte ich ihn entgegen.
Es freute ihn offensichtlich, dass er meinen wunden Punkt getroffen hatte, denn augenblicklich lachte er. Langsam trat er einen Schritt näher auf mich zu. Mir war klar, dass er genau wusste, was er tat.
»Oh, da macht sich ja jemand Sorgen um die kleine Hure. Was mit ihr geschehen soll, wirst du schon zu gegebener Stunde erfahren. Schließlich bist du ja nur ein Sklave und hast ohne Widerrede zu tun, was dir aufgetragen wird.«
Es war für mich unerträglich schwer, ruhig zu bleiben. Mein jugendliches Blut war kurz vorm Überkochen.
»Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gelenkig sie auf meinem Lager ist. Sie liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und ihre Schönheit wissen auch meine Männer zu würdigen. Stimmt’s?«
Mit diesen höhnischen Worten drehte er sich zu seinem Begleiter um. Das war zu viel für mich. »Lass deine dreckigen Hände von ihr.« Wut stieg in mir auf. Soeben hatte ich vergessen, dass ich nur ein Sklave war. Eigentlich hätte ich die Worte, die mir entglitten waren, bereuen sollen. Denn sie waren dafür verantwortlich, dass sich mein zukünftiges Leben radikal ändern sollte. Dennoch habe ich sie bis zum heutigen Tag nicht bereut. Der Mensch – auch wenn er nur ein Sklave ist – kann sich nicht alles gefallen lassen.
»Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Schließlich bin ich dein Herr, ansonsten lass ich dich meine Peitsche spüren.«
»Du Hund lässt deine Finger von meiner Schwester.«
Augenblicklich dämmerte mir, dass ich in meiner Wut meinen Gebieter beleidigt hatte. Ich hatte in meiner Unerfahrenheit und Unbeherrschtheit meinen Herrn als einen Hund beschimpft. Dies allein gab ihm schon das Recht, mich zu töten. Wie versteinert stand ich da und erwartete den Todesstoß.
Doch Segetan war nicht dumm. Da er mich für seine Provokation auserkoren hatte, musste er unweigerlich mit einer Reaktion meinerseits gerechnet haben. Aus diesem Grunde hatte er auch seinen Begleiter mitgebracht. Mit gefasstem Ton, dabei aber nicht bemüht sein zufriedenes Lächeln zu unterdrücken, gab er seinem Mann Anweisungen. Er war zufrieden, denn er hatte mich da, wo er mich haben wollte.
»Mach seinen Rücken frei und stell ihn so auf, dass er die Hände an den Karrenbrettern hat. Stell dich dann daneben und pass auf.«
Sein Handlanger riss mir das Hemd vom Rücken und stellte mich so an den Karren, dass ich mit dem Gesicht auf die Steine blickte. Dann stellte er sich breitbeinig mit gezücktem Schwert neben mich, um mich jederzeit bestrafen zu können, sollte ich den Versuch unternehmen, mich der Peitsche zu entziehen.
Mein blanker, striemenfreier Rücken dagegen lud Segetan geradezu ein, seinen Zorn auf mir zu entladen. Da ich mich nicht hatte beherrschen können, bekam ich nun die Strafe dafür. Nicht den Tod hatte er für mich vorgesehen, nein. Etwas viel Schlimmeres hatte er für mich geplant. Er gedachte mit mir zu spielen, mir seine Abneigung zu zeigen und ab und zu seine Peitsche spüren zu lassen. Dies konnte viel grausamer sein als der Tod. In Erwartung der Peitsche verkrampften sich meine Muskeln. Einmal hatte ich als Kind zugesehen, wie Satepe einen Sklaven auspeitschte, der gestohlen hatte. Mein damals empfundenes Mitleid für den Dieb stieg heute sogar noch in mir auf. Deshalb wusste ich, welche Schmerzen mich erwarteten.
»Du wirst mich nie wieder beleidigen, du Pariahund.«
Diese Worte begleiteten seinen ersten Peitschenhieb. Seinen ganzen Hass auf mich legte er in den Schwung, mit dem er ausholte. Die Peitsche hörte ich schon kommen, als sie noch durch die Luft sauste. Ich zuckte augenblicklich zusammen und verkrampfte, um so die Schmerzen zu lindern. Doch es war nutzlos. Ich spürte, wie die Haut in einer ellenlangen Spur auf meinem Rücken aufplatzte und das Blut langsam aus der Wunde trat, um mir warm den Rücken herunterzulaufen. Jedoch war kein Schrei aus meinem Mund entwichen.
»Solltest du es noch einmal wagen, dich gegen mich zu erheben, werde ich dir einen qualvollen Tod bereiten.«
Der zweite Peitschenhieb kündigte sich ebenfalls durch ein Zischen an, welches die Luft erfüllte. Als die Haut erneut auf meinem Rücken aufgeplatzt war, brannte die erste Wunde schon heftig.
Segetan ließ es sich nicht nehmen, erneut begleitende Worte an mich zu richten.
»Du bist Dreck, du assyrischer Pariahund.«
Und so ging es weiter. Ich zählte nicht mehr mit, dazu war ich nicht in der Lage. Je länger die Peitschenhiebe andauerten, desto weniger schmerzten sie mich. Krampfhaft biss ich meine Zähne zusammen. Eisern versuchte ich keinen Laut des Schmerzens, über meine Lippen kommen zu lassen. Das war es ja, was Segetan von mir hören wollte. Aber das ließ mein assyrischer Stolz nicht zu. Sollte er mir doch den Rücken entstellen. Meinen Stolz würde er nicht brechen können.
Irgendwann erstarben die Peitschenhiebe. Segetan war wohl der Meinung, dass es mir reichen könnte. Er gab seinem Mann den Befehl, ebenfalls auf das Pferd zu steigen.
»Jetzt wird weitergearbeitet. In drei Tagen ist die Mauer fertig. Wehe nicht. Sonst bekommt ihr beide noch einmal meine Peitsche zu spüren.«
So schnell wie sie gekommen waren, ritten sie auch wieder dahin. Mich ließen sie mit einem aufgeplatzten Rücken zurück. Er brannte auf der ganzen Fläche, als ob ein Feuer auf meinem Rücken wütete. Ich spürte, wie die Hautfetzen an meinem Rücken herabhingen. Es war mir unmöglich, mich zu bewegen.
Target, der die ganze Zeit schweigsam daneben gestanden hatte, trat sogleich zu mir. Er hob meine Oberbekleidung aus Leinenstoff auf, riss den Stoff in lange Streifen und säuberte dann die Wunde. Dabei tauchte er den Stoff in den Krug Wasser, den wir zum Trinken mitgenommen hatten. Das Wasser kühlte die Wunde und sorgte so für angenehme Linderung. Mit den anderen Streifen umwickelte er schließlich enganliegend meine Brust und den Rücken. Dann bettete er mich im Schatten unter den Karren, wobei ich auf dem Bauch liegen musste.
»Ruhe dich aus. Ich arbeite inzwischen weiter, damit wir in drei Tagen fertig sind, wenn er wiederkommt.«
Target war fleißig und arbeitete für mich mit. An diesem Tag war es für mich nicht mehr möglich, mich zu bewegen, geschweige denn zu arbeiten. Deshalb ging Target alleine vor Sonnenuntergang zurück und ließ mich auf dem Bauch unter dem Karren liegen. Auf dem Gut besorgte er Essen und Wasser für den nächsten Tag, kam dann eiligst zurück, damit er wieder bei mir war, bevor das ganze Tal in Dunkelheit versank. Ehe mich die Müdigkeit völlig ergriffen hatte, löste er noch mal den Verband und salbte mich mit einer Creme ein, die er von anderen Sklaven auf dem Gut erhalten hatte, um die Heilung zu fördern. Was die Bestandteile der Salbe waren, weiß ich bis heute nicht, aber die Salbe wirkte hervorragend. Nachdem ich von Target einen neuen Verband erhalten hatte, schlief ich sofort ein. So verbrachten wir gemeinsam unter dem Karren die ganze Nacht. Target war mir ein guter Freund und das werde ich ihm nicht vergessen.
Am nächsten Morgen schmerzte die Wunde nicht mehr so stark. Ich konnte mich wieder bewegen. Doch bevor ich mich an die Arbeit machte, wechselte Target erneut den Verband und versorgte die Wunde mit der Salbe. Nachdem ich Essen zu mir genommen hatte, wandte ich mich wieder den Steinen zu. Das Bücken war immer noch schmerzhaft, weil sich dabei die Haut straffte, doch gewöhnte ich mich mit der Zeit an die Schmerzen.
Bis zum Abend hatten wir viel geschafft und waren guten Mutes, dass wir unser Pensum in den drei Tagen erfüllen konnten. Meine Hütte erreichte ich erst, als die Nacht schon angebrochen war. Ich brach mir noch ein Laib Brot, doch schon beim Kauen fielen mir die Augenlider zu und ich versank in einen tiefen Schlaf.
Der darauffolgende Tag war nicht so heiß wie die vergangenen. Dichte Wolken hatten sich über dem Tal versammelt. Doch es regnete nicht. Die angenehme Kühle sorgte dafür, dass wir schneller arbeiten konnten. Mein zerschundener Rücken hinderte mich nicht mehr gravierend an der Arbeit. Im Gegenteil, der Schmerz spornte mich an. Ich wollte es Segetan zeigen. Er sollte sehen, dass ich mich davon nicht behindern ließ. Er sollte sehen, wozu ein assyrischer Pariahund in der Lage war.
Als der Nachmittag kam, waren wir sicher, die gesamte Mauer bis zur Nacht fertigstellen zu können. Das erfüllte uns mit Stolz und froher Erwartung, Segetans Gesicht zu sehen, wenn wir ihm die Nachricht von der Erfüllung seiner Forderung bringen würden. Er würde uns nicht kleinkriegen.
Es waren noch zwei Stunden bis zum Sonnenuntergang, als wir die letzte Fuhre mit Steinen entluden. Doch das sollte kein Problem darstellen, da nur noch drei Ellen Mauer zu fertigen waren. Das würden wir bis zur Dunkelheit schaffen.
Doch dann kam alles ganz anders. Zuerst war es nur ein kleiner Punkt am Horizont. Target richtete sich auf und zeigte dann auf den Reiter, der auf uns zu galoppierte. Allmählich weckte er auch mein Interesse und ich ließ von der Arbeit ab und starrte wie Target auf den Reiter. Ich musste kein Hellseher sein, um zu erkennen, wer dieser Reiter war. Es dauerte nicht lange und er stand vor uns. Wie drei Tage zuvor hielt Segetan die Peitsche vor sich fest. Seine Überlegenheit demonstrierend, blickte er auf uns herab.
Mir war sogleich aufgefallen, dass er diesmal nicht begleitet wurde.
»Wie ich sehe, seid ihr bald fertig. So dann werde ich mal die Festigkeit der Mauer überprüfen.«
Segetan stieg von seinem Pferd ab und schritt mit hoch erhobenen Hauptes zur Steinmauer. Was nun geschah, hatte ich schon einmal erlebt. Mit seinem rechten Fuß trat er erneut ein Loch in die Mauer. Auf der anderen Seite polterten die Steine herab. Als hätte er eine unglaubliche Leistung vollbracht, strahlte er mich triumphierend an. Mir dagegen war nicht zum Frohlocken zumute. Meine Wut im Zaun zu halten, schmerzte mich. Doch ich versuchte, mir die Demütigung nicht anmerken zu lassen.
»Was hast du ab morgen für eine Aufgabe für uns, Herr?«, fragte ich unterwürfig.
»Ach ja, morgen seit ihr ja hier fertig. Target soll sich bei Satepe melden. Er bekommt von ihm eine neue Aufgabe zugewiesen. Du dagegen, meldest dich bei Sonnenaufgang bei mir. Ich habe dir ja gesagt, dass es mit deiner Schwester zu tun hat. Na, du wirst aber Augen machen.«
Lachend warf er den Kopf zurück. Dann schwang er sich mit jugendlichem Elan auf den Rücken seines Pferdes.
»Wie du befiehlst, mein Herr.« Es fiel mir zusehends schwerer, Gehorsamkeit zu heucheln.
»Na, das hört sich ja schon besser an. Dann hat die Peitschenkur wohl doch geholfen. Wir sehen uns morgen. Ich habe noch zu tun. Deine Schwester, die kleine Hure, will ja auch noch von mir geritten werden.«
Sein höhnisches Lachen war der Funke, der meine Wut schließlich entzündete.
»Sie ist keine Hure,« schrie ich ihm entgegen.
»Höre ich da Widerworte? Schweig still. Wenn ich sie eine Hure schimpfe, so ist sie auch eine, du nichtsnutziger Pariahund.«
»Du dreckiger Meder bist selbst ein streunender Pariahund. Lass gefälligst deine Finger von meiner Schwester, sonst bekommst du es mit mir zu tun.«
Ungläubig sah Segetan mich an. Er konnte nicht glauben, dass ich den Mut aufbrachte, so mit ihm zu sprechen. Nachdem ein paar Sekunden der Verdutztheit vergangen waren, zog er behände seine Peitsche, ließ sie hoch in der Luft schwingen, um sie dann mit größter Geschwindigkeit vom Pferd aus auf mich niederknallen zu lassen.
Danach ging alles ganz schnell. Ich stamme von Assyrern ab, welche schon immer ein kriegerisches Volk waren. Auch wenn sie fast ausgelöscht sind, lebt in mir dieses Kämpferherz immer noch fort. Ohne nachzudenken, ergriff ich instinktiv mit der rechten Hand die surrende Peitsche, als sie auf mich niederschlug. Den Schmerz, der durch die aufgerissene Haut der Handfläche verursacht wurde, spürte ich gar nicht. Mit großem Kraftaufwand umfasste ich die Peitsche, während ich mit drei schnellen schwingenden Bewegungen die Peitschenschnur um mein Handgelenk wickelte. Ich spürte einen Widerstand, weil der verdutzte Segetan noch immer die Peitsche in seiner Hand hielt, also zog ich ruckartig mit all meiner Kraft. Dabei stemmte ich mich mit meinen nackten Füßen in den Boden. Von meiner Aktion überrascht, dachte Segetan nicht daran, sich am Pferd festzuhalten. Ich zog ihn wie einen nassen Sack aus dem Sattel, so dass er mit einem dumpfen Knall vor mir im Staub landete. Völlig verwirrt sah er mich an. Doch fasste er sich schnell und fand zu seinem Hass auf mich zurück.
In unseren Augen konnte ein jeder lesen, dass es ein Kampf auf Leben und Tod werden würde. Deshalb griff er, nachdem er seine Beherrschung wieder erlangt hatte, nach seinem Dolch, den er am Gürtel trug. Die Peitsche wickelte ich eilig wieder vom Handgelenk ab. Dann stürzte ich mich mit dem Mute der Verzweiflung auf ihn. Es gab für mich keine Alternative. Kämpfen oder sterben.
Er war zwar ein paar Jahre älter als ich, dennoch waren wir fast gleich stark, da die tägliche körperliche Arbeit meine jugendlichen Muskeln schon gehärtet hatten.
Mit meinen blutverschmierten Händen hielt ich ihn umschlungen, wir wälzten uns auf der Erde. Dennoch war es ihm gelungen, seinen Dolch zu ziehen. Aber um ihn erfolgreich in mich hineinstoßen zu können, fehlte ihm die Bewegungsfreiheit des rechten Armes. Noch immer kämpften wir umschlungen im Staub zwischen den Steinen. Keinem gelang es, die Oberhand zu gewinnen. Seinen Dolch hielt er noch immer wirkungslos in der Hand.
Doch schließlich gelang es ihm irgendwie, sein rechtes Bein zwischen meine Beine zu bekommen. Schnell bewegte er sein Bein nach hinten, um es mir mit äußerster Wucht in die Weichteile zwischen meinen Beinen zu stoßen. Dieser unerwartete Stoß raubte mir augenblicklich die Sinne. So einen Schmerz hatte ich noch nie erfahren.
Selbstverständlich löste ich daraufhin meine Umklammerung und Segetan erhielt durch seinen Trick seine Beweglichkeit zurück, die er auch gleich zu seinen Gunsten zu verwenden wusste.
Durch meine halb geschlossenen Augen konnte ich erkennen, wie Segetan zum entscheidenden Stich ausholte. Jetzt werde ich sterben, schoss es mir durch den Kopf. Mein Körper war ihm schutzlos ausgeliefert, während ich instinktiv meine Hände zum Schutz der schmerzenden Weichteile eingesetzt hatte.
Just als ich das Messer auf mich niedersausen sah, nahm ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Segetan wurde mit einem großen Gegenstand am Kopf getroffen, wodurch er sogleich in seiner Bewegung erstarrte und aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Mit starrem Blick rollte er von mir herunter. Sein Dolch folgte dieser Bewegung, fiel aus seiner Hand in den Staub.
Es vergingen einige Sekunden, bis ich begriffen hatte, was geschehen war. Mein Blick richtete sich auf Segetan, der bewegungslos dalag. Vor seinen Fingern lag der Dolch. Doch plötzlich bewegten sich seine Finger. Sein Arm streckte sich und gleich darauf hatte er den Dolch erneut in der Hand.
Obwohl ich immer noch diesen lähmenden Schmerz im Schritt verspürte, versuchte ich sofort mich zu wenden, um ebenfalls in den Besitz des Dolches zu gelangen, doch ich kam zu spät.
Als ich wenige Sekunden später den Dolch erneut auf mich zukommen sah, prallte ein weiterer Gegenstand mit einer solchen Wucht auf Segetans Schädel, dass ich den Knochen zerbersten hörte. Augenblicklich wusste ich, dass ich gerettet war und mir von Segetan nie wieder eine Gefahr drohte. Er hatte seine Überheblichkeit mit dem Leben bezahlt.
Target hatte mir das Leben gerettet. Zuerst hatte der alte Sklave gebannt den wälzenden Kampf verfolgt, doch als er gesehen hatte, wie die Klinge des Dolches mir das Leben aushauchen sollte, hatte er ohne viel Überlegung einen großen Stein ergriffen und ihn auf Segetans Kopf geschmettert. Doch dieser erste Schlag hatte ihn nur kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Als Segetan erneut angriff, reagierte Target sofort. Diesmal war sein Schlag effektvoller, denn er ließ den großen Stein aus seinen beiden Händen gezielt mit großer Wucht auf den Schädel herniedersausen. Das Knacken der Schädeldecke hatte ich ja deutlich vernommen.
Target hatte mir damit das Leben gerettet und uns beide aus dieser tyrannischen Sklaverei befreit. Vorerst jedenfalls, denn der Mord am Sohn unseres Herrn, Gebieters und Eigentümers sollte uns vor neue, fast unlösbare Probleme stellen.
Nachdem meine lähmenden Schmerzen langsam meinen Körper verließen, stand ich auf und bedankte mich bei Target für seine Rettung. Was er für mich getan hatte, war nicht selbstverständlich. Für ihn hätte es die lohnende Alternative gegeben, Segetan zur Seite zu stehen. Dies hätte ihm Ansehen bei seinem Herrn und sicherlich auch eine große Belohnung eingebracht. Sein Leben wäre in Zukunft sicherlich angenehmer verlaufen. Aber aus Freundschaft zu mir hatte er sich anders entschieden. Dies war mein Glück. Das werde ich ihm nie vergessen.
Nachdem ich ihm mit einer Umarmung gedankt hatte, kehrte die Nüchternheit in unsere Gedanken zurück. Was sollte jetzt geschehen? Ratlos sahen wir uns an.
»Wir müssen ihn verschwinden lassen,« schlug Target vor.
»Sicherlich. Am besten ist es, wenn wir ihn vergraben. Dann flüchten wir. Wir haben ja jetzt ein Pferd, das uns in der Dunkelheit weit bringen kann. Daiaukas und seine Männer werden sich morgen auf die Suche nach Segetan und seinem Pferd begeben. Doch sie werden beides nicht finden. Segetan bleibt vergraben und das Pferd hat uns schon lange aus dem Tal in die Freiheit und Sicherheit jenseits der Berge gebracht.«
Meine Augen funkelten vor Freude angesichts der rosigen Zukunft, die sich mir eröffnete. Mir erschien die Lösung meiner Probleme so einfach. Doch dem war nicht so. Target hatte andere Pläne.
»Du musst alleine reiten, Luskin. Ich komme nicht mit.« Leise klangen seine Worte. Die Unsicherheit war nicht zu überhören.
»Aber warum denn nicht?«
»Weil mir nichts passieren wird. Ich werde sagen, wie sich alles zugetragen hat und dass es Segetans Schuld war. Er hat dich gereizt, so dass du in deinem jugendlichen Leichtsinn nicht anders handeln konntest. Sein Tod ist aus Notwehr geschehen. Sorge dich nicht um mich. Mir wird schon nichts geschehen.«
Target war so eine treue Seele. Er war nie aus dem Tal herausgekommen und wusste nichts von der wirklichen Welt dahinter. Ich war ebenfalls noch nie aus dem Tal herausgekommen, doch spürte ich instinktiv, dass Target einem naiven Irrtum aufsaß.
»Das glaubst du doch selbst nicht. Du wärst sofort des Todes. Daiaukas ist es bestimmt völlig egal, wer die Schuld am Tod seines Sohnes trägt. Ob du ihn getötet hast, ob ich es tat oder es in Notwehr geschah. Das ist ihm egal. Sein Sohn ist tot, das ist das Entscheidende. Jemand wird dafür büßen müssen. Und wenn du dich ihm selbst auslieferst, wirst du den nächsten Morgen nicht erleben. Er wird für deinen qualvollen Tod sorgen. Da wird dir deine Ehrlichkeit wenig nützen. Target, mach keinen Fehler und komme mit mir. Nur so kannst du den morgigen Tag überleben.«
Spürbar war seine Verunsicherung, die meine Worte verursacht hatten.
»Meinst du wirklich?«
»Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben nur eine Chance zu überleben, wenn wir augenblicklich flüchten. Lass uns die Leiche vergraben. Im Schutz der Dunkelheit können wir mit dem Pferd über die Berge. So haben wir viele Stunden, wenn nicht sogar Tage Vorsprung, bis sie unsere Fährte aufgenommen haben. Ich will nicht erleben, wie mir bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wird. Mein Vater hat mir erzählt, wie das vor sich geht. Er hat es einmal in Ninive gesehen. Und ich möchte dies nicht an uns beiden praktiziert sehen. Also lass uns jetzt keine Zeit verlieren. In einer Stunde wird es dunkel sein. Außerdem müssen wir immer damit rechnen, dass Daiaukas Männer auf einem Kontrollritt sind.«
Meine Worte hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Ich, der Jüngling, hatte dem mehr als doppelt so alten Mann die Augen geöffnet und vor einem Fehler bewahrt. Langsam sah er ein, dass meine Worte sinnvoll waren und er ließ sich zu der Flucht überreden.
So gleich begannen wir auf der anderen Seite der Steinmauer ein Loch zu graben. Segetans Leiche legten wir, ohne weitere Worte zu verlieren, hinein und bedeckten sie mit Sand und Steinen. Schnell war das Loch wieder zugeschüttet, und die überschüssige Erde gleichmäßig in der Umgebung verteilt. Die Spuren hatten wir gut verwischt. Ständig wanderte unser sorgenvoller Blick nach Westen, dorthin wo Daiaukas Männer zu erwarten wären. Doch niemand ließ sich blicken.
Die Dämmerung setzte ein. Der Zeitpunkt war gekommen, um aufs Pferd zu steigen und unsere bisherige Heimat und den Ort des Verbrechens zu verlassen. Über die Richtung hatten wir uns schnell geeinigt. Nach Westen konnten wir nicht, weil da Daiaukas Gut lag. Nach Süden wären wir in die medische Hauptstadt Ekbatana gelangt. Das wäre für entlaufene Sklaven einem Todesurteil gleichgekommen. Auch nach Norden konnten wir nicht reiten, da uns hinter einer Bergkette ebenfalls ein Gut erwartete, auf dem Slaverei herrschte. Folglich blieb für uns nur die Flucht nach Osten. So verließen wir im Schutz der beginnenden Dunkelheit das Tal meiner Kindheit und Jugend. Von nun an sollte ich meine jugendliche Unbekümmertheit verlieren. Jene, welche ich im Schutze meiner Eltern und Satepes erleben durfte. Ein neues Leben begann für mich und Target.