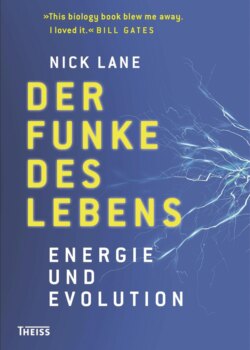Читать книгу Der Funke des Lebens - Ник Лейн - Страница 6
Einführung:
Warum ist das Leben so, wie es ist?
ОглавлениеIm tiefsten Inneren der Biologie klafft ein schwarzes Loch. Geradeheraus gesagt: Wir wissen nicht, warum das Leben ausgerechnet so ist, wie es ist. Alle komplexen Lebensformen der Erde haben einen gemeinsamen Urahnen, eine Zelle, die in dem langen Zeitraum von vier Milliarden Jahren bei einem einzigen Ereignis aus bakteriellen Vorstufen entstand. War das einfach nur ein irrer Zufall, oder schlugen andere „Experimente“ in der Evolution der Komplexität fehl? Wir wissen es nicht. Allerdings wissen wir, dass dieser gemeinsame Vorfahr bereits eine sehr komplexe Zelle war. Sie war mehr oder weniger genauso ausgefeilt wie eine von unseren Zellen, und diese Komplexität gab sie an Sie und mich und all ihre Nachfahren weiter, vom Baum bis zur Biene. Schauen Sie sich einmal eine Ihrer eigenen Zellen unter dem Mikroskop an und versuchen Sie, diese von der Zelle eines Pilzes zu unterscheiden. Beide sind praktisch identisch. Ich führe eindeutig ein ganz anderes Leben als ein Pilz – warum also ähneln sich unsere Zellen so sehr? Tatsächlich gleichen sie sich nicht nur im Aussehen. Alle komplexen Lebensformen haben erstaunlich viele Merkmale gemeinsam, vom Geschlecht über den programmierten Zelltod bis hin zum Altern, die allesamt bei Bakterien keine Entsprechung besitzen. In der Wissenschaft herrscht Uneinigkeit darüber, weshalb ein einziger Vorfahr so viele einzigartige Merkmale in sich vereinte und weshalb sich offensichtlich keines davon unabhängig auch bei den Bakterien entwickelte. Wenn all diese Merkmale infolge der natürlichen Selektion entstanden, bei der ja jeder Entwicklungsschritt einen kleinen Vorteil mit sich bringt, warum entwickelten sich dann nicht bei anderer Gelegenheit vergleichbare Merkmale bei den verschiedenen Bakteriengruppen?
Diese Fragen werfen ein Licht auf den besonderen Entwicklungsweg, den das Leben auf der Erde genommen hat. Es entstand etwa 500 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde, vor rund vier Milliarden Jahren. Dann blieb es jedoch mehr als zwei Milliarden Jahre lang, fast die Hälfte des Alters unseres Planeten, in seiner Komplexität auf der Stufe der Bakterien stehen. Bakterien sind bis heute morphologisch (nicht jedoch biochemisch) einfach gestrickt, also seit vier Milliarden Jahren. Dagegen leiten sich alle morphologisch komplexen Organismen – alle Pflanzen, Tiere, Pilze, Algen und einzelligen „Protisten“, wie die Amöben – von jenem einzelnen Urahn ab, der vor etwa 1,5–2 Milliarden Jahren existierte. Dieser Urahn war eindeutig eine „moderne“ Zelle mit ausgefeilter innerer Struktur und nie dagewesener molekularer Dynamik, angetrieben durch eine komplizierte Nanomaschinerie, für die wiederum Tausende neuer, bei Bakterien weitgehend unbekannter Gene codierten. Evolutionäre Zwischenstufen oder „Missing Links“, die Aufschluss darüber geben könnten, wie oder warum diese komplexen Merkmale entstanden, haben nicht überdauert. So bleibt einfach eine unerklärliche Lücke zwischen der morphologischen Einfachheit der Bakterien und der überwältigenden Komplexität aller anderen Lebewesen. Eben ein evolutionäres schwarzes Loch.
Alljährlich fließen Milliarden von Euro in die biomedizinische Forschung, die unvorstellbar komplizierten Fragestellungen nachgeht, um herauszufinden, warum wir krank werden. Wir haben detaillierteste Kenntnisse über die Beziehungen zwischen Genen und Proteinen und darüber, wie vernetzte Regelkreise einander beeinflussen. Wir konstruieren ausgefeilte mathematische Modelle und entwickeln Computersimulationen, mit denen wir unsere Prognosen überprüfen. Aber wir wissen nicht, wie sich die einzelnen Teile entwickelten! Wie können wir darauf hoffen, Krankheiten zu verstehen, wenn wir keine Ahnung haben, warum Zellen gerade so arbeiten, wie sie arbeiten? Wir können eine Gesellschaft nicht verstehen, wenn wir ihre Geschichte nicht kennen, und genauso wenig können wir die Abläufe in der Zelle verstehen, wenn wir nicht wissen, wie ihre Evolution verlaufen ist. Das ist nicht nur von praktischer Bedeutung, sondern berührt auch die große Frage, warum es uns Menschen überhaupt gibt. Welche Gesetze ließen das Universum entstehen, die Sterne, die Sonne, die Erde und das Leben? Werden dieselben Gesetze an anderer Stelle im Universum ebenfalls Leben hervorbringen? Wären außerirdische Lebensformen den irdischen vergleichbar? Genau solche metaphysischen Fragen sind es, die uns erst zum Menschen machen. Rund 350 Jahre nach der Entdeckung der Zellen wissen wir immer noch nicht, warum das Leben auf der Erde so ist, wie es ist.
Vielleicht ist Ihnen bisher noch gar nicht aufgefallen, dass wir es nicht wissen. Das ist nicht Ihr Fehler. Lehrbücher und Fachjournale wimmeln nur so von Informationen, versäumen es aber oft, Antworten auf diese einfachen „Kinderfragen“ zu finden. Das Internet überschwemmt uns schier mit ununterscheidbaren Fakten, vermischt mit variablen Anteilen von echtem Blödsinn. Doch das Problem liegt nicht nur im Zuviel an Informationen. Nur wenige Biologen sind sich des schwarzen Lochs im Innersten der Biologie klar bewusst. Die überwiegende Mehrheit erforscht große Organismen, bestimmte Pflanzen- oder Tiergruppen. Eher wenige befassen sich mit Mikroben und noch weniger mit der Evolution der Zellen. Außerdem gibt es Bedenken im Hinblick auf Kreationismus und Verfechter des Intelligent Design – wenn wir zugeben, dass wir nicht alle Antworten kennen, öffnet das womöglich jenen Tür und Tor, die abstreiten, dass wir überhaupt etwas darüber wissen, wie Evolution vonstattengeht. Aber das tun wir natürlich. Wir wissen sogar ziemlich viel darüber. Hypothesen über den Ursprung des Lebens und die Anfangszeit der Evolution der Zellen müssen unendlich viele Tatsachen erklären, dabei streng mit dem bisherigen Wissensstand konform gehen und überdies unerwartete Zusammenhänge vorhersagen, die sich empirisch überprüfen lassen. Wir wissen recht viel über die natürliche Selektion und einiges über die eher zufälligen Abläufe, die Genome gestalten. All diese Fakten lassen sich mit der Evolution der Zellen vereinbaren. Aber eben diese strengen Vorgaben der Fakten werfen das Problem überhaupt erst auf. Wir wissen nicht, warum das Leben ausgerechnet diese und keine andere Entwicklung genommen hat.
Wissenschaftler sind neugierige Menschen, und wenn dieses Problem so offenkundig wäre, wie ich es hier darstelle, wäre es weithin bekannt. Tatsächlich aber liegt es keineswegs auf der Hand. Die verschiedenen miteinander konkurrierenden Antworten sind esoterisch und verschleiern die Frage eigentlich nur noch mehr. Problematisch ist außerdem, dass Hinweise zur Lösung aus etlichen unterschiedlichen Fachrichtungen kommen, von der Biochemie und Geologie über Phylogenetik, Ökologie und Chemie bis hin zur Kosmologie. Kaum jemand ist auf all diesen Gebieten bewandert. Zudem stecken wir heute mitten in einer Genom-Revolution. Wir verfügen über Tausende kompletter Genomsequenzen, Codes mit Millionen oder Milliarden von Codons, die allzu oft widersprüchliche Signale aus der fernen Vergangenheit vermitteln. Die Interpretation dieser Daten setzt straffes Wissen auf den Gebieten Logik, Datenverarbeitung und Statistik voraus; biologische Kenntnisse sind nur das Sahnehäubchen. Darum kursieren bis heute massenhaft Argumente. Und immer, wenn sich der Argumentenebel lichtet, erscheint eine zunehmend surreale Landschaft. Die alten, tröstlichen Ansichten haben sich in Luft aufgelöst. Heute stehen wir vor einem nüchternen neuen Bild, das zugleich real und beunruhigend ist – aus Sicht des Forschers, der ein signifikantes neues Problem finden will, das er lösen kann, ist es sogar äußerst spannend! Die größten Fragen in der Biologie sind noch immer nicht beantwortet. Mit diesem Buch will ich mich an einen ersten Versuch wagen.
In welchem Zusammenhang stehen Bakterien und komplexe Lebensformen? Die Anfänge dieser Frage gehen bis zur Entdeckung der Mikroorganismen durch den niederländischen Mikroskopiker Antoni van Leeuwenhoek in den 1670er-Jahren zurück. Seine Menagerie von „kleinen Tierchen“ (animalcula), die unter dem Mikroskop gediehen, erschien zunächst unglaublich, wurde aber schon bald durch den ebenso genialen Robert Hooke bestätigt. Leeuwenhoek entdeckte auch die Bakterien und schrieb in einem berühmten Aufsatz von 1677 über sie. Sie waren „unglaublich klein, in meinen Augen so klein, dass ich schätzte, dass 100 von ihnen aneinandergelegt nicht die Länge eines groben Sandkorns erreichen würden; und entsprechend dieser Schätzung könnten zehnmal Hunderttausend von ihnen nicht das Ausmaß eines Kornes solchen groben Sandes erreichen.“ Viele zweifelten an, dass Leeuwenhoek mit seinen einfachen (also mit nur einer Linse ausgestatteten) Mikroskopen Bakterien gesehen haben könnte, doch heute ist dies unumstritten. Zwei Fakten stechen besonders heraus. Er fand überall Bakterien – im Regenwasser wie im Meer, nicht nur auf seinen eigenen Zähnen. Und er unterschied intuitiv diese „äußerst winzigen Tierchen“ und die „gigantischen Ungeheuer“ – mikroskopisch kleine Protisten! – mit ihrem faszinierenden Verhalten und „kleinen Füßchen“ (Cilien). Er bemerkte sogar, dass einige größere Zellen aus mehreren kleinen „Kügelchen“ bestanden, die er (wenn auch mit anderen Worten) mit den Bakterien verglich. Unter diesen Kügelchen erblickte Leeuwenhoek mit ziemlicher Sicherheit auch den Zellkern (Nukleus), der bei allen komplexen Zellen die Gene in sich birgt. Und auf diesem Stand blieb die Sache dann für Jahrhunderte. Der berühmte Systematiker Carl von Linné fasste 50 Jahre nach Leeuwenhoek alle Mikroben einfach in der Gattung Chaos („Unordnung“) in der Klasse Vermes („Gewürm“) zusammen. Im 19. Jahrhundert nahm Ernst Haeckel, der große deutsche Evolutionsforscher und Zeitgenosse Darwins, die deutliche Unterscheidung erneut vor und stellte die Bakterien abseits der anderen Mikroben. Begrifflich aber gab es bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts kaum Fortschritte.
Die biochemische Vereinheitlichung brachte dann die Lösung. Aufgrund ihrer enormen metabolischen Vielseitigkeit hatten die Bakterien bis dahin als nicht kategorisierbar gegolten. Sie können überall wachsen, auf Beton, in Batteriesäure und Gasen. Wenn diese so vollkommen unterschiedlichen Lebensweisen nichts gemeinsam hatten, wie sollte man Bakterien dann wohl klassifizieren? Und wie sollte man sie verstehen, wenn sie nicht klassifiziert waren? So wie das Periodensystem der Elemente Ordnung und Kohärenz in die Chemie brachte, so brachte die Biochemie Ordnung in die Evolution der Zellen. Albert Kluyver, ebenfalls Niederländer, wies nach, dass hinter der außerordentlichen Vielfalt der Lebewesen durchaus ähnliche biochemische Prozesse steckten. So unterschiedliche Vorgänge wie Atmung, Gärung und Fotosynthese hatten allesamt eine gemeinsame Grundlage, eine konzeptuelle Integrität, der zufolge alle Lebewesen von einem gemeinsamen Urahnen abstammten. Was für Bakterien galt, so Kluyver, das galt auch für Elefanten. Auf biochemischer Ebene besteht kaum ein Unterschied zwischen Bakterien und komplexen Zellen. Bakterien sind um ein Vielfaches vielseitiger, aber die grundlegenden lebenserhaltenden Prozesse sind ähnlich. Kluyvers Schüler Cornelis van Niel kam mit Roger Stanier dem Erkennen des Unterschieds wohl am nächsten: Ihnen zufolge sind Bakterien, wie Atome, nicht weiter teilbar, sondern bilden die kleinste Funktionseinheit. Viele Bakterien können genauso Sauerstoff atmen, wie wir es tun, aber dazu braucht es das gesamte Bakterium. Anders als bei unseren Zellen gibt es keine Atmungsorganellen. Bakterien teilen sich zwar, wenn sie sich vermehren, aber funktionell sind sie nicht teilbar.
Dann folgte die erste der drei großen Umwälzungen, die unser Bild vom Leben im vergangenen halben Jahrhundert auf den Kopf stellten. Diese erste Revolution wurde im „Summer of Love“ 1967 von Lynn Margulis losgetreten. Komplexe Zellen entwickelten sich, so Margulis, nicht durch herkömmliche natürliche Selektion, sondern durch eine wahre Kooperationsorgie, bei der Zellen derart eng miteinander interagierten, dass sie sogar ins Innere ihrer Partner vordrangen. Eine Symbiose ist eine langfristige Interaktion zwischen zwei oder mehr Spezies, meist eine Art Handel mit „Waren“ oder „Dienstleistungen“. Im Falle der Mikroben sind die Waren die Substanzen des Lebens, Substrate des Stoffwechsels, Treibstoffe des zellulären Lebens. Margulis verwendete den Begriff Endosymbiose – dieselbe Art Handel, aber nun so intensiv, dass einige der kollaborierenden Zellen physisch im Inneren ihrer Wirtszelle leben, wie die Händler im Tempel. Vergleichbare Ideen waren schon um die Jahrhundertwende formuliert worden, und ihnen erging es in gewisser Weise ähnlich wie der Lehre von der Plattentektonik. Es „sieht so aus“, als seien Afrika und Südamerika einst aus einem Stück gewesen und später auseinandergedriftet, doch diese kindliche Vorstellung wurde lange als absurd verlacht. Ebenso verhält es sich mit einigen Strukturen im Inneren komplexer Zellen: Sie „sehen so aus“ wie Bakterien und scheinen sich sogar unabhängig zu entwickeln und zu teilen. Vielleicht war die Erklärung ja tatsächlich so einfach – es sind Bakterien!
Wie die Plattentektonik war auch diese Theorie ihrer Zeit voraus. Erst im Zeitalter der Molekularbiologie, in den 1960er-Jahren, ließen sich dazu starke Argumente erbringen. Margulis tat dies am Beispiel zweier spezialisierter Strukturen im Zellinneren – den Mitochondrien, Orten der Atmung, in denen Nährstoffe mit Sauerstoff verbrannt werden und Energie frei wird, und den Chloroplasten, den Fotosynthesekraftwerken in Pflanzen, die Sonnenenergie in chemische Energie umwandeln. Beide Organellen („Miniaturorgane“) verfügen noch über winzige eigene Genome mit jeweils einer Handvoll Gene. Diese codieren für höchstens ein paar Dutzend Proteine, welche bei der Atmung oder Fotosynthese beteiligt sind. Die exakten Sequenzen dieser Gene verrieten es schließlich: Mitochondrien und Chloroplasten leiten sich tatsächlich von Bakterien ab. Ich verwende bewusst das Wort „ableiten“, denn es sind keine Bakterien mehr. Sie haben ihre Unabhängigkeit eingebüßt, denn die Mehrheit der für ihre Existenz benötigten Gene (mindestens 1500) befinden sich im Zellkern, dem genetischen „Steuerungszentrum“ der Zelle.
Margulis hatte recht mit den Mitochondrien und Chloroplasten; in den 1980er-Jahren hegten daran nur noch wenige Zweifel. Doch sie wollte auf mehr hinaus: Für Margulis setzte sich die gesamte komplexe oder „eukaryotische“ (mit einem echten Zellkern ausgestattete) Zelle aus etlichen Symbiosen zusammen. Ihrer Ansicht nach leiteten sich viele andere Bestandteile komplexer Zellen, insbesondere die Cilien (Leeuwenhoeks „Füßchen“), ebenfalls von Bakterien ab, in diesem Fall von Spirochäten. Es gab eine lange Reihe von Zusammenschlüssen, wie Margulis nun in ihrer Endosymbiontentheorie formulierte. Nicht nur einzelne Zellen, sondern die ganze Welt war ein großes Netzwerk bakterieller Kollaboration – die „Gaia-Hypothese“, eine Idee, die Margulis zusammen mit James Lovelock aufbrachte. Dieses Gaia-Konzept hat inzwischen in der förmlicheren Gestalt der „Erdsystemwissenschaft“ (unter Abzug von Lovelocks ursprünglicher Teleologie) eine Renaissance erlebt; die Vorstellung von komplexen eukaryotischen Zellen als Ensemble von Bakterien hat dagegen deutlich weniger Anhänger. Die meisten Zellstrukturen sehen nicht so aus, als leiteten sie sich von Bakterien ab, und auch die Gene geben darauf keine Hinweise. Margulis hatte also in manchen Dingen recht und in manchen Dingen mit ziemlicher Sicherheit unrecht. Doch die missionarische Energie dieser Frau, ihre Ablehnung der darwinschen Konkurrenz und ihr Hang zu Verschwörungstheorien bewirkten, dass sie, als sie 2011 viel zu früh durch einen Schlaganfall starb, ein zwiespältiges Erbe hinterließ. Für manche war sie eine feministische Heldin, für andere ein wandelndes Pulverfass. Vieles von dem, was von ihr blieb, hatte mit Wissenschaft nur noch entfernt zu tun.
Revolution Nummer zwei war die phylogenetische Revolution – die Lehre von der Abstammung der Gene. Diese Möglichkeit war von Francis Crick bereits 1958 vorweggenommen worden, als er mit typischer Gelassenheit schrieb: „Die Biologen sollten sich darüber im Klaren sein, dass es über kurz oder lang eine Fachrichtung namens ‚Protein-Taxonomie‘ geben wird – die Erforschung der Aminosäurensequenzen von Organismen und der Vergleich derselben bei unterschiedlichen Arten. Diese Sequenzen dürften wohl den Phänotyp eines Organismus am exaktesten wiedergeben, und es ist anzunehmen, dass in ihnen ungeheure Informationsmengen zur Evolution verborgen sind.“ Und siehe, so geschah es. Heute dreht sich in der Biologie sehr viel um die in den Sequenzen von Proteinen und Genen verborgenen Informationen. Wir vergleichen heute nicht mehr die Aminosäuresequenzen direkt, sondern die „Buchstaben“-Abfolgen in der DNA (die für Proteine codiert), die noch genauere Daten liefern. Doch bei aller Weitsicht machte sich weder Crick noch sonstwer eine Vorstellung davon, welche Geheimnisse die Gene tatsächlich enthüllen sollten.
Diese Revolution wurde von Carl Woese ausgefochten. Er hatte seine Arbeit in den 1960er-Jahren in aller Stille aufgenommen, und sie sollte erst ein Jahrzehnt später Früchte tragen. Woese wählte ein einziges Gen zum Vergleich zwischen Arten aus. Dieses Gen musste natürlich bei allen Spezies vorliegen, und es musste überdies demselben Zweck dienen. Dieser Zweck musste von so grundlegender Wichtigkeit für die Zelle sein, dass schon leichte Veränderungen in seiner Funktion durch die natürliche Selektion bestraft würden. Wenn die meisten Veränderungen eliminiert sind, muss das, was geblieben ist, relativ stabil sein – es muss sich extrem langsam weiterentwickeln und über riesige Zeitspannen hinweg nur geringfügig verändern. Das ist notwendig, wenn man die Unterschiede, die buchstäblich über Jahrmilliarden hinweg zwischen den Arten heranwachsen, vergleichen und einen umfassenden, bis an den Anfang des Lebens zurückreichenden Stammbaum konstruieren will. Etwas in dieser Größenordnung hatte Woese im Sinn. Mit Blick auf all diese Anforderungen wandte er sich schließlich einer grundlegenden Eigenschaft aller Zellen zu: der Fähigkeit, Proteine zu synthetisieren.
Proteine werden in erstaunlichen, in allen Zellen anzutreffenden Nanomaschinen zusammengebaut, den Ribosomen. Abgesehen von der DNA-Doppelhelix ist wohl nichts symbolträchtiger für das Informationszeitalter der Biologie als das Ribosom. Seine Struktur steht außerdem für einen Widerspruch, den der menschliche Geist kaum erfassen kann – die Größenverhältnisse. Das Ribosom ist unvorstellbar winzig. Schon Zellen sind mikroskopisch klein; über die meiste Zeit unseres Daseins auf Erden hinweg hatten wir keinen blassen Schimmer von ihrer Existenz. In einer einzigen menschlichen Leberzelle gibt es 13 Millionen Ribosomen. Doch diese sind nicht nur unvorstellbar klein, sondern dabei auch noch massive, hochkomplizierte Superkonstruktionen. Sie bestehen aus zahllosen substanziellen Untereinheiten, beweglichen Maschinenteilen, die präziser arbeiten als ein automatisches Fertigungsband. Das ist nicht übertrieben! Sie lesen den „Ticker-Streifen“ mit dem Code für ein Protein ein und übersetzen seine Sequenz exakt, Buchstabe für Buchstabe, in das Protein selbst. Dazu ziehen sie alle benötigten Bauteile (Aminosäuren) heran und fügen sie in einer langen Kette zusammen. Die Reihenfolge der Aminosäuren ist durch das Codeskript festgelegt. Ribosomen haben eine Fehlerrate von etwa einem Buchstaben unter 10.000; diese ist weitaus geringer als bei unseren anspruchsvollen heutigen Herstellungsprozessen. Sie arbeiten überdies mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Aminosäuren pro Sekunde und stellen komplette Proteine mit Ketten aus Hunderten von Aminosäuren in weniger als einer Minute her. Woese wählte eine Untereinheit des Ribosoms, sozusagen ein einzelnes Teil der Maschine, aus und verglich dessen Sequenz bei verschiedenen Arten, von Bakterien wie Escherichia coli (E. coli) über Hefen bis hin zum Menschen.
Seine Ergebnisse waren eine echte Offenbarung und stellten unser Weltbild auf den Kopf. Er konnte ohne Schwierigkeiten zwischen den Bakterien und komplexen Eukaryoten unterscheiden und legte den phylogenetischen Baum der genetischen Verwandtschaft innerhalb und zwischen diesen Hauptgruppen offen. Die einzige Überraschung war, wie gering die Unterschiede zwischen Pflanzen, Tieren und Pilzen waren, jenen Gruppen, mit deren Erforschung die meisten Biologen den größten Teil ihres Arbeitslebens verbringen. Was jedoch niemand geahnt hatte, war die Existenz einer dritten Domäne des Lebens. Einige dieser einfachen Zellen waren schon seit Jahrhunderten bekannt gewesen, aber fälschlich den Bakterien zugeordnet worden. Sie sehen aus wie Bakterien – wirklich genau wie Bakterien: Sie sind genauso winzig, und auch ihnen fehlt eine erkennbare Struktur. Doch der Unterschied in ihren Ribosomen war wie das Grinsen von Alices Grinsekatze – er verriet, dass da noch etwas anderes sein musste, was bisher verborgen geblieben war: Diese neue Gruppe hatte vielleicht nicht die Komplexität der Eukaryoten, aber ihre Gene und Proteine unterschieden sich in geradezu schockierendem Ausmaß von denen der Bakterien. Diese zweite Gruppe einfacher Zellen erhielt den Namen Archaea, da man annahm, dass sie älter sind als die Bakterien. Das trifft vermutlich nicht zu; heute ist man der Ansicht, dass beide Gruppen gleich alt sind. Doch auf der Ebene ihrer Gene und biochemischen Eigenschaften ist die Kluft zwischen Bakterien und Archaeen genauso groß wie zwischen Bakterien und Eukaryoten (also uns). Fast buchstäblich. Bei Woeses berühmtem phylogenetischem Baum mit den „drei Domänen“ des Lebendigen sind Archaeen und Eukaryoten „Schwestergruppen“, die einen nicht allzu weit in der Vergangenheit lebenden gemeinsamen Vorfahren haben.
In mancher Hinsicht haben Archaeen und Eukaryoten durchaus viel gemeinsam, besonders was den Informationsfluss angeht (also wie sie ihre Gene auslesen und in Proteine übersetzen). Im Grunde verfügen Archaeen über einige ausgefeilte molekulare Maschinerien, die denen der Eukaryoten ähneln, auch wenn sie aus weniger Teilen bestehen. Sie bilden sozusagen eine Vorstufe für die eukaryotische Komplexität. Woese lehnte die Vorstellung von einer tiefen morphologischen Kluft zwischen Bakterien und Eukaryoten ab und postulierte stattdessen drei gleichrangige Domänen, von denen jede große evolutionäre Bereiche erobert hatte und keine den Vorrang gegenüber den anderen beiden verdiente. Vor allem aber missbilligte er den althergebrachten Begriff „Prokaryot“ (wörtlich „vor dem Zellkern“, was auf Archaeen und Bakterien zutreffen würde), denn sein phylogenetischer Baum lieferte keine genetische Grundlage für diese Unterscheidung. Ganz im Gegenteil reichten alle drei Domänen in seiner Darstellung weit in die Vergangenheit zurück, wo sie sich aus einem rätselhaften gemeinsamen Vorfahren „herauskristallisiert“ hatten. Im höheren Lebensalter äußerte sich Woese fast mystisch über jene evolutionären Frühstadien und forderte eine holistischere Betrachtungsweise des Lebens. Das wirkt seltsam, basierte doch die von ihm losgetretene Revolution auf einer gänzlich reduktionistischen Analyse eines einzigen Gens. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Bakterien, Archaeen und Eukaryoten grundlegend unterschiedliche Gruppen sind und Woeses Revolution real war, doch seine Empfehlung einer holistischen Sicht, die Organismen als Ganzes und komplette Genome berücksichtigt, bringt aktuell die dritte zelluläre Revolution auf den Weg – die seine eigene wieder aufhebt.
Diese dritte Revolution ist noch im Gange. Ihre Argumente sind ein wenig subtiler, aber sie hat es ganz besonders in sich. Ihre Wurzeln liegen in den ersten beiden Revolutionen, insbesondere in der Frage: Wie sind wir miteinander verwandt? Woeses phylogenetischer Baum zeigt die Divergenz eines grundlegend wichtigen Gens in den drei Domänen des Lebendigen. Margulis dagegen präsentierte Gene unterschiedlicher Arten, die bei der Verschmelzung und Übernahme im Zuge der Endosymbiose zusammenfanden. Als Baum gezeichnet, ist dies ein Zusammenwachsen, keine Gabelung von Zweigen – das Gegenteil von dem, was Woese darstellte. Sie können nicht beide recht haben! Zugleich haben beide nicht ganz unrecht. Die Wahrheit liegt, wie so oft in der Wissenschaft, irgendwo dazwischen. Aber das bedeutet keineswegs, dass sie ein Kompromiss ist. Die Antwort, die sich gerade herausbildet, ist aufregender als alles andere.
Wir wissen, dass sich Mitochondrien und Chloroplasten tatsächlich via Endosymbiose aus Bakterien ableiten, während sich die anderen Bestandteile komplexer Zellen vermutlich auf herkömmlichem Wege entwickelten. Die Frage ist nun: Wann war das genau? Chloroplasten findet man nur in Algen und Pflanzen, sie wurden also höchstwahrscheinlich von einem Vorfahren nur dieser beiden Gruppen erworben. Somit wären sie eine relativ späte Errungenschaft. Mitochondrien dagegen findet man bei allen Eukaryoten (einen Hintergrundaspekt dazu werden wir in Kapitel 1 beleuchten), sie müssen also früher aufgenommen worden sein. Aber wie früh, oder anders gefragt: Was für eine Zelle war es, die die Mitochondrien aufnahm? Die herkömmliche Lehrbuchmeinung besagt, dass es sich um eine relativ hoch entwickelte Zelle handelte, wie eine Amöbe, eine räuberische Lebensform, die sich fortbewegen, ihre Form verändern und andere Zellen per Phagozytose „fressen“ kann. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. In den letzten Jahren ergaben Vergleiche zahlreicher Gene bei einer repräsentativeren Auswahl von Spezies eindeutig, dass jene erste Wirtszelle ein Archaeon war, eine Zelle aus der Domäne Archaea. Alle Archaeen sind Prokaryoten. Sie haben per definitionem keinen Zellkern, pflanzen sich nicht geschlechtlich fort und zeigen auch sonst keine Merkmale komplexer Lebensformen, auch keine Phagozytose. Morphologisch muss die Ausstattung der Wirtszelle praktisch gleich null gewesen sein. Irgendwie legte sie sich dann die Bakterien zu, aus denen die Mitochondrien entstanden. Erst danach entwickelte sie all ihre komplexen Merkmale. Wenn dies zutrifft, war der einzigartige Ursprung der komplexen Lebensformen vielleicht auf die Einverleibung der Mitochondrien angewiesen. Diese lösten ihn auf irgendeine Weise aus.
Diese radikale Vermutung – komplexe Lebewesen entstanden aus einer singulären Endosymbiose zwischen einer Archaeon-Wirtszelle und den Bakterien, die zu Mitochondrien wurden – wurde 1998 von dem genial intuitiv und frei denkenden Evolutionsbiologen William Martin vorgebracht; sie fußte auf dem außergewöhnlichen Mosaik von Genen in eukaryotischen Zellen, das Martin zum größten Teil selbst ermittelt hatte. Nehmen wir eine einzelne biochemische Reaktionskette, beispielsweise die Gärung. Archaea vollführen sie auf die eine Weise, Bakterien auf eine andere; die daran beteiligten Gene sind nicht dieselben. Eukaryoten haben ein paar Gene von Bakterien und ein paar andere von Archaeen übernommen und diese zu einer eng geknüpften Reaktionskette zusammengefügt. Eine solche komplizierte Fusion von Genen findet sich nicht nur bei der Gärung, sondern bei praktisch allen biochemischen Reaktionen in komplexen Zellen. Unfassbar!
Martin hat sich mit all dem sehr eingehend beschäftigt. Warum übernahm die Wirtszelle so viele Gene von ihren Endosymbionten, und warum verankerte sie diese so fest in ihrem eigenen Genmaterial und ersetzte dabei viele vorhandene Gene? Ihre Antwort darauf formulierten Bill Martin und Miklós Müller in der „Wasserstoff-Hypothese“ (hydrogen hypothesis). Ihrer Ansicht nach war die Wirtszelle ein Archaeon, das zwei einfache Gase zum Leben brauchte, Wasserstoff und Kohlendioxid. Der Endosymbiont (das zukünftige Mitochondrium) war ein vielseitiges Bakterium (der Normalfall unter Bakterien), das seine Wirtszelle mit dem von ihr zum Wachstum benötigten Wasserstoff versorgte. Die Einzelheiten dieser Beziehung, Schritt für Schritt logisch dargelegt, erklären, warum eine Zelle, die anfangs von einfachen Gasen lebte, schließlich organische Substanzen (Nahrung) aufnimmt, um ihre Endosymbionten zu ernähren. Doch es ist nicht dieser Punkt, der uns interessiert. Entscheidend ist Martins Folgerung, nach der komplexe Lebensformen durch eine singuläre Endosymbiose zwischen nur zwei Zellen entstanden. Seiner Ansicht nach war die Wirtszelle ein Archaeon, dem die üppige Komplexität eukaryotischer Zellen fehlte. Seiner Ansicht nach gab es nie eine einfache Zwischenform eukaryotischer Zellen ohne Mitochondrien; die Aneignung der Mitochondrien und der Ursprung der komplexen Lebensformen war ein und dasselbe Ereignis. Und seiner Ansicht nach entwickelten sich all die ausgefeilten Merkmale komplexer Zellen, vom Nukleus über Sex bis hin zur Phagozytose, nach der Aufnahme der Mitochondrien, im Zusammenhang mit dieser einzigartigen Endosymbiose. Dies ist eine der großartigsten Erkenntnisse in der Evolutionsbiologie, und sie verdient viel größere Bekanntheit. So wäre es auch, würde sie nicht so leicht mit Lynn Margulis’ Endosymbiontentheorie verwechselt (die, wie wir noch erfahren werden, keine dieser Ansichten teilt). All diese konkreten Folgerungen wurden in den letzten 20 Jahren durch die Genomforschung ganz und gar gestützt. Ein Monument der Macht biochemischer Logik. Gäbe es einen Nobelpreis für Biologie, niemand hätte ihn mehr verdient als Bill Martin.
Und so schließt sich der Kreis. Wir wissen ungeheuer viel, aber wir wissen immer noch nicht, warum das Leben so ist, wie es ist. Wir wissen, dass komplexe Zellen durch ein einziges Ereignis in vier Milliarden Jahren der Evolution entstanden, durch eine singuläre Endosymbiose zwischen einem Archaeon und einem Bakterium (Abbildung 1). Wir wissen auch, dass sich die Merkmale komplexer Lebensformen erst nach dieser Vereinigung entwickelten, doch wir wissen bis heute nicht, warum diese besonderen Eigenschaften bei den Eukaryoten entstanden, offensichtlich aber weder bei den Bakterien noch bei den Archaeen. Wir wissen nicht, was die Bakterien und Archaeen daran hindert – warum sie also morphologisch schlicht bleiben, obwohl sie doch biochemisch und genetisch so unterschiedlich sind, so vielseitig in ihren Fähigkeiten und sogar von Gasen und Gestein leben können. Allerdings steht uns nun ein radikal verändertes Denkgerüst zur Verfügung, vor dessen Hintergrund wir diesen Fragen nachgehen können.
Ein zusammengesetzter Stammbaum, der komplette Genome berücksichtigt, wie ihn Bill Martin 1998 abgebildet hat. Gezeigt sind die drei Domänen Bacteria, Archaea und Eukaryota. Eukaryoten entstanden als genetische Chimären aus einer Archaeen-Wirtszelle und einem bakteriellen Endosymbionten. Aus der Wirtszelle entwickelten sich schließlich die morphologisch komplexen eukaryotischen Zellen, aus dem Endosymbionten die Mitochondrien. Eine Gruppe von Eukaryoten nahm später einen zweiten bakteriellen Endosymbionten auf, aus dem sich die Chloroplasten der Algen und Pflanzen entwickelten.
Abbildung 1: Phylogenetischer Baum mit Darstellung des chimärenhaften Ursprungs komplexer Zellen
Meiner Ansicht nach ist der merkwürdige Mechanismus der biologischen Energiegewinnung innerhalb der Zellen der Schlüssel, denn er erlegt den Zellen tief greifende, aber wenig beachtete physikalische Einschränkungen auf. Im Grunde dient allen lebenden Zellen ein Strom von Protonen (positiv geladenen Wasserstoffatomen) als Antrieb, wobei eine Art Elektrizität – Protizität – entsteht, mit Protonen statt Elektronen. Die Energie, die wir aus dem Verbrennen von Nährstoffen bei der Atmung gewinnen, dient dazu, Protonen durch eine Membran zu pumpen, sodass sie sich auf einer Seite der Membran anreichern. Strömen die Protonen aus diesem Reservoir wieder zurück, kann das genauso als Antrieb dienen wie bei einer Turbine in einem Staudamm. Die Nutzung von Protonengradienten über Membranen als Antrieb für Zellen war eine völlig unerwartete Entdeckung. Dieses Konzept wurde 1961 erstmals postuliert und in den nachfolgenden drei Jahrzehnten von einem der unkonventionellsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, Peter Mitchell, weiterentwickelt. Man bezeichnete es auch als die wohl abwegigste Idee in der Biologie seit Darwin und die einzige, die mit den Ideen von Einstein, Heisenberg und Schrödinger in der Physik vergleichbar sei. Auf Ebene der Proteine wissen wir heute genau, wie der Protonenantrieb funktioniert. Wir wissen auch, dass Protonengradienten bei allen Lebewesen der Erde eine Rolle spielen – der Protonenantrieb ist genauso ein integraler Bestandteil des Lebens wie der universelle genetische Code. Allerdings wissen wir praktisch nichts darüber, wie oder warum sich dieser abwegig erscheinende Mechanismus der Energiegewinnung ursprünglich entwickelte. Im Kern der heutigen Biologie stehen also, wie mir scheint, zwei große unbeantwortete Fragen: Warum entwickelte sich das Leben in der erstaunlichen Weise, wie es das tat, und warum nutzen die Zellen einen so merkwürdigen Antrieb?
In diesem Buch möchte ich versuchen, diese Fragen zu beantworten, die in meinen Augen miteinander in engem Zusammenhang stehen. Ich hoffe, Sie davon zu überzeugen, dass Energie für die Evolution eine zentrale Rolle spielt und wir die Eigenschaften des Lebendigen nur verstehen können, wenn wir die Energie in die Gleichung mit aufnehmen. Ich möchte Ihnen demonstrieren, dass dieser Zusammenhang zwischen Energie und Leben von Anfang an bestand – dass die grundlegenden Merkmale des Lebens zwangsläufig aus dem Nicht-Gleichgewicht auf einem ruhelosen Planeten entstand. Ich möchte Ihnen zeigen, dass der Ursprung des Lebens durch strömende Energie angetrieben wurde, dass Protonengradienten für das Entstehen von Zellen eine zentrale Rolle spielten und dass ihre Nutzung der Struktur von Bakterien und Archaeen Grenzen setzt. Ich möchte demonstrieren, dass diese Einschränkungen die spätere Evolution der Zellen bestimmten und dafür sorgten, dass die Bakterien und Archaeen bei aller biochemischen Virtuosität doch auf ewig eine einfache Morphologie behalten werden. Ich möchte beweisen, dass ein einzigartiges Ereignis, eine Endosymbiose, bei der ein Bakterium in ein Archaeon aufgenommen wurde, diese Einschränkungen aufhob und die Evolution weitaus komplexerer Zellen ermöglichte. Ich möchte Ihnen darlegen, dass das keine einfache Sache war – dass die intime Beziehung zwischen Zellen, von denen eine in der anderen lebt, erklärt, weshalb morphologisch komplexe Organismen nur ein einziges Mal entstanden. Ich hoffe überdies, Sie davon zu überzeugen, dass diese intime Beziehung sogar einige Merkmale komplexer Zellen bedingt. Diese Merkmale sind unter anderem der Nukleus, Sex, zweierlei Geschlechter und sogar die Unterscheidung zwischen der unsterblichen Keimbahn und dem sterblichen Körper – die Ursprünge einer begrenzten Lebensdauer und des genetisch vorherbestimmten Todes. Zu guter Letzt möchte ich Sie davon überzeugen, dass uns die Betrachtung unter energetischen Gesichtspunkten Vorhersagen bezüglich einiger Aspekte unserer eigenen Biologie gestattet, insbesondere dem evolutionär bedingten Tauschgeschäft von Fruchtbarkeit und Fitness in jungen Jahren gegen Alterung und Krankheit im höheren Lebensalter. Mir gefällt der Gedanke, dass diese Erkenntnisse uns womöglich zu besserer Gesundheit oder zumindest zu einem besseren Verständnis derselben verhelfen.
Mancher mag es nicht schätzen, auf diese Weise für die Wissenschaft zu sprechen, aber genau dies ist in der Biologie eine gute Tradition, die bis auf Darwin selbst zurückgeht; er bezeichnete sein Buch Die Entstehung der Arten als „one long argument“ („eine lange Beweisführung“). Mit einem Buch lässt sich immer noch am besten darlegen, welchen Zusammenhang man im großen Ganzen der Wissenschaft zwischen bestimmten Fakten sieht – eine Hypothese, die der Gestalt der Dinge einen Sinn zu geben versucht. Peter Medawar beschrieb eine Hypothese als imaginären Sprung ins Unbekannte. Hat man den Sprung einmal gewagt, wird eine Hypothese zum Versuch, eine für Menschen verständliche Geschichte zu erzählen. Eine wissenschaftliche Hypothese muss Thesen aufstellen, die überprüfbar sind. In der Wissenschaft gibt es keine größere Beleidigung als zu sagen, ein Argument sei „noch nicht einmal falsch“, will sagen: Es ist so unwissenschaftlich, dass es sich sogar jeder Widerlegung entzieht. In diesem Buch also werde ich eine Hypothese aufstellen – eine zusammenhängende Geschichte erzählen –, die Energie und Evolution verknüpft. Das werde ich so detailliert tun, dass ich durchaus widerlegt werden könnte, und zugleich werde ich so verständlich und spannend schreiben, wie ich kann. Diese Geschichte basiert zum Teil auf meiner eigenen Forschung (die Originalartikel sind im Literaturverzeichnis aufgeführt) und zum Teil auf der Forschung anderer. Ich habe äußerst fruchtbar mit Bill Martin in Düsseldorf zusammengearbeitet, der, wie ich feststellen musste, ein verblüffendes Talent dafür besitzt, richtig zu liegen, mit Andrew Pomiankowski, einem mathematisch denkenden Evolutionsgenetiker und traumhaften Kollegen am University College London, sowie mit einigen äußerst versierten Doktoranden. Es war und ist mir eine Ehre und riesige Freude, und wir stehen erst ganz am Anfang eines langen Weges.
Ich habe mich bemüht, dieses Buch kurz und prägnant zu schreiben und mich mit Exkursen und interessanten, aber vielleicht etwas abwegigen Geschichten zurückzuhalten. Das Buch ist eine Beweisführung, so knapp und so detailliert wie nötig. Es mangelt nicht an Metaphern und (wie ich hoffe) unterhaltsamen Einzelheiten; andernfalls fände sich wohl kein allgemein interessierter Leser für ein Buch über die Biochemie des Lebens. Nur wenige können sich ohne Weiteres die fremde submikroskopische Landschaft aus gigantischen, miteinander in Wechselwirkung befindlichen Molekülen vorstellen, also den eigentlichen Schauplatz des Lebens. Entscheidend aber ist die Wissenschaft, und so habe ich das Buch auch geschrieben. Es ist eine gute, altmodische Tugend, die Dinge beim Namen zu nennen – auf den Punkt und ohne großes Drumherum. Sie wären schnell genervt, wenn ich alle paar Seiten erwähnen würde, dass, sagen wir, ein Spaten ein Grabwerkzeug ist, mit dem man Gruben oder Gräber aushebt. Zwar ist es weniger hilfreich, ein Mitochondrium Mitochondrium zu nennen, doch ist es ebenso holprig, etwas zu schreiben wie „alle großen, komplexen Zellen wie die unseren enthalten Miniaturkraftwerke, die vor langer Zeit aus freilebenden Bakterien entstanden und heute praktisch alle Energie liefern, die wir benötigen“. Ich könnte stattdessen einfach schreiben: „Alle Eukaryoten besitzen Mitochondrien.“ Das ist eindeutiger und knackiger. Wenn man gegen ein paar Fachbegriffe nichts einzuwenden hat – sie vermitteln einfach mehr Informationen, und das so pointiert, dass sich in diesem Fall sofort die Frage stellt: Wie kam es dazu? Das führt direkt an die Grenze zum Unbekannten, dorthin, wo die Wissenschaft am interessantesten ist. Ich habe also einerseits versucht, nicht mehr Fachsprache zu verwenden als nötig, hoffe aber, dass Sie mit ein paar wiederkehrenden Fachbegriffen vertraut werden. Für alle Fälle habe ich am Ende ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen angehängt. Wenn dies hin und wieder konsultiert wird, ist dieses Buch hoffentlich für jeden mit Interesse am Thema zugänglich.
Und ich hoffe wirklich, dass das Thema Sie interessiert! So merkwürdig sie erscheinen mag, diese schöne neue Welt – sie ist durch und durch aufregend: die Ideen, die Möglichkeiten, die beginnende Erkenntnis über unseren Platz in diesem schier unendlichen Universum. Ich skizziere eine neue und größtenteils noch nicht kartierte Landschaft, einen Blick aufs Ganze, vom Ursprung des Lebens bis zu unserer Gesundheit und Sterblichkeit. Diese enorme Bandbreite wird dankenswerterweise von ein paar einfachen Ideen überspannt, die etwas mit Protonengradienten über Membranen zu tun haben. In meinen Augen sind die besten Biologiebücher seit Darwin Beweisführungen, und dieses Buch soll diese Tradition möglichst fortführen. Ich werde darlegen, dass die Energie der Evolution des Lebens Grenzen gesetzt hat, dass dieselben Kräfte überall im Universum wirken sollten und dass die Verknüpfung von Energie und Evolution die Grundlage für eine Biologie sein könnte, die bessere Vorhersagen erlaubt. So würde sie uns helfen zu verstehen, warum das Leben so ist, wie es ist – nicht nur auf der Erde, sondern wo auch immer es im Universum vorkommen mag.