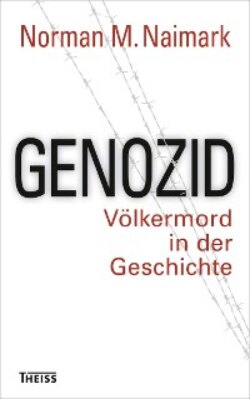Читать книгу Genozid - Norman Naimark - Страница 9
Kriegergenozide
Оглавление„Sie kamen, sie zerstörten, sie brandschatzen, sie töteten, sie plünderten und sie zogen weiter.“1 Diese Beschreibung der Einfälle der Mongolen von einem Zeitgenossen deutet die enge Verflechtung von Genozid und Krieg im gesamten Verlauf der Geschichte an. Selbst in Friedenszeiten kann ein drohender Krieg oder die augenscheinliche Notwendigkeit, sich auf einen Krieg vorzubereiten, genozidale Situationen entfesseln. Krieg ist keine notwendige Voraussetzung für Genozid und nicht in jedem Krieg kommt es zu einem Genozid. Dennoch wird Genozid im Allgemeinen mit Kriegsabsichten, Kriegspolitik und Kriegshandlungen in Verbindung gebracht.2 Dies gilt für die Antike ebenso wie für die Gegenwart. Tatsächlich trägt die allgemein sinkende Anzahl an Kriegen und zivilen Konflikten im Lauf der Jahrhunderte zweifellos zu einem Rückgang an Genoziden bei.
Die enge Verknüpfung von Krieg und Genozid macht eine Unterscheidung zwischen der militärischen Vernichtung von Feinden im Krieg und einem Völkermord bisweilen äußerst schwierig. Die Vorstellung von Krieg als einem begrenzten Urkonflikt zwischen zwei aufeinandertreffenden Armeen trifft nur einen Teil dessen, was Krieg ist und was er bedeutet. Selbstverständlich gibt es eine Geschichte von Zusammenstößen auf dem Schlachtfeld und eine Geschichte strategischer und taktischer Entscheidungen, ganz zu schweigen von Fragen des Kampfgeistes und der Ausrüstung, die in eine Kriegsentscheidung einfließen. Doch auch die Heimatfront spielt im Krieg eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Unter der Zivilbevölkerung kommt es fast immer zu schweren Verlusten und Frauen, Kinder sowie alte Menschen sind hiervon aufs Engste betroffen. Von den Kriegen der Antike über die napoleonischen Feldzüge zu Beginn des 19. Jahrhunderts (die mitunter als der erste „totale“ Krieg gelten) und den Gräueln des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurde die Grenze zwischen militärischer Front und Heimatfront immer fließender. Es wird mitunter behauptet, nur im 20. Jahrhundert habe der Krieg mehr Zivilisten als Soldaten das Leben gekostet. Diese Behauptung lässt sich allerdings schwerlich verteidigen, wenn man den kriegsbedingten Hunger, die Krankheiten und Epidemien in früheren Zeiten hinzurechnet.
In den Kriegergesellschaften des Mittelalters ist es häufig äußerst schwer, das Töten von Feinden im Gefecht von völkermordähnlichen Aktionen zu trennen. Im Westen vermischten sich Vorstellungen von Ritterlichkeit auf dem Schlachtfeld mit der barbarischen Bereitschaft, ganze Gruppen von Feinden auszulöschen, was häufig mit religiösen („christlichen“) Argumenten gerechtfertigt wurde. Im Osten metzelten mongolische Krieger aufgrund von vermeintlichen Kränkungen oder Widerstand gegen die unvermeidbare Oberhoheit der Mongolen mitunter ebenfalls ganze Gruppen von Feinden nieder. Beobachter aus dem 21. Jahrhundert sollten jedoch auf der Hut sein und die Besonderheiten einer fernen Welt, in diesem Fall der Welt der Kreuzfahrer und mongolischen Krieger, nicht allzu leicht mit denen ihrer modernen Entsprechungen vermengen. Zugleich sollten die weitreichenden Massaker an Zivilisten in einstigen Kriegergesellschaften nicht grundsätzlich von den Genoziden der modernen Welt getrennt werden.
Das Mongolenreich, das riesige Gebiete zwischen dem Pazifik im Osten und Zentraleuropa im Westen, den Ländern Arabiens und Indien im Süden sowie Sibirien und die russische Tundra im Norden beherrschte, war eines der erfolgreichsten politischen Gebilde der gesamten Menschheitsgeschichte. Zum Zeitpunkt seiner größten geografischen Ausdehnung im 13. und 14. Jahrhundert war es das größte zusammenhängende Reich in der Weltgeschichte und herrschte über 100 Millionen Menschen. In ihren Ursprüngen waren die Mongolen jedoch ein Nomadenvolk, das sich durch Reitkunst und Kämpfe hervorgetan und wenig mit Industrie oder städtischem Leben und städtischer Kultur im Sinn hatte. Dieser Geist prägte noch immer seine Machthaber. Das Reich entwickelte zudem die außergewöhnliche Fähigkeit, sich der Begabungen anderer für seine Verwaltung und seine wirtschaftlichen Interessen zu bedienen und die Fertigkeiten von Handwerkern und Kriegsexperten aus den zahlreichen eroberten Stämmen und Völkern zu nutzen. Mit seinem überlegenen Nachrichten- und Geheimdienstsystem sowie seiner militärischen Stärke, die sowohl auf der wohlüberlegten Organisation seiner Armee als auch auf der Selbstgenügsamkeit seiner Reiterkrieger gründete, trieb das Mongolenreich wirtschaftlich weitaus komplexere und kulturell weiter entwickelte König- und Kaiserreiche vor sich her.
Historiker beurteilen das Mongolenreich aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Manche betonen die positiven Dimensionen der Pax Mongolica, innerhalb derer sich Handel, Gewerbe und Ideen ungehindert entfalten konnten, unter anderem entlang der Seidenstraße, der sagenumwobenen Verbindung zwischen Europa und Asien, die etwa Marco Polo vom Italien der Renaissance nach Beijing und wieder zurück führte. Die Mongolen tolerierten im Allgemeinen religiöse Unterschiede und förderten damit den Austausch zwischen den kulturell vielfältigen Glaubensgemeinschaften in Zentral- und Südasien, Europa und dem Nahen Osten.
Rassische, ethnische oder sprachliche Unterschiede interessierten sie kaum, was sich letztlich positiv auf das Nachrichtennetz und die Durchmischung von Völkern und Kulturen in ihrem riesigen Reich auswirkte. Die Vertrauten von Generälen und Beamten repräsentierten zumeist eine breite Vielfalt an Nationalitäten und Religionen Eurasiens. Wie neuere Forschungsergebnisse zeigen, kommt ein dominantes Y-Chromosom bei einem Achtel der Bevölkerung eines größeren eurasischen Gebiets vor, was darauf hindeutet, wie häufig die mongolischen Khane – die Nachfahren des ersten großen Mongolenherrschers Dschingis Khan – in die Königsfamilien von eroberten oder einverleibten Gebieten einheirateten und zugleich Konkubinen aus unterschiedlichsten Völkern hatten.
Andere Historiker betonen den hohen Blutzoll, den die Eroberungen der Mongolen forderten. In zwei Jahrhunderten Mongolenherrschaft kamen über 30 Millionen Menschen in Kriegen und bei Vergeltungsmaßnahmen ums Leben.3 Die Bevölkerung des ungarischen Königreichs dezimierte sich nach dem Mongolensturm von zwei Millionen auf eine Million. In den 50 Jahren mongolischer Herrschaft soll sich auch die Bevölkerung Chinas um die Hälfte von 120 Millionen auf 60 Millionen reduziert haben. Kritiker dieser Zahlen haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Chinesen schwerlich von den mongolischen Volkszählungen erfasst wurden, sodass sich solche Zahlen nicht verifizieren ließen. Ähnlich streitet man darüber, ob das „mongolische Joch“, wie es in Russland noch immer heißt, zu einer ähnlichen Entvölkerung und Beeinträchtigung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in der von den Ostslawen besiedelten Region führte.
Seine Entstehung verdankte das Mongolenreich einem bis dahin relativ unbekannten Stammeschef, Temüdschin, dem es aufgrund geschickter Diplomatie und Waffengewalt gelang, eine Reihe von Mongolen- und Turkstämmen unter seiner Führung zu einen. Als Herrscher über ein riesiges geografisches Gebiet im Herzen von Eurasien wurde Temüdschin 1206 zum Dschingis Khan ernannt – dem „furchtlosen Führer“.
Die von Dschingis Khan und seinen Kriegern verübten Massentötungen folgen drei unterschiedlichen, teilweise überlappenden Mustern. Ähnlich den Athenern in Melos stellte eine Variante das ins Visier genommene Volk vor die Wahl, sich der mongolischen Oberherrschaft zu beugen oder vollständig ausgelöscht zu werden. Das galt für den Einfall der Mongolen in Russland, wo Fürstentümer wie Rjasan und Susdal zerstört wurden und Kiew geplündert wurde, bevor die Russen sich dem Khan ergaben, den geforderten Tribut zahlten und in das mongolische Rechtsgebiet übergingen. Einem einzigen aller russischen Fürsten wurde der Jarlyk vorgelegt, ein Vertrag, der ihn berechtigte, im Namen der Mongolen Tribut von anderen Fürstentümern einzutreiben. Wurde dieser pflichtgemäß bezahlt, ließen die Mongolen die Russen in Frieden. Die zeitweilige Vergabe des Jarlyk an das Fürstentum Moskau war ein entscheidender Grund für seine spätere Rolle als „Sammler russischer Länder“.
Mit der zweiten Variante mongolischer Gewalt wurden jene politischen Gebilde vor allem in China und Indien konfrontiert, die sich mit militärischen Mitteln gegen die Unterwerfung wehrten. Dies war eine unkluge Entscheidung, da ihnen die Streitkräfte der Mongolen in Planung und Kampfkraft im Allgemeinen haushoch überlegen waren. Insbesondere die berittenen Bogenschützen, die in beweglichen Kavallerieeinheiten organisiert waren, konnten es spielend mit vergleichbaren Truppen aufnehmen. Die Mongolen verleibten sich außerdem mühelos Militäreinheiten aus bereits eroberten Gebieten ein. Neben ihrer hoch entwickelten Belagerungstaktik nutzten sie die neuesten Techniken zum Bau von Rammböcken und einer Flammenwerferartillerie, wobei ein Großteil ihres technischen Know-hows von chinesischen Schießpulver- und Waffenexperten stammte. Wo immer die mongolischen Armeen sich aufhielten, rekrutierten sie befähigte Experten für ihre eigenen Technikbataillone.
War der Feind besiegt, wurden die Unterlegenen gewöhnlich in verschiedene Gruppen eingeteilt. Hochgeschätzte Handwerker blieben häufig verschont und wurden in die mongolischen Hauptstädte zurückgeschickt, um dort ihrem Gewerbe nachzugehen. (Während des Völkermords an den Armeniern verschonten die Osmanen später aus ähnlichen Gründen manchmal armenische Handwerker.) Frauen und Kinder wurden mongolischen Soldaten als Sklavinnen und Ehefrauen anheimgegeben und in die mongolische Gesellschaft eingegliedert. Alle anderen wurden getötet, und zwar häufig in Gruppen, die einzelnen mongolischen Soldaten zur Hinrichtung zugewiesen wurden. Einige Tage nach den Massakern an ihren Gefangenen wurden mongolische Truppen zurück in die Ruinen der zerstörten Städte geschickt, um mögliche Überlebende oder versteckte Personen zu töten. Zogen die Mongolen durch die Orte ihrer Feinde, so wurden diese „zur Behausung von Eule und Rabe; dort antworten nur die Schreieulen einander, und in den Hallen ächzt und stöhnt der Wind.“4 Das Reich der Mongolen breitete sich durch bloßen Terror aus. Welcher Fürst und welche Bevölkerung waren schon bereit, sich den Mongolen zu widersetzen, wenn sie wussten, dass ihnen dann der Untergang drohte?
Es gab noch eine dritte Variante für das Morden Dschingis Khans und seiner Nachfolger in Eurasien, und zwar „völlige Vernichtung“. Diese Form von Massentötung der Mongolen kann ohne Zweifel als Genozid gelten, wenngleich man betonen muss, dass die Mongolen andere Gruppen nicht aus Hass oder aus Ressentiments gegen ihre Religion oder Ethnie angriffen. Bei diesem Muster drohte mitunter ganzen Gemeinschaften aufgrund einer vermeintlichen Beleidigung oder eines Vergehens der Untergang. Dschingis Khan und seine Nachfolger duldeten keine Gegner, die in irgendeiner Weise ihre Ehre kränkten. Dies galt insbesondere für jene Gemeinschaften, die den Fehler machten, mongolische Anführer oder Botschafter zu töten oder die Friedensangebote der Mongolen auf andere Weise abzulehnen. In diesen Fällen wurden ganze Städte einschließlich aller Männer, Frauen und Kinder vernichtet. Anders als im Fall von Karthago oder Troja hielten es die Mongolen aber gewöhnlich nicht für nötig, die besiegten Städte als solche zu zerstören, wenngleich bekannte architektonische Zeugnisse der jeweiligen Kultur und Wahrzeichen eines Ortes tatsächlich verbrannt oder abgerissen wurden. In diesen Fällen ‒ wie in so vielen anderen in der Geschichte des Völkermords ‒ machten die Mongolen ihre Gegner für ihren eigenen Tod und die Zerstörung verantwortlich.
Das persischsprachige islamische Reich Choresmien, das sich südlich des Aralsees in Zentralasien rund um die Hauptstadt Samarkand gegründet hatte, umfasste so beachtliche Handels- und Kulturzentren wie Buchara und Urganch und breitete sich rasch bis ins Iranische Hochland und in die westlichen Regionen Afghanistans aus. Der Schah ‘Alā’ ad-Dīn Muhammad von Choresmien (Regierungszeit 1200–1220) widersetzte sich den Mongolen, indem er ihren Friedensvertrag ablehnte und ihre Gesandten erniedrigte oder hinrichten ließ. Dem gut informierten persischen Gelehrten und mongolischen Beamten ‘Alā’ al-Dīn ‘Aā Malik al-Dschuwaini zufolge wurden die wichtigsten Städte Choresmiens daraufhin in völkermordartigen Aktionen angegriffen und Samarkand, Buchara und Urganch brutal erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Insbesondere die Gebiete Choresmiens im heutigen Iran erlebten eine dramatische Entvölkerung, da die Mongolen Handelsstädte und landwirtschaftliche Flächen zerstörten (und in Weideflächen verwandelten). Manchen Wissenschaftlern zufolge erholte sich die Region erst in der Neuzeit von der dem Einfall der Mongolen geschuldeten Entvölkerung.
Die zentralen Städte Choresmiens galten für Angreifer aus dem Norden als uneinnehmbar und sie verteidigten sich in der Tat sehr gut. Der fortschrittlichen Belagerungsausrüstung, der militärischen Überlegenheit und dem ausgeprägten Kampfgeist der Mongolen vermochten die Choresmier jedoch nicht standzuhalten. Wie wir bei al-Dschuwaini lesen, brachen die Mongolen ihr Versprechen, die Turksoldaten zu verschonen, die die Garnison in der Hauptstadt Samarkand verteidigten, und brachten sie alle um. Nachdem die Mongolen die besten Kunstgewerbler und Handwerker in die Mongolei geschickt hatten, befahlen sie den Stadtbewohnern, sich am Stadtrand zu versammeln, wo sie kurzerhand massakriert und ihre Schädel als Siegessymbol in Pyramiden um die Stadt angeordnet wurden. Buchara erging es ähnlich. In beiden Städten zielten die Mongolen insbesondere auf königliche Bauten und legten diese in Schutt und Asche.
Nachdem die Mongolen in Urganch Frauen und Kinder unter den eigenen Soldaten verteilt hatten, massakrierten sie den Rest der Bevölkerung nach gängiger Praxis. Jeder mongolische Soldat musste 24 Männer und Frauen aus Urganch umbringen, was, wenn diese Zahlen stimmten – und wahrscheinlich handelt es sich um eine Übertreibung –, ein Massaker an über einer Million Menschen bedeutet hätte. In Termiz am Fluss Oxus wurden laut al-Dschuwaini „alle, Männer und Frauen, in die Ebene hinausgetrieben, entsprechend ihrer üblichen [mongolischen] Gepflogenheit eingeteilt und dann allesamt umgebracht“.5
Die Stadt Merw im heutigen Turkmenistan fiel im Februar 1221 an Tolui, den jüngsten Sohn Dschingis Khans, der 700.000 Menschen niedergemetzelt, dabei aber rund 80 Handwerker verschont haben soll.6 Auch die Stadt Nischapur im heutigen Nordosten des Iran ereilte die Rache der Mongolen. Dort gaben die Mongolen die gesamte Bevölkerung der Vernichtung anheim, weil Dschingis Khans Schwiegersohn von einem von den Wallanlagen der Stadt abgeschossenen Pfeil getötet worden war. Die Köpfe der ermordeten Männer, Frauen und Kinder wurden in Pyramiden rings um die eroberte Stadt aufgestapelt. Herat im heutigen Afghanistan wurde vollständig zerstört, nachdem eine Woche zuvor bereits seine Bewohner massakriert und auch die rund 2000 Überlebenden des Massakers in Merw getötet worden waren, die in Herat Zuflucht gesucht hatten.7
Auch der Mongolensturm in Osteuropa war von Tötungen und Völkermord begleitetet. Insbesondere die Magyaren zahlten bei der Invasion des Königreichs Ungarn 1241 einen hohen Blutzoll. Seit Jahrzehnten befürchtete König Béla IV. einen möglichen Angriff, da russische Adlige nach Ungarn gekommen waren und vor der militärischen Stärke und Brutalität der Mongolen gewarnt hatten. Freilich verstand niemand wirklich, wer die Mongolen waren oder was sie letztlich trieb.8 Der König selbst empfing verschiedene Gesandte von Ögedei Khan, dem Lieblingssohn und Erben von Dschingis Khan, die ihm mit der völligen Zerstörung seines Königreichs drohten, falls er es nicht den Mongolen überlasse. Die nomadischen Kumanen waren bereits von den Mongolen besiegt worden und hatten in Ungarn Zuflucht gesucht. Béla hoffte nun, die Kumanen dafür einzuspannen, um die renitenten ungarischen Barone im Zaum zu halten. Er ließ die Kumanen christianisieren und gliederte sie in das ungarische Ständesystem ein. Doch anstatt zu mehr Sicherheit in seinem Königreich beizutragen, entfremdete Béla die Barone nur noch mehr und stieß außerdem die ungarischen Bauern vor den Kopf, die schockiert feststellten, dass sie „Barbaren“ aus dem Osten Reverenz erweisen sollten. Beim Einfall der Mongolen unter der Führung von Ögedeis Sohn Batu waren die Gebiete Ungarns bereits in Auflösung begriffen.
Als die Armeen Batus von Norden her in Ungarn eindrangen, begann der Anführer der Mongolen laut Berichten von Magister Rogerius, dem großen Kirchenchronisten und Zeugen des Mongolensturms, „Dörfer zu brandschatzen[,] und nahm keine Rücksicht auf Geschlecht oder Alter. Er rückte, so rasch es eben ging, gegen den König vor.“ Béla zog sich nach Pest zurück und weigerte sich, gegen die Mongolen vorzugehen, die marodierten und mordeten, wie es, so Magister Rogerius, „ihre angeborene Bosheit gebot“. Als sie die Stadt Waitzen eroberten, flüchteten sich die Stadtbewohner und Bauern aus den umliegenden Dörfern in die Kathedrale und die kirchlichen Paläste, „die wie eine Burg befestigt waren“. Umsonst. Nachdem die Mongolen sich des Kirchenschatzes bemächtigt hatten, „metzelten [sie] Domherren und andere Personen, Frauen und Mädchen nieder und verbrannten sie“.9
Auf Drängen der Kirchenväter, die Plünderungen in den ländlichen Gebieten Ungarns zu stoppen, rückte Béla schließlich aus und traf die zahlenmäßig unterlegenen Mongolen im Gefecht. Seine Adligen waren jedoch zerstritten und hofften teilweise sogar auf seine Niederlage. Der König der Kumanen war von aufgebrachten ungarischen Bürgern getötet worden, die ihm die Schuld an dem Überfall gaben. Die Mongolen umzingelten Bélas Armee mit Bogenschützen und fügten den Ungarn erhebliche Verluste zu. Letztere flohen in Richtung Donau, um eine Atempause von den Eroberern zu haben, berichtet Magister Rogerius: „Unter denen, die auf der großen Straße nach Pest flohen, und unter den im Heer Verbliebenen wurde ein solches Gemetzel angerichtet und kamen so viele Tausende um, dass eine Schätzung über die Höhe der Verluste kaum möglich ist und man denen, die darüber berichten, wegen des unübersehbaren Gemetzels kaum Glauben schenken darf.“ Die Mongolen verstümmelten die Körper aller, derer sie habhaft wurden, und verbrannten andere, die in Kirchen oder Dörfern auf dem Weg Zuflucht zu finden versucht hatten. Bei Magister Rogerius lesen wir weiter: „Die Leichen lagen so [zahlreich] am Boden, wie sich Rinder, Schafe und Schweine an Weidestellen in der Wüste und Steine zu Hauf in Steinbrüchen sammeln.“10
Der ungarische König bat nun den Herzog von Österreich um Schutz, der hohe Entschädigungssummen von ihm verlangte und überdies Westungarn auf der Jagd nach Beute plünderte, während die Mongolen das Gebiet östlich der Donau besetzten und ihre Massentötungen fortsetzten. Die Stadt Großwardein wurde eingenommen, geplündert und niedergebrannt. „Sie verschonten außerhalb der Burgmauern nichts, plünderten und erschlugen auf den Straßen, in den Häusern und auf den Feldern Männer und Frauen von vornehmer wie niedriger Abkunft. Was weiter? Sie nahmen keine Rücksicht auf Geschlecht oder Alter“, kommentiert Magister Rogerius.11 Die Mongolen zogen sich daraufhin aus der Stadt zurück und ermunterten jene, die in der Burg Zuflucht gesucht hatten, in die Stadt zurückzukehren. Dann griffen sie erneut an und setzten diesmal Belagerungsgeschütz ein, um die Mauern der Burg zu durchbrechen und alle zu töten, derer sie habhaft wurden.
Die Mongolenschlacht bei Liegnitz 1241 aus der Chronik der heiligen Hedwig (14. Jh.).
Bei Magister Rogerius lesen wir weiter: „In anderen Kirchen aber begingen sie so viel Verbrechen an den Frauen, dass es besser ist, darüber zu schweigen, um den Menschen nicht Anreiz zu den verworfensten Schandtaten zu geben.“ Die Mongolen zogen sich erneut zurück und die Menschen strömten aus den Wäldern hervor, um in der Stadt nach etwas Essbarem zu suchen. Daraufhin kehrten die Soldaten plötzlich zurück und töteten alle, die noch am Leben waren. „So fanden bis zuletzt täglich neue Gemetzel statt. Da sie [die Mongolen] keine Opfer mehr fanden, rückten sie endgültig ab.“12
Unter diesen Umständen half Magister Rogerius selbst die Zuflucht auf eine Festungsinsel in der Donau nicht. Die Mongolen überlisteten die Verteidiger und drangen ungehindert aus einer völlig unerwarteten Richtung ein. Magister Rogerius schreibt: „Als man die Beute fortgeschleppt hatte, blieben nur die entblößten Leichen von Frauen und Männern auf dem Platz, die einen zum Hohn zerstückelt, andere noch ganz unversehrt.“13 Einmal mehr täuschten die Mongolen den Abzug vor und kehrten zurück, um dem Rest der Bevölkerung den Garaus zu machen.
Die Mongolen nahmen auch die eisern verteidigte ungarische Hauptstadt Gran ein und nahmen bittere Rache an den Adligen der Stadt, die den Befehl zum Niederbrennen der Holzhäuser und Vororte um die Burg gegeben und den Mongolen so die erhoffte Beute vorenthalten hatten. Anstatt sich die vornehmen und schön gekleideten Frauen zu nehmen, wie die Frauen gehofft hatten, ließen die Mongolen ihnen alle Wertsachen abnehmen und sie enthaupten. Nach Schätzungen von Magister Rogerius überlebten nicht mehr als 15 Menschen die Tötungsorgie, bei der Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden.14
Im Frühjahr 1242 starb Ögedei Khan und einer der Anwärter auf seinen Thron, Batu, kehrte mit seinen Armeen in die Mongolei zurück, um sich seinen Platz in der Nachfolge zu sichern. Kaum war er angekommen, zogen die Mongolen aus Ungarn ab, töteten die meisten Gefangenen und nahmen andere mit sich. Abgesehen von einigen steinernen Festungen und Burgen, die den Angriffen der Mongolen standhielten, war Ungarn durch den Einmarsch und die Okkupation seiner Gebiete im Lauf des Jahres vollständig verwüstet worden. Gut die Hälfte seiner Bevölkerung kam bei der Katastrophe ums Leben.
Worum ging es bei den Morden und dem Völkermord der Mongolen? Warum kamen so viele Menschen durch den Gründer der Mongolendynastie Dschingis Khan und seine Nachkommen ums Leben? Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Sicherlich war das Töten von echten oder vermeintlichen Feinden für die Anführer der Mongolen kein Grund zu großer Besorgnis. Es schien keinen Moralkodex zu geben, der das Töten von politischen Rivalen oder ihres Volkes verurteilte. Massaker waren ein fester Bestandteil der Eroberungen und Herrschaft über andere Länder. Sie waren allerdings nicht einfach ein Teil der Kriegsführung. Nach ihrer Unterwerfung wurden die beteiligten Völker unter einzelnen mongolischen Kämpfern aufgeteilt, die dann ihre jeweilige Quote hinrichteten. Die Mongolen betrieben insofern Vernichtung, als sie an den Ort der Massenmorde zurückkehrten und dafür sorgten, dass alle eventuell Überlebenden getötet wurden.
Sicherlich fügten die verheerenden Verwüstungen der Mongolen in den ländlichen Gegenden und das mitunter jahrelange Abschneiden von der Nahrungs- und Wasserzufuhr den Feinden, die sich in Burgen und Festungen verschanzten, enormes Leid und Tod in Form von Hunger oder Krankheiten zu. Als die Mongolen in den 1230er-Jahren China zu erobern versuchten, war dies außerdem mit Hungersnöten und Seuchen verbunden. Hinzu kamen Naturkatastrophen: Die chinesische Bevölkerung sank um bis zu 25 Prozent und die Entwicklung Chinas fiel um Jahrhunderte zurück.15
Zahlreiche Historiker verweisen auf den vorsätzlichen und geplanten Charakter der Tötungen der Mongolen. In den Königreichen Ungarn und Choresmien betrieben die Mongolen Völkermord. Als Teil ihrer imperialen Politik massakrierten sie einen Großteil der Zivilbevölkerung, wohin sie auch kamen. Sie schienen zu verstehen, welche Rolle Terror und psychologische Kriegsführung bei der Zerstörung der Widerstandsfähigkeit des Feindes spielen konnten. Magister Rogerius beschreibt die entsetzliche Furcht, die die überlebenden Ungarn – und er selbst – erlebten, als sie von den mongolischen Armeen umzingelt wurden und nach Verstecken im Wald Ausschau hielten: „Ich stelle mir vor meinem inneren Auge die Schlächter vor, und mein Körper wurde kalt vom Todesschweiß. Ich sah Menschen, die den Tod erwarteten und weder die Hände und Waffen ruhig halten noch die Arme heben, zur Verteidigung schreiten und zu Boden blicken konnten. […] Ich erblickte Menschen, die vor panischer Furcht halbtot waren.“16 Diese Art von Terror erleichterte den Mongolen ihre Eroberungen und ihre Herrschaft ungemein.
Unter Dschingis Khan, Ögedei Khan und deren Erben bezogen die Mongolen ihre Macht aus ihren Streitkräften und der Fähigkeit, in erbitterter und geordneter Manier auf ausgedehnten Territorien zu kämpfen. Aufgrund von internen Machtkämpfen unter den Nachkommen des Großen Khans zerfiel das einheitliche Reich schließlich in verschiedene politische Einheiten, die sich je nach Glück, Möglichkeit und Ort in eigene Richtungen entwickelten. Die Mongolen sollten somit nie wieder Europa bedrohen und nie wieder in der Lage sein, dieselbe geschlossene Kriegsmaschinerie in Gang zu setzen, die seinerzeit mit so viel Macht und Gewalt Choresmien und Ungarn eroberte.
Wie die Mongolen waren auch die Kreuzfahrer berittene Krieger, wenngleich sich ihre Kampftraditionen und Waffen sehr von denen der Mongolen unterschieden. Die Kreuzfahrer kämpften als Soldaten Christi mit einer allumfassenden mittelalterlichen römisch-katholischen Ideologie, die in dem Blut Christi schwelgte und die kriegswütigen Anweisungen des Alten Testaments auf all jene übertrug, die dem Volk Gottes Jerusalem verweigerten. Das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutete für einen Kreuzfahrer, seine Ergebenheit gegenüber dem Papst auszudrücken und seinem Aufruf zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen zu folgen. Bei einem möglichen Tod auf dem Kreuzzug bedeutete es auch den Erlass aller Sünden und die Befreiung von allen Schulden und Eigentumsansprüchen.
In derartigen Kriegen konnte ein Kreuzfahrer nach Belieben vergewaltigen, plündern und töten, da es laut päpstlichem Beschluss in einem von Christus gesegneten Feldzug keine Sünde geben konnte. Zudem eröffnete eine Teilnahme die Möglichkeit materieller Bereicherung, die sich trotz mancher Proteste gegen ihre ungeheuerlichsten Auswüchse bestens mit dem festen Glauben an das heilige Projekt, die Feinde des Herrn auszumerzen und Jerusalem in seinem Namen einzunehmen, kombinieren ließ.
Im November 1095 rief Papst Urban II. zu einem Kreuzzug in den Nahen Osten auf, zum sogenannten Ersten Kreuzzug. Der Papst stand vor einer Reihe von Problemen. Zunächst ereilte ihn ein Hilfegesuch des byzantinischen Kaisers Alexios I. Komnenos, ihn gegen die seldschukischen Türken zu unterstützen. Die Seldschuken hatten die Byzantiner in der Schlacht bei Manzikert 1071 geschlagen und rückten immer näher an Konstantinopel heran; 1081 belagerten sie bereits Nicäa. Zudem war eine „Reconquista“, eine Wiedereroberung Spaniens, dringend geboten, um das Vorrücken des Islam und des bereits den Großteil der Iberischen Halbinsel umfassenden al-Andalus rückgängig zu machen. Nicht zuletzt war der Papst aufgrund von Berichten über muslimische „Freveltaten“ gegen Pilger in Jerusalem und von Schauergeschichten über Angriffe der Seldschuken auf die Christen der Ostkirche zutiefst beunruhigt: „Und deshalb ermahne ich, nein, nicht ich, ermahnt Gott euch als inständige Herolde Christi mit aufrechter Bitte, Männer jeglichen Standes, ganz gleich welchen, Ritter wie Fußkämpfer, reiche und arme, wiederholt aufzufordern, diese wertlose Rasse in unseren Ländern auszurotten und den christlichen Bewohnern rechtzeitig zu helfen.“17
Robert der Mönch predigte, die Mohammedaner seien ein grausames und unsauberes Volk, „eine verfluchte Rasse, eine vollkommen von Gott entfremdete Rasse“, während Balderich von Bourgueil sie für „abscheulicher als die Jebusiter“ hielt, ein von Kanaan abstammendes Volk, das von den Israeliten vernichtet wurde.18 Die Sarazenen (ein seinerzeit generischer Name für alle Muslime aus dem Nahen und Mittleren Osten) hätten jeden Christen grob beleidigt, predigte Odo von Châteauroux. Um Mattatias in 1 Makkabäer 2 zu zitieren: „Ach, warum bin ich geboren, dass ich erleben muss, wie man mein Volk vernichtet und die heilige Stadt zerstört? Ohnmächtig musste man zusehen, wie sie in die Gewalt ihrer Feinde geriet, wie die heilige Stätte Fremden in die Hände fiel. […] Seht, unser Heiligtum, unsere Zierde und unser Ruhm, liegt verödet; fremde Völker haben es entweiht. Wozu leben wir noch?“ Wie Mattatias rief der Prediger seine Zuhörer dazu auf, sich um jeden Preis für die Befreiung Israels einzusetzen.19 Diese und andere katholische Kleriker stellten eine Vision des Nahen Ostens als das biblische Land in Aussicht, wo „Milch und Honig fließen“, wo das Leben im Gegensatz zum kargen Boden Frankreichs sorgenfrei und vielfältig war, während dort Knappheit und Armut zu ständigen Kriegen führten.
Auch in Europa machte man sich Sorgen um die Gewalt von fahrenden Rittern, die nach dem Zusammenbruch des Karolingerreichs im 10. Jahrhundert Stadt und Land gleichermaßen zerstörten. Die Päpste entwickelten die Doktrin von „Frieden und Gottvertrauen“, um christliche Ritter davon zu überzeugen, von internen Kämpfen abzulassen und die von Rom ergangenen Aufrufe zu einem Waffenstillstand zu befolgen. Zugleich suchten die Päpste jedoch nach Mitteln und Wegen, diese Ritter vom Kampf gegen die Feinde des Christentums zu überzeugen, sei es in Spanien, dem Nahen Osten oder Europa, wo sich gewisse Fürsten des Heiligen Römischen Reiches gegen die Einmischung des Papstes in die Politik wehrten. Mit anderen Worten: Päpstliche Vorstellungen vom Heiligen Krieg entsprangen zu Beginn des neuen Millenniums einer Vielzahl von Gründen, die mit der Reformbewegung innerhalb der Kirche in Verbindung standen.20
Im Juli 1095 reiste Urban II. in seine Heimat Frankreich und verurteilte auf dem Konzil von Clermont nicht nur die Gewalt in Europa, sondern berichtete auch von Folter und Misshandlungen der Pilger im Heiligen Land. Sein Aufruf, freiwillig in den Kampf zu ziehen, fand überwältigenden Anklang. Namhafte Persönlichkeiten wie Raimund IV., Graf von Toulouse, und Bischof Adhemar von Le Puy waren ebenso zum Aufbruch bereit wie Hunderte von Angehörigen des niederen Adels und sogar des gemeinen Volks, die sich infolge einer Mischung aus großer Frömmigkeit, der Begeisterung des Moments und der Hoffnung auf Flucht aus ihren wirtschaftlichen Nöten anschlossen. Der sogenannte Volkskreuzzug unter der Führung des charismatischen Predigers Peter des Einsiedlers erreichte Konstantinopel Monate vor dem Hauptheer des Ersten Kreuzzugs. Angesichts ihrer gewalttätigen und zügellosen Aktionen wurde die hauptsächlich aus Bauern bestehende Armee jedoch von Alexios II. zum Verlassen der Stadt gezwungen und damit dem Tod durch die türkischen Seldschuken überlassen. Das Gros der Kreuzritter – rund 30.000 bis 35.000 Kämpfer, darunter 5.000 Reiter – schaffte es ebenso bis nach Konstantinopel, wo Alexios II. aus Sorge vor möglichen Unruhen angesichts des Bedarfs an Nachschub und Ausrüstung rasch ihre Ausreise erleichterte.
Für Alexios eroberten die Kreuzritter Nicäa von den Seldschuken zurück und belagerten dann am 20. Oktober 1097 die große und prächtige Stadt Antiochia. Dort kämpften sie acht Monate bis zur endgültigen Kapitulation. Die Schilderung der Kampfszenen durch Raimund von Aguilers, den Domherrn von Notre Dame de Puy, offenbart trotz zahlreicher eingeflochtener Verweise auf die Gegenwart Gottes die Brutalität der Kreuzritter. Über die Einnahme einer der Festungsanlagen in Antiochia schrieb er: „Als der Kampf und die Beute gewonnen waren, trugen wir die Köpfe der Ermordeten ins Lager und steckten sie als düstere Mahnung an die dramatische Lage ihrer türkischen Verbündeten und an das künftige Elend der Belagerten“ auf Pfähle. Dies war selbstverständlich „Gottes Gebot“, denn „die Türken hatten einst Schande über uns gebracht, als sie die Spitze des erbeuteten Banners der Heiligen Jungfrau in den Boden rammten“. Nach dem Fall von Antiochia am 3. Juni schrieb Raimund von Aguilers, die Zahl der gefallenen Türken und Sarazenen sei unermesslich „und es wäre sadistisch, von den neuartigen und vielfältigen Tötungsmethoden zu berichten“.21
Im Streit um das Schicksal Antiochias fiel die Stadt schließlich an Bohemund von Tarent, der sich weigerte, sie an die Byzantiner zurückzugeben, und stattdessen einen Kreuzfahrerstaat im Umland errichtete. Die übrigen Kreuzritter zogen zur Belagerung von Jerusalem nach Süden. Auf dem Weg dorthin marschierte Raimund IV. durch Syrien und eroberte al-Bara, die erste Stadt der Sarazenen auf seinem Weg. Nach den Berichten von Raimund von Aguilers „brachte er Tausende um, schickte weitere Tausende zurück, die in die Sklaverei nach Antiochia verkauft wurden, und befreite jene Feiglinge, die vor dem Fall von al-Bara kapitulierten“.22 Die Plünderungen und Hinrichtungen gingen weiter, während die Kreuzfahrer aufgrund des Widerstands der Garnisonen der Seldschuken und Sarazenen gleichzeitig an entsetzlicher Nahrungsmittelknappheit litten.
Kannibalismus wurde zu einem weitverbreiteten Phänomen, da „die Christen mit Begeisterung viele verweste Leichen der Sarazenen aßen, die sie zwei oder drei Wochen zuvor in die Sümpfe geworfen hatten“. Unter den Kreuzfahrern kam es erneut zum Streit, ob man bis nach Jerusalem vorrücken oder die Plünderungs- und Belagerungszüge auf andere Städte ausweiten solle. „Warum sollen wir gegen die ganze Welt kämpfen?“, fragte Tankred. „Sollen wir die gesamte Menschheit töten? Überlegt doch mal; von 100.000 Rittern bleiben kaum weniger als 1000, und von 200.000 Mann bewaffnetem Fußvolk sind weniger als 5000 noch kampfbereit. Sollen wir herumtrödeln, bis wir alle umgebracht worden sind?“23
Trotz der zahlreichen Ablenkungen auf dem Weg, die üblicherweise von der Hoffnung auf Beute und Reichtümer befeuert wurden, belagerten die Kreuzfahrer schließlich Jerusalem. Hier stießen andere Gruppen von Kreuzfahrern zu ihnen, die auf dem Seeweg ins Heilige Land gelangt waren. Selbst nach den Berichten von Raimund von Aguilers, der zu übertriebenen Zahlen neigte, waren die Truppen der Kreuzfahrer minimal: „Wir hatten nicht mehr als 12.000 kriegstüchtige Männer neben zahlreichen Behinderten und Armen und, wie ich glaube, nicht mehr als 1200 bis 1300 Ritter.“ Ihnen gegenüber standen „60.000 Kämpfer in Jerusalem und unzählige Frauen und Kinder“.24
Die Belagerung Jerusalems erwies sich angesichts der zahlreichen schützenden Festungen als schwierig und kompliziert und die Kreuzritter sorgten sich um die Truppenverstärkungen, die zur Unterstützung der Verteidiger angeblich von Ägypten aus losmarschiert waren. Der Legende nach soll der Priester Peter Dibelius eine Vision gehabt haben, in der der kurz zuvor verstorbene Bischof Ademar die Kreuzfahrer anwies, zu fasten und dann – ähnlich wie bei der Eroberung Jerichos im Buch Josua – in einer Barfußprozession um Jerusalem zu marschieren. Auf diese Weise durchbrachen sie im Juli 1099 die inneren Mauern von Jerusalem, fielen über die Stadtbewohner her und töteten neben ihrer Hauptzielgruppe, den Muslimen, auch Christen und Juden.
„Einige der Heiden“, schrieb Raimund von Aguilers, „wurden gnädigerweise enthauptet, andere von aus Türmen abgeschossenen Pfeilen durchbohrt und wieder andere, die lange gefoltert worden waren, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Berge von Köpfen, Händen und Füßen lagen in den Häusern und Straßen umher und die Männer und Ritter rannten über den Leichen hin und her.“ Im Tempel Salomons, so berichtet Raimund von Aguilers unter Rückgriff auf einen biblischen Verweis aus der Offenbarung des Johannes, „ritten Kreuzfahrer bis zu den Knien und Zügeln ihrer Pferde in Blut“.25 Muslimische Überlebende des Gemetzels wurden gezwungen, die Leichen vor die Tore der Stadt zu tragen, wo sie zur Verbrennung „haushoch“ aufgetürmt wurden.26 Nach Ende der Gefechte wurde Gottfried von Bouillon zum König von Jerusalem gewählt; das Ziel des Ersten Kreuzzugs war erreicht.
Die Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer 1099. Illustration aus Guillaume de Tyr, Histoire d‘Outremer.
In den Jahren nach der Eroberung Jerusalems versuchte das Pontifikat, den Reform- und Einigungswillen in der Kirche für das Bezwingen der Feinde in Europa zu nutzen. Der Papst berief sich auf Vorstellungen eines Heiligen Krieges, um eine ganze Fülle von Problemen zu bekämpfen, darunter den weitverbreiteten Ämterkauf innerhalb der Kirche und die zunehmende Bedrohung durch routiers, Banden von gesetzlosen Söldnern, die insbesondere im südfranzösischen Okzitanien und Aquitanien den Handel unterbrachen. In den 1170er- und 1180er-Jahren überlagerte sich das Problem der routiers mit dem der so empfundenen Bedrohung durch den Katharismus.27 Die sich von Südfrankreich nach Norditalien und Nordspanien ausbreitenden Katharer, eine radikal dualistische Strömung des Christentums, lehnten die – in ihren Augen diabolische – Autorität des Papstes ab, verweigerten die Sakramente (einschließlich der Ehe) und betonten den Kampf zwischen Gut und Böse in der Seele des Einzelnen.
Fürsten im Süden Frankreichs betrachteten die Katharer meist wohlwollend und schützten die arbeitsamen und friedfertigen „Häretiker“ vor päpstlichen Repressalien, so wie sie häufig ebenfalls die routiers vor der wachsenden Macht des Königs von Frankreich und seinen Versuchen bewahrten, den Verkauf ihrer Dienstleistungen an die aufsässigen Feudalherren im Norden zu unterbinden. Insbesondere im Languedoc und im umliegenden Okzitanien schien es dem lokalen Adel von Vorteil, die Unabhängigkeit der Katharer und das Militärpotenzial der routiers zu fördern. Ganz besonders ärgerte sich der Papst über Raimund VI. von Toulouse, der die routiers nicht nur untergebracht, sondern sogar auf seinem Land beschäftigt und die Katharer darin bestärkt hatte, sich zu vermehren und in seinen Städten zu prosperieren.
Papst Innozenz III. sandte zunächst Diplomaten und Prediger, um die Katharer für die Sache der römischen Kirche zu gewinnen. Als er die Andersgläubigen jedoch nicht mit Argumenten überzeugen konnte, griff der Papst zu gewalttätigen Mitteln. 1204 stellte er dem König von Frankreich, Philipp II. August, bei einer Intervention denselben Ablass in Aussicht, den er den Kreuzfahrern in Nahost gewährt hatte: „Damit das physische Schwert für alle sichtbar die Unzulänglichkeit des geistigen Schwertes wettmache und Ihr, ganz abgesehen von dem zeitweiligen Ruhm, den Ihr durch so fromme und lobenswerte Arbeit erwerben werdet, denselben Sündenerlass erringen mögt, den wir jenen gewähren, die zur Unterstützung ins Heilige Land ziehen.“28 Der König war jedoch nicht willens, selbst einzurücken oder die Leitung des Feldzugs seinem Sohn Louis zu übertragen.
Zu Beginn des Jahres 1208 traf der päpstliche Legat Pierre de Castelnau mit dem unbeirrbaren Raimund VI. zusammen. Ihr Gespräch endete mit der Exkommunikation Raimunds VI., da dieser sich weigerte, seine Schutzherrschaft gegenüber den Katharern aufzugeben. Auf seiner Rückreise nach Rom wurde Pierre de Castelnau – höchstwahrscheinlich von einem von Raimunds Rittern – getötet. Innozenz III. rief nun zu einem Großkreuzzug gegen die Katharer auf, zum sogenannten Albigenserkreuzzug (benannt nach einer wichtigen Diözese, Albi, in der zahlreiche Katharer lebten), und gewährte den teilnehmenden Rittern alle Ablässe und Vorzüge, die die Kreuzfahrer genossen hatten.
Ein noch wichtigerer Anreiz zum Einrücken war vielleicht das Angebot des Papstes, den Kreuzrittern die Gebiete der Katharer und ihrer adligen Schutzherren zu überlassen. Die Ritter hatten so die Möglichkeit, sich Lehen im Süden zu sichern, was die Adligen aus Nordfrankreich mit Unterstützung des Königs nur allzu beflissen taten. Sie legten das Kreuzzeichen an und versammelten sich in Montpellier zum Kampf, angeführt von dem Earl of Leicester Simon de Montfort, einem militanten Katholiken, sowie dem päpstlichen Legaten Arnold Amalrich, dem Abt des Klosters Citeaux. Montpellier war eine der wenigen Städte im Süden mit einem unerheblichen Anteil an Katharern. Zu ihnen hinzu stießen Gruppen von routiers, die getreu ihrem Beruf bereit waren, ihre Dienste meistbietend zu verkaufen, obwohl sie bislang zusammen mit den Katharern von den Fürsten im Süden beschützt worden waren.
Während Raimund VI. von Toulouse den Papst durch die Abtretung verschiedener seiner besten Burgen zu beschwichtigen versuchte, waren Raimunds Vasallen, der Vizegraf Raimund-Roger Trencavel und die Grafen von Foix und Comminges, zum Widerstand entschlossen.29 Die Kreuzfahrer belagerten daraufhin Béziers, während Raimund-Roger sich in seine wehrhafte Stadt Carcassonne zurückzog. Der Bischof von Béziers drängte nun die Bürger der Stadt, 222 Häretiker – zumeist Familienoberhäupter – an die Kreuzfahrer auszuliefern, damit diese im Gegenzug die Belagerung aufgäben. (Einige von ihnen waren Waldenser, eine kleinere, aber verwandte Gruppe von Häretikern.) Katholische Bürger hatten außerdem die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Beide Optionen lehnten die Stadtbewohner ab. Wie die italienischen Stadtstaaten pflegten die südfranzösischen Städte einen leidenschaftlichen Geist der Unabhängigkeit und des Widerstands gegen den Herrschaftsanspruch des Papstes. Als die Bürger von Béziers fatalerweise versuchten, die Kreuzritter in einen Kampf zu verstricken, ließen sie jedoch die Stadttore offen. Die Kreuzfahrer und ihre Verbündeten drängten daraufhin in die Stadt und verübten eines der schlimmsten Massaker in der Geschichte des mittelalterlichen Europa. Einer der päpstlichen Legate wurde angeblich gefragt, wie man die Katharer in den Kämpfen von den Katholiken unterscheiden könne. Seine Antwort: „Tötet sie alle, denn Gott wird die Seinen schon erkennen.“30 Ob diese Aussage wahr ist oder nicht: In jedem Fall töteten die Kreuzfahrer Tausende von Stadtbewohnern; sie zerrten die Katholiken regelrecht aus den Kirchen – Männer, Frauen und Kinder – und brachten alle um.
So notierte ein Chronist: „Nichts konnte sie retten, weder das Kreuz noch der Altar. Frauen und Kinder wurden getötet, Priester wurden von diesen verrückten, schändlichen Fußsoldaten getötet. Niemand entkam ihnen; möge Gott, so er will, ihre Seelen im Paradies aufnehmen. Ich glaube nicht, dass jemals ein so ungeheures und grausames Massaker stattgefunden hat, noch nicht einmal zur Zeit der Sarazenen.“31 Es war eine entsetzliche Orgie der Gewalt; vor ihrem Tod wurden die Opfer geblendet, gefoltert und verstümmelt. Die Ritter erhoben nur dann Einspruch, wenn es zu exzessiven Plünderungen durch die Armee kam. Waren die Einwohner niedergemetzelt, wurde die Stadt in Brand gesteckt. Zufrieden mit ihrem Werk, schrieben die Legaten Milo und Arnold Amalrich an Papst Innozenz III.: „Unsere Männer haben ohne Rücksicht auf Rang, Geschlecht oder Alter niemanden verschont und fast 20.000 Menschen mit dem Schwert gerichtet. Nach diesem großen Gemetzel wurde die gesamte Stadt geplündert und in Brand gesteckt, während Gottes Rache wunderbar wütete.“32
Die Nachricht von den in Béziers erlebten Gräueln verbreitete sich rasch im gesamten Languedoc. Die Kreuzfahrer zogen von Stadt zu Stadt, nahmen katharische Häretiker fest und töteten sie. In Lavaur wurden an einem einzigen Tag rund 400 Katharer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.33 Unterdessen stellten sich anfangs widerständige Adlige nun den Kreuzrittern und verzichteten zur Rettung des eigenen Lebens und das der Katholiken auf ihre Schlösser und darauf, die Katharer weiterhin zu schützen.
Raimund VI. von Toulouse, der seine Entourage in Carcassonne verteidigt hatte, ergab sich schließlich den Kreuzfahrern, um sein Leben und das der Stadtbewohner zu retten. In diesem Fall durften die Katharer zwar die Stadt verlassen, doch es kam zu organisierten und systematischen Plünderungen. Raimund-Roger wurden seine Ländereien zugunsten des Grafen Simon de Montfort aberkannt und er verbrachte die Jahre bis zu seinem Tod 1209 im Gefängnis. De Montfort starb während der Belagerung von Toulouse, das er als sein Lehen beanspruchte. Raimund VII. von Toulouse erzielte unterdessen eine Übereinkunft mit dem Papst: Er durfte seine Ländereien behalten, im Gegenzug dafür aber würde er sich der Kirche anschließen, die Häretiker verfolgen und die Inquisition in Toulouse unterstützen. Folter, Terror und Hinrichtungen sollten die nächsten 50 Jahre das Schicksal der Katharer und ihrer Unterstützer prägen.
Papst Innozenz zeigte sich äußerst zufrieden. Er besaß nun eine Waffe, mit der er aufständischen Städten drohen und sie unter seine Kontrolle bringen konnte. Für sein Selbstverständnis und sein Machtstreben war die von Häretikern und Andersdenkenden ausgehende „innere Bedrohung“ für das Christentum ebenso wichtig wie die „äußere Bedrohung“ durch den Islam im Nahen Osten und in Spanien. In einem Brief vom Oktober 1212 drohte der Papst den Mailändern das Schicksal der Städte im Languedoc an, wenn sie weiterhin Häretikern in ihrer Mitte Unterschlupf gewähren sollten: „Keine Schar kann dem Herrn der Heere widerstehen, wenn man von Beispielen [der Vernichtung!] aus dem Alten Testament absieht. Genau so, wie er kürzlich die Häretiker in der Provence unterworfen hat“ und die Muslime im Sieg von Las Navas de Tolosa (Juli 1212) vernichtend schlug, „so hat er die Macht, eure Stadt in Schutt und Asche zu legen.“34
Die Vorstellung eines „Heiligen Krieges“ in den Kreuzzügen enthielt im Kern bereits den Genozid. Christliche Ritter waren aufgerufen, auf Geheiß des Stellvertreters Christi auf Erden, des Papstes, eine „niederträchtige und verachtenswerte Rasse“ im Namen der Reinheit der katholischen Kirche zu vernichten. Diese mächtige Ideologie verschmolz mühelos mit Ambitionen auf materielle Vorteile und dem Traum von Reichtum, was eine Generation an Rittern und Faktoten zu gefährlichen Missionen im Nahen Osten und zu einer Reihe von Feldzügen gegen die Feudalherren im Languedoc aufbrechen ließ. Der Papst und sein Legat planten einen Angriff auf die Katharer, der sie und ihre Sympathisanten restlos auslöschen sollte. Eingeleitet hatte den Prozess ein Kreuzzug nach dem Modell des Kreuzzugs im Nahen Osten. Die folgende Inquisition brachte die Vernichtung einer religiösen Gruppierung, die sich von ihren Nachbarn vor allem durch ihre Glaubenslehre unterschied, zum Abschluss. Die Raubzüge und das Gemetzel der Kreuzfahrer im Nahen Osten nahm genozidale Ausmaße an, war aber häufig so wahllos – bei der Eroberung von Béziers und Jerusalem kamen Menschen unterschiedlicher Religionen ums Leben –, dass die Verbrechen den groß angelegten Massakern an ganzen Stadtbevölkerungen durch die Mongolen ähnelten.
Manche Kritiker finden es problematisch, das mörderische Vorgehen der Mongolen trotz seines weitverbreiteten und gehäuften Auftretens als Genozid zu bezeichnen. Doch die Mongolen planten ihre Offensiven gegen ihre Feinde häufig mit großer Akribie und dem klaren Ziel, alle oder einen Teil der betroffenen Bevölkerung zu vernichten. Die Mongolen löschten widerständige Gruppen en masse aus und kehrten sogar in zerstörte Städte zurück, um die letzten Überlebenden zu ermorden. Ja, die Mongolen identifizierten keine einzelne Gruppe oder Ethnie, die ausgemerzt werden sollte. Tatsächlich blieb keine Gruppe verschont, wenngleich Handwerker, Kaufleute und Bauarbeiter häufig ein neues Zuhause bei den Mongolen fanden. Völker wie die Ungarn, die Choresmier und die Chinesen wurden mit einem genozidalen Furor angegriffen, der große Bevölkerungsgruppen drastisch auf einen Bruchteil ihrer einstigen Anzahl dezimierte. Die Gruppe „als solche“ sollte ausgelöscht werden. Anders als die Kreuzfahrer waren die Mongolen von keiner Ideologie motiviert, die Zerstörungen rechtfertigte. Das Morden war vielmehr eine Form des „Empire Building“ – ein Mittel der Gebietsvergrößerung, der Terrorisierung von Gegnern und der Einverleibung zahlreicher Völker und Kulturen in ein ausgedehntes Territorium, das an manchen Stellen vom Mittelmeer zum Pazifik reichte. Massenmorde, in manchen Fällen Völkermorde, bedurften keiner Rechtfertigung. Sie waren ein Faktum mongolischer Macht und Herrschaft.
Die Vertreibung der Katharer nach der Belagerung von Carcassonne durch die Kreuzritter unter Simon IV. de Montfort 1209. Buchmalerei (14. Jh.) aus der Grandes Chroniques de France.