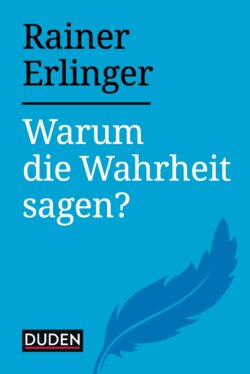Читать книгу Warum die Wahrheit sagen? - Rainer Erlinger - Страница 5
ОглавлениеWer etwas über Lügen hören will, braucht nur die Nachrichten einzuschalten. Wer aber wirklich et was über Wahrheit und Lüge erfahren möchte, sollte Shakespeare lesen. Kaum ein Autor hat so meisterhaft die unterschiedlichen Facetten des Phänomens Lüge herausgearbeitet. Man denke nur an Jagos intrigante Lügen in Othello oder an die falschen Versprechungen und Schmeicheleien der Töchter König Lears, die ihren Vater dazu bringen, ihnen sein Königreich zu überlassen.
Vor allem zeigt Shakespeare die Konsequenzen auf, die Wahrheit und Lüge für das Leben haben beziehungsweise haben können. Bei ihm sind diese Konsequenzen meist sehr drastisch, üblicherweise ist es der Tod. In Shakespeares Tragödien liegen zum Schlussvorhang gerne die wichtigsten Protagonisten tot auf der Bühne.
So auch in Othello, dem Stück, das als der Klassiker schlechthin zum Thema Lüge gilt. Die zentrale Figur dort ist nicht der Feldherr Othello, sondern dessen Fähnrich Jago. Er ist die treibende Kraft des Stückes – nicht zuletzt hat er auch den größten Textanteil –, und seine treibende Kraft basiert vor allem auf einem Mechanismus: Lüge. Nachdem Othello Jago bei einer Beförderung übergangen hat, beschließt der, sich an Othello zu rächen, indem er ein falsches Spiel spielt: »Wenn ich ihm diene, dien’ ich nur mir selbst; Der Himmel weiß es! Nicht aus Lieb’ und Pflicht, Nein nur zum Schein, für meinen eignen Zweck … Ich bin nicht, was ich bin.«
Für seine Rache möchte Jago Othello glauben machen, dessen Frau Desdemona betrüge ihn mit seinem Leutnant Cassio. Dazu arrangiert Jago durch Lügen und Intrige geschickt eine Reihe von Situationen, die den Verdacht in Othello keimen lassen. Höhepunkt ist ein Taschentuch, das Desdemona verloren hat – Othellos erstes Geschenk an sie. Jago bekommt es in die Hände und schiebt es Cassio unter, so dass Othello es bei dem ahnungslosen Leutnant findet. Othello sieht darin, wie von Jago geplant, den endgültigen Beweis für Desdemonas Untreue und erwürgt seine Frau im Eifersuchtswahn. Als er seinen Irrtum erkennt, bringt er sich um. Jago, der zuvor noch seine Frau Emilia getötet hat, wird dem Richter übergeben und erwartet sein Todesurteil.
Das grausige Ende ist eine klare Folge von Jagos Lügen. Sein Vorgehen stellt die Lüge in ihrer extremsten Form dar: Sie verfolgt einzig und allein das Ziel, dem Belogenen zu schaden.
Das unterscheidet Jagos Lügen von denen der beiden älteren Töchter König Lears. Diese erzählen und versprechen ihrem Vater, dass sie nur ihn lieben, mehr als alles andere und alle anderen auf der Welt. Das ist gelogen, wie sich sehr schnell herausstellt, nachdem Lear ihnen geglaubt und das Königreich übergeben hat. Denn sie kümmern sich fortan nicht weiter um ihn und schieben ihn buchstäblich aufs Altenteil. Anders als ihre Schwestern ist die jüngste Tochter Cordelia Lear gegenüber ehrlich gewesen und deshalb von ihm enterbt worden: »Nimm Deine Wahrheit dann zur Mitgift.« Dennoch hält sie, die Ehrliche, später zu ihrem Vater, nachdem die lügenhaften Töchter ihn bitter enttäuscht haben.
Die Lügen der älteren Schwestern dienen vor allem ihrem eigenen Vorteil: Sie haben es auf das Königreich abgesehen. Dass sie damit dem Vater und der jüngsten Schwester schaden, nehmen sie in Kauf, es ist aber, anders als bei Jagos Lügen, nicht ihr eigentliches Ziel.
Shakespeare zeigt in König Lear jedoch noch einen weiteren Aspekt der Lüge: die auffällige Bereitschaft, mit der Lear den falschen Beteuerungen seiner Töchter glaubt. Das süße Gift der Lüge wirkt. Objektiv gesehen sind die Beteuerungen der beiden vollkommen unglaubwürdig, wie Lears jüngste Tochter sehr deutlich macht. Cordelia lässt ihren Vater wissen, dass sie ihn liebt und immer lieben werde, aber eben nicht als einzigen Menschen. Als der enttäuschte Vater eine Erklärung fordert, erwidert sie mit einer Mischung aus Logik, Lebenserfahrung und gesundem Menschenverstand: Aus welchem Grund hätten die Schwestern geheiratet und was für eine Ehe würden sie führen wollen, wenn sie denn ihr Versprechen ehrlich meinten, dass der Vater der einzige Mensch sei und bleiben werde, den sie je liebten? »Wozu den Schwestern Männer, wenn sie sagen, sie lieben Euch nur?«
Spätestens nach dieser Antwort sollte es Lear dämmern, dass ihm seine älteren Töchter etwas vormachen. Dennoch zieht er es offenbar vor, den Lügen zu glauben, vermutlich schlicht deswegen, weil sie die Erfüllung seiner Wünsche versprechen. Im weiteren Verlauf des Dramas gelangt Lear allerdings zu der Erkenntnis, dass er sich wohl besser früher der Wahrheit gestellt und nicht der Traumwelt der Lüge hingegeben hätte. Die Wahrheit hat nämlich gegenüber allen Lügen einen großen Vorteil: Sie ist wahr, sie entspricht der Realität.
Das klingt banal, aber so banal kann es nicht sein, sonst würden wir Menschen uns nicht immer wieder geradezu bereitwillig belügen lassen. So wie Lear, der gewissermaßen stellvertretend für diese offenbar weitverbreitete Bereitschaft steht. Wie verbreitet, zeigen nicht zuletzt die aktuellen politischen Entwicklungen mit dem Erstarken populistischer Parteien und Kandidaten. Mögen deren Versprechungen noch so unglaubwürdig sein, sie werden geglaubt. Der Wunsch – wie man die Welt gerne hätte – ist bekanntlich häufig Vater der Gedanken, im Falle der Lüge beim Lügner wie beim Belogenen. Allerdings entspricht eben nur die Wahrheit der Realität. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal: Es gibt eine beliebige Anzahl und Variation von Aussagen über etwas, aber nur eine davon, die Wahrheit, zeichnet sich dadurch aus, dass sie der Realität entspricht.
Die große Denkerin Hannah Arendt hat diese Überlegung in Bezug auf die Propaganda – die systematische, groß angelegte politische Lüge – ausgeführt:
Denn das klarste Zeichen der Faktizität eines Faktums ist eben dies hartnäckige Da, das letztlich unerklärbar und unabweisbar alle menschliche Wirklichkeit kennzeichnet. Die Propagandafiktionen zeichnen sich dagegen stets dadurch aus, dass in ihnen alle partikularen Daten einleuchtend geordnet sind, dass jedes Faktum voll erklärt ist, und dies gibt ihnen ihre zeitweise Überlegenheit; dafür fehlt ihnen die unabänderbare Stabilität alles dessen, was ist, weil es nun einmal so und nicht anders ist.
Fast mehr noch als Wünsche sind es Ängste, die Menschen bereitwillig etwas glauben lassen. Ängste sind evolutionär tief verwurzelte Emotionen. Wie tief verwurzelt sie sind und wie wenig der Vernunft zugänglich, kann man beispielsweise daran sehen, dass Spinnen- oder Schlangenphobien auch heute noch stark verbreitet sind, wohingegen es praktisch keine Fälle von Automobilphobien gibt. Dabei übersteigt die Gefährlichkeit und Tödlichkeit von Autos die von Spinnen und Schlangen in modernen Gesellschaften um ein Vielfaches. Die gut hundert Jahre, die es das Auto gibt, sind jedoch nur ein Wimpernschlag in der langen Geschichte der Evolution. Über Millionen von Jahren war es äußerst ratsam und nützlich, sich von Schlangen und Spinnen fernzuhalten. Deshalb war es auch sinnvoll, Furcht vor ihnen zu entwickeln. Und noch etwas war sinnvoll: lieber einmal einer Warnung mehr zu glauben als einer zu wenig. Alles, was mit Ängsten verbunden ist, war oder ist in der Menschheitsgeschichte potenziell gefährlich. Und ein Mensch, der einer Warnung vor Gefahren, also vor dem, was seinen Ängsten entspricht, Glauben schenkt, hat größere Chancen, der Gefahr zu entkommen. Wer sich unbedingt erst einmal selbst überzeugen will, ob da auch wirklich ein Säbelzahntiger hinterm Busch lauert, wie man ihm erzählt hat, wird zwar nicht so leicht einem Betrüger aufsitzen, dafür aber womöglich das letzte Mal einen Blick riskiert haben.
Auch die Eifersucht, wie sie Othello verspürt, ist evolutionär von Bedeutung. Ganz abgesehen von der Angst, den geliebten Menschen zu verlieren, ist das Fremdgehen der Frau ein bedrohliches Szenario für den Mann. Würde es doch bedeuten, dass er nicht seine eigenen Gene weitergeben kann und trotzdem den elterlichen Aufwand – Ernährung, Schutz, Versorgung – betreiben muss. Aber eben für fremde Kinder, biologisch gesehen das Problem der sogenannten »Kuckuckskinder«.
Jago handelt daher aus psychologischer Sicht klug, wenn er die Eifersucht Othellos als Ziel und zugleich Vehikel seiner Lügen auswählt. Hinzu kommt, dass er bei dem »Mohr« Othello als Schwarzem oder Mauren auch alte Kränkungen und Erfahrungen des Zurückgewiesenwerdens bedienen kann – ebenfalls eine gute Einfallspforte. So wollte Desdemonas Vater Brabantio die Verbindung seiner Tochter mit Othello unterbinden, weil dieser Schwarzer ist, und bezweifelte wegen dessen Hautfarbe sogar, dass seine Tochter freiwillig zu ihm gegangen sei: »Ob sie, ein allgemein Gespött zu werden, häuslichem Glück entfloh an solches Unholds pechschwarze Brust, die Grau’n, nicht Lust erregt?«
Über das Wissen, welche Lügen besonders gut verfangen, verfügen leider nicht nur Shakespeare, Jago und Sozialpsychologen, es gehört auch zum Standardrepertoire von Populisten und Produzenten von Fake News. Sie alle scheinen die Ängste der Menschen zu bedienen und dadurch erst recht zu bestärken. Nicht umsonst nannte eine der, wenn nicht die wichtigste Philosophin der Gegenwart, Martha Nussbaum, ihr 2018 erschienenes Buch zur politischen Krise The Monarchy of Fear – Die Monarchie der Angst. Doch zu Lüge und Politik später mehr.
Lügen, um anderen zu schaden, wirkt verheerend, das lehrt Othello. Lügen zum eigenen Vorteil stiftet ebenfalls Unglück, das zeigt König Lear. Beide Stücke tun dies eindrücklich und tiefgründig, leuchten die menschliche Seele aus, aber, wenn man ehrlich ist, nichts davon ist wirklich überraschend. Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, muss man kein Genie wie Shakespeare sein und auch keines seiner Dramen gesehen haben. Insofern ist zum Thema Lüge vielleicht ein anderes seiner Stücke überraschender und interessanter, eines, an das man in diesem Zusammenhang nicht auf Anhieb denken würde: Romeo und Julia.
Romeo und Julia? Der Inbegriff der tiefen, von Herzen kommenden, ehrlichen Liebe, ein Lehrstück über die Lüge? Geht es darin nicht eher um die Kraft der Liebe, die sich nicht aufhalten lässt, und andererseits um die verheerende Wirkung des Nachtragens, der Feindschaft? Und dass die Liebe am Ende stärker ist?
Kurz zur Erinnerung: Romeo und Julia verlieben sich ineinander. Weil sie aus seit Langem verfeindeten Familien stammen – Romeo aus der der Montagues, Julia aus der der Capulets – und ihre Eltern einer Verbindung nie zustimmen würden, halten die beiden ihre Liebe verborgen und lassen sich heimlich von Bruder Lorenzo trauen. Der will ihnen helfen, hofft aber auch, dadurch die alte Feindschaft der Familien beenden zu können. Nachdem Romeo in einem der für diese Feindschaft typischen Kämpfe Julias Cousin Tybalt getötet hat, muss er aus Verona in die Verbannung nach Mantua fliehen. Als Julia in dieser Zeit gegen ihren Willen mit Paris verheiratet werden soll – die Eltern wissen ja nichts von der heimlichen Trauung –, will sie sich das Leben nehmen. Doch Bruder Lorenzo ersinnt einen Ausweg: Er gibt ihr einen Schlaftrunk, der sie für 42 Stunden in einen scheintoten Zustand versetzen wird. So entgeht sie der Hochzeit, während Lorenzo Romeo verständigen wird, damit der sie aus der Gruft nach Mantua holen kann. Julia willigt in den Plan ein, aber Lorenzos Brief erreicht Romeo nicht, weil Lorenzos Mitbruder Marcus, der den Brief überbringen soll, wegen eines Pestausbruchs nicht in die Stadt Mantua gelassen wird. Romeo ist also gänzlich unwissend, als ihm sein Diener Balthasar von Julias vermeintlichem Tod berichtet. Vollkommen außer sich, besorgt er sich Gift, um sich neben Julias Totenbett umzubringen. Vor der Gruft trifft er auf Paris, den offiziellen Verlobten Julias, der ihn davon abhalten will, die Gruft zu betreten, worauf Romeo ihn im Duell tötet. Als er dann die scheinbar tote Julia erblickt, nimmt er das Gift und stirbt. In diesem Moment wacht Julia auf, sieht den tatsächlich toten Romeo und ersticht sich mit dessen Dolch. Als der erschütterte Bruder Lorenzo den Angehörigen erklärt, was geschehen ist, versöhnen sich die Familienoberhäupter über dem toten Liebespaar.
Im Mittelpunkt des Stückes stehen hier nicht Lügen, sondern die alte unversöhnliche Feindschaft als Ursache der Tragödie, wie der Fürst von Verona mahnt: »Capulet! Montague! Seht, welch ein Fluch auf eurem Hasse ruht, so dass der Himmel Mittel findet, eure Freuden mit Liebe zu töten!«
Fast übersieht man dabei die Tatsache, dass am Ende dieser Aspekt zwar der tiefere Grund für den tragischen Tod der beiden Liebenden sein mag, nicht jedoch der konkrete Anlass. Der nämlich ist die Verwirrung, die durch Lorenzos Täuschungsmanöver mit dem Schlaftrunk entstanden ist. Julia wird durch ihn scheintot, also nicht wirklich tot, sondern nur dem äußeren Schein nach. Ohne an dieser Stelle schon genauer in Definitionen einsteigen zu wollen – dazu später mehr –, kann man die Situation als eine Art Lüge, nicht durch Worte, sondern durch absichtliche Erweckung eines falschen Eindrucks ansehen. Und genau dieses Nicht-die-Wahrheit-Darstellen führt letztlich dazu, dass sich erst Romeo und dann Julia töten, also zum Tod ausgerechnet der Liebenden, zu deren Vorteil die Täuschung ja arrangiert worden war.
Betrachtet man das Herbeiführen des Scheintodes in diesem Sinne als Lüge, dann handelt es sich hier um eine dritte Form der Lüge. Nicht eine mit der Absicht zu schaden, wie im Falle Jagos in Othello, nicht eine mit der Absicht, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, wie bei den Töchtern in König Lear, sondern eine allein in der Absicht, Gutes zu tun. Und dennoch liegen auch hier – als Folge der Lüge – am Ende die Protagonisten tot auf der Bühne.
Warum diese fatalen Konsequenzen? Es wirkt bei Shakespeare so, als laste ein Fluch auf der Lüge. Und dieser Fluch ist nicht der der bösen Tat, denn er trifft hier auch die gute, wohlmeinende Lüge. Doch wenn es so einen Fluch gibt, wo genau in der Lüge könnte dieser Fluch – neutraler formuliert, die Potenz der Lüge, Unheil zu stiften – liegen? Wenn man ihn nicht im Bereich des Magischen oder Sündhaften suchen will, muss er in der Struktur der Lüge zu finden sein. Und da drängt sich ihr Prinzip auf: das Auseinanderfallen von Realität oder wahrem Plan und dem, was vorgetäuscht wird.
»Ich bin nicht, was ich bin«, fasst Jago sein Vorhaben zusammen, sich an Othello durch lügenhafte Intrige zu rächen. Hier zeigt sich schon, wie virtuos Shakespeare mit dem Thema Lüge umgeht. In diesen kleinen unscheinbaren Satz packt er genau das: das Auseinanderfallen von Innen und Außen, die falsche Darstellung dessen, was in demjenigen vorgeht, der lügt. In Romeo und Julia setzt Shakespeare noch eins drauf und bringt eine neue Variante: das Schlafmittel, das Julia in einen scheintoten Zustand versetzt: »Ein jedes Glied, gelenker Kraft beraubt, soll steif und starr wie Tod erscheinen. Als solch ein Ebenbild des dürren Todes sollst du verharren zweiundvierzig Stunden.« »Wie Tod erscheinen«, »Ebenbild des dürren Todes« – das Auseinanderfallen von Anschein und Realität in Reinform. Und es ist genau diese Diskrepanz, nicht irgendeine Einflüsterung, die zum tragischen Ende führt.
Betrachtet man die drei Stücke Othello, König Lear und Romeo und Julia mit ihren drei Varianten der Lüge – der zum Schaden aus reiner Bosheit, der zum eigenen Vorteil und der, um anderen zu helfen – zusammen, könnte man sie fast für Illustrationen zu dem wohl bekanntesten und wirkmächtigsten Buch aller Zeiten über die Lüge halten: De mendacio – Über die Lüge des Kirchenlehrers Augustinus aus dem Jahr 395 n. Chr. Oder für dessen drastische dramatische Umsetzung.
In seinem Buch formulierte Augustinus nicht nur die bis heute gültige Definition der Lüge, sondern teilte die Lügen nach ihrem Schweregrad ein: 1. Lügen in Glaubensdingen, 2. Lügen, die niemandem nützen, aber jemandem schaden, also Lügen aus reiner Bosheit, 3. Lügen, die jemandem nützen, aber jemand anderem schaden, 4. Lügen aus Lust am Lügen, 5. Lügen rein, um zu unterhalten oder zu gefallen, 6. Lügen, die jemandem nützen und niemandem schaden, 7. Lügen, die niemandem schaden, aber ein Leben retten, und 8. Lügen, die niemandem schaden, aber »jemanden vor körperlicher Unreinheit bewahren« (womit Augustinus meint, zu verhindern, dass jemand sexuell missbraucht wird).
Lässt man den ersten Fall, die Lüge in Glaubensdingen, einmal außen vor – Augustinus hatte seine theologischen Gründe dafür, aber im täglichen weltlichen Leben zeigt sich das Problem nicht so drängend –, könnte etwas auffallen: Die Lügen aus Shakespeares Dramen wirken wie zugeschnitten auf Augustinus’ Fälle. Jagos Lügen in Othello sind Lügen aus reiner Bosheit. Sie nützen niemandem und sollen nur Othello schaden. Sie stellen also die schwerste, verwerflichste weltliche Form der Lüge dar. Die Lügen von König Lears Töchtern sind Lügen, die ihnen nützen, Lear und der ehrlichen Tochter aber schaden. Sie sind eine Stufe darunter angesiedelt. Und schließlich die Lügen von Bruder Lorenzo aus Romeo und Julia. Sie sollen den Liebenden und den verfeindeten Familien nützen, ohne zu schaden. Ja, man könnte sogar einen Schritt weiter gehen: Das Vortäuschen von Julias Tod durch den Schlaftrunk sollte sie vor der von den Eltern befohlenen Ehe mit Paris bewahren. Die aber wäre, da Lorenzo ja Romeo und Julia vorher schon heimlich getraut hatte, ungültig gewesen und hätte Julia in der Hochzeitsnacht mit Paris der Gefahr der »körperlichen Unreinheit« ausgesetzt. Das Täuschungsspiel fällt also vielleicht sogar in die achte und damit nach Augustinus harmloseste Gruppe von Lügen.
Und dennoch führen nicht nur die Lügen in Othello und König Lear, sondern auch die harmlose Lüge in Romeo und Julia zum Tod der Protagonisten oder tragen entscheidend dazu bei. Jede Lüge ist verheerend, scheint Shakespeare zu zeigen. Und findet sich damit ganz auf der Linie von Augustinus. Der nämlich fügte seiner Liste noch eine zentrale Aussage hinzu. Mögen die Lügen auch unterschiedlich schwer und damit schlecht sein, so gilt doch für alle, auch die leichtesten: Sie sind falsch. Für Augustinus galt ein eherner Grundsatz: Man darf niemals lügen. Woher und warum diese Strenge? Die Antwort fand Augustinus theologisch: Jede Wahrheit ist ein Abbild der ewigen Wahrheit Gottes. Das Lügen stellt somit eine Entfernung von Gott dar, und der Teufel als Gegenspieler Gottes ist der Vater der Lügen:
Es gibt keine Lüge, die nicht das Gegenteil der Wahrheit wäre. Denn wie Licht und Finsternis, Frömmigkeit und Gottlosigkeit, Gerechtigkeit und Unrecht, Sünde und Rechttun, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod, so sind Wahrheit und Lüge einander entgegengesetzt. Je mehr man deshalb die erstere liebt, umso mehr muss man die letztere hassen.
Das wirklich Faszinierende ist: Shakespeare zeigt dasselbe ohne den theologischen Hintergrund. Vielleicht ist es ein kleines Spiel, dass er gerade einen Kirchenmann, Bruder Lorenzo, die leichteste Lüge begehen lässt, denn Augustinus hatte betont, das Lügenverbot gelte besonders für Vertreter des Glaubens.
Unweigerlich fragt man sich an dieser Stelle, ob Shakespeare vielleicht das Buch De mendacio von Augustinus und die dort vertretene Einteilung der Lügen kannte. Historisch wäre es durchaus vorstellbar. Auf jeden Fall überträgt Shakespeare Augustinus’ Verbindung von Gott und Wahrheit beziehungsweise von Teufel und Lüge ins Weltliche: Indem Schein und Sein, Vorgetäuscht und Real auseinanderfallen, entstehen Probleme, die dann zu den fatalen Folgen führen. Hannah Arendt hat es in dem Zitat auf S. 13 fast schon poetisch formuliert als »dies hartnäckige Da, das letztlich unerklärbar und unabweisbar alle menschliche Wirklichkeit kennzeichnet«. »Dies hartnäckige Da« bezeichnet nichts anderes als die Tatsache, dass sich die Wirklichkeit nicht weglügen lässt. Man kann eine Scheinrealität erzeugen, aber die hat immer das Problem, dass sie nicht wirklich existiert und nicht mit der Realität übereinstimmt. Zwischen der Scheinrealität der Lüge und der wirklichen Realität besteht zwangsläufig eine Lücke, in der sich die Protagonisten verfangen und in die sie stürzen können.
»Mind the gap« lautet die sprichwörtlich gewordene Ansage der Londoner U-Bahn, die vor dem Spalt warnt, der in den Stationen entsteht, in denen die Bahnhöfe und ihre Bahnsteige kurvenförmig sind, eine Krümmung, welche die geraden Züge und Waggons nicht mitmachen können. Die Ansage wird mittlerweile weltweit eingesetzt, die Berliner U-Bahn etwa benutzt eine zweisprachige Version: »Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante! – Mind the gap between platform and train!«
»Mind the gap between lie and reality!«, möchte man das übertragen auf den Umgang mit der Wahrheit. »Bitte beachten Sie die Lücke zwischen Lüge und Realität!« Man will das Bild nicht zu weit treiben, aber es drängt sich hier fast auf. Im ersten Moment könnte man meinen, dass die Lüge zurechtgebogen ist, die Realität, die von der Wahrheit abgebildet wird, hingegen geradlinig und dass daraus dann die Lücke entsteht, ja, entstehen muss. Bei eingehenderer Betrachtung erkennt man aber, dass es genau umgekehrt ist. Hannah Arendt hat es wiederholt und auch in dem Zitat oben dargelegt. Es ist die Lüge, die zu gerade ist, weil sie künstlich hergestellt wird. Die Propagandafiktionen, die Lügen, zeichnen sich, so Arendt, »stets dadurch aus, dass in ihnen alle partikularen Daten einleuchtend geordnet sind, dass jedes Faktum voll erklärt ist, und dies gibt ihnen ihre zeitweise Überlegenheit«. Die Wirklichkeit dagegen ist von Zufällen und Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Wie etwa der Pestausbruch, der verhindert, dass Bruder Lorenzos Brief Romeo erreicht, und so den Plan durchkreuzt. Die Wirklichkeit ist also das Kurvige, das sich an die konstruierte Lüge nicht anpasst, und ist umgekehrt so komplex, dass keine Lüge das je so nachbauen kann.
Im Grunde findet sich diese Lücke zwischen Lüge und Realität oder der Unterschied in der Belastbarkeit zwischen Lüge und Wahrheit, wie ihn Hannah Arendt formuliert, auch in dem bekannten Sprichwort »Lügen haben kurze Beine«. Man wird dieses Sprichwort wohl am ehesten so interpretieren, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt. Und sich dann durchsetzt, weil sie eben, wieder in den Worten Hannah Arendts, über »dies hartnäckige Da« verfügt. Ein ähnlicher Satz ist als Fragment aus einem leider verschollenen Drama von Sophokles überliefert: »Es reicht zum Alter nimmermehr der Lüge Zeit«, mit anderen Worten: Lügen leben nicht lange. Denn, dazu noch einmal das Zitat von Hannah Arendt, »dafür fehlt ihnen die unabänderbare Stabilität alles dessen, was ist, weil es nun einmal so und nicht anders ist«.