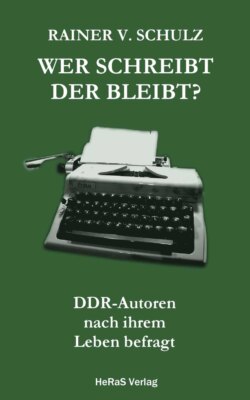Читать книгу Wer schreibt der bleibt? - Rainer Schulz - Страница 5
E.R. GREULICH
ОглавлениеEmil Rudolf Greulich (Erge) ist 1909 in Berlin geboren. Schriftsetzer. Wegen Beteiligung an der Maifeier von der Reichsdruckerei entlassen. Bald darauf Setzer in der „Roten Fahne“. 1929 Eintritt in die KPD. Nach 1933 illegale politische Tätigkeit. 1939 von der Gestapo gefasst, wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt und kurz vor der Entlassung aus dem Gefängnis Tegel 1942 zur Strafdivision 999 kommandiert. In Amerikanischer Kriegsgefangenschaft. 1946 nach Berlin zurückgekehrt, im Dietz Verlag als Korrektor tätig, später als Redakteur. Ab 1948 freier Schriftsteller.
Er erhielt mehrere Preise, u.a. 1968 den Goethepreis der Stadt Berlin. Greulich verstarb 2005.
Das Gespräch führte ich im November 2016 mit seiner Witwe Hannelore Greulich, Jahrgang 1925.
Frau Greulich hat den gesamten literarischen Nachlass ihres Mannes dem Literaturarchiv der Berliner Akademie der Künste vermacht.
H.G.: In dem Nachlass sind auch eine Menge Fotos. Die jungen Archivare kennen natürlich viele Personen nicht mehr, sie können nicht ahnen wer auf diesen Fotos zu sehen ist. Z. B. Stefan Heym, als er gerade mit seiner ersten Frau aus den USA nach Berlin gekommen war und in Bad Saarow im Eibenhof wohnte. Zu dieser Zeit waren mein zukünftiger Mann und ich bei einem Schriftstellerlehrgang dort. Für uns war das natürlich sensationell: Stefan Heym ist gekommen. Wir hatten ja alle sein Buch „Kreuzfahrer von heute“ gelesen. Es war wunderbar. Er erzählte aus Amerika, brachte uns sogar amerikanische Lieder bei und wir mühten uns dann mit unserem kümmerlichen Englisch, mit seiner Frau englisch zu reden, denn sie sprach kein Wort Deutsch. Aber er sagte immer „nein sie soll Deutsch lernen“ und „redet deutsch mit ihr“. Das Ergebnis war dann ein seltsamer Mischmasch aus englisch und deutsch. Aber wenn sich die jungen Leute heute diese Aufnahmen ansehen, fragen sie, „was, das soll Stefan Heym sein?“
R.S.: Die kennen ihn wahrscheinlich nur als Alterspräsidenten des deutschen Bundestages.
H.G.: Genau so. Ich musste sie alle benennen. Das hat mir einen Haufen Arbeit gemacht. Es gibt auch viel Schriftverkehr, mein Mann war ja in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und hat später noch mit Emigranten, die in Kriegsgefangenenlagern Vorträge über Demokratie und so weiter gehalten haben, korrespondiert. Diese Umerziehungsmaßnahmen haben die Amerikaner sehr intensiv betrieben. Wenn die Archivare heute diese Briefe lesen, dann ist das ein Professor so und so aus New York, aber das sagt ihnen nichts. Dabei waren oft bekannte deutsche Schriftsteller darunter, die aber ihre Namen amerikanisiert hatten, wie ich aus den Erzählungen meines Mannes weiß. Ich habe dann den deutschen Namen noch dazu geschrieben. Na ja das war abenteuerlich. Ich habe so viel weggegeben, dass mir praktisch nichts geblieben ist. Ich hab nicht einmal eine anständige Biografie meines Mannes.
R.S.: Das ist schade, denn er hat sicher eine Menge erlebt, das sich lohnt aufgeschrieben zu werden.
H.G.: Auf jeden Fall. Ich weiß viel aus seinem Leben; wir haben ja ununterbrochen miteinander geredet. Das war sehr bestimmend für unsere Ehe (lacht). Es hat mal jemand eine Reportage über uns geschrieben und als Überschrift nahm er ‚Miteinander reden‘ weil uns das so wichtig war, das stand an erster Stelle.
R.S.: Sein erstes Buch „Zum Heldentod begnadigt“, in dem er seine Zeit bei der Strafdivision 999 beschreibt, ist erstmals 1949 erschienen und danach nie wieder. Hat sich ihr Mann eigentlich nie um eine Nachauflage bemüht?
H.G.: Doch, aber es wurde immer mit der Begründung abgelehnt, das Buch sei zu naturalistisch. Mein Mann hat dieses Buch unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Erlebnisse geschrieben, also noch nicht mit literarischen Intentionen. Das Erlebte hat ihn so bedrückt, dass er das loswerden musste. Bereits in amerikanischer Kriegsgefangenschaft hat er den Text mit der Hand in ein Notizbuch geschrieben. Sein Freund, Horst Heitzenröther, ein Mitgefangener, den er dort kennengelernt hatte, hat das dann übertragen. Er war nämlich in der Schreibstube und hatte so Zugang zu einer Schreibmaschine, einer amerikanischen. Von diesem Manuskript existiert übrigens noch ein Exemplar, das habe ich noch hier. Ein zweiter Ablehnungsgrund war, dass das Buch so voller Landserromantik sei.
Das Buch war nicht angesehen. Es wurde sogar von ehemaligen 999ern angegriffen die später in hohen Funktionen waren. Und so bestand keine Aussicht, dass das Buch noch einmal erscheint. Obwohl verschiedene Kollegen immer wieder fragten, „warum kommt das Buch nicht wieder heraus?“
Es ist leider auch so, und das war vielleicht eine Schwäche in der literarischen Arbeit meines Mannes, dass er sehr viel im Jargon, im Berliner Dialekt, geschrieben hat. Das ist auch in seinen späteren Büchern zu viel, wie ich finde, aber das war seine Art.
R.S.: So war er eben.
H.G.: Na ja, er war eben ein waschechter Berliner.
R.S.: Ihr Mann wurde von seinen Parteigenossen nicht immer gut behandelt?
H.G.: Ja das stimmt. Wie schon gesagt, ehemaligen Kameraden von der Strafdivision 999, denen gefiel es nicht, das Heroische kam ihnen zu kurz. Aber sie wissen ja selbst, das Leben ist nie heroisch und das Buch ist eben ein Tatsachenbericht. Heldentum wird erst in der Literatur dazugegeben, manchmal auch in der Historienbeschreibung. Mein Mann hat sich immer dagegen gewehrt. Er war als Mensch sehr leidenschaftlich und temperamentvoll; er hatte immer Bodenhaftung. Ihm war nichts so zuwider wie dieses Überhöhte. Heldenbilder zu schaffen, das mochte er nicht. Gerade in diesem Buch ist davon aber nun wirklich nicht die Rede.
Trotzdem machte mein Mann immer wieder Ansätze, das Buch noch einmal herauszubringen. Er wurde überall abgewiesen, angefangen von seinem Hausverlag Neues Leben bis zum Militärverlag.
R.S.: Das war dann bei dem Buch „Amerikanische Odyssee“, das zwar viel später kam, aber doch eine Fortsetzung des Heldentodes war, anders.
H.G.: Beim Heldentod handelt es sich um einen Tatsachenbericht wo hingegen die Amerikanische Odyssee als Roman konzipiert war. Da hat er zum Teil frei gestaltet. Ja und der ist dann tatsächlich in mehreren Auflagen herausgekommen. Er ist auch, wenn sie vergleichen, etwas glatter geschrieben, als der Heldentod.
R.S.: Das wurde ja unter anderen Umständen geschrieben.
H.G.. Bei Heldentod war alles noch so unmittelbar.
R.S.: Das machte aber gerade das Authentische aus.
H.G.: Mein Mann war ein Mensch, aus dem platzte förmlich alles heraus. Wenn er unterwegs Dinge erlebt hatte und nach Hause kam, egal zu welcher Zeit, musste er sich sofort hinsetzen und das aufschreiben. Er war kein Diplomat, der lange überlegte sondern er riss immer gleich den Mund auf, ob privat oder öffentlich.
R.S.: Er war später in der DDR hoch dekoriert, er hatte alle möglichen Auszeichnungen bekommen?
H.G.: Na die wurden ja viel vergeben, es waren die üblichen vaterländischen Verdienstorden…
R.S.: …der ist ja nun nicht mehr ganz so üblich.
H.G.: Ja, der wurde ja doch in rauen Mengen verteilt. Er war ein alter Genosse und da ging das fast automatisch. Wenn einer Bronze hatte, dann war er nach gewisser Zeit dran für Silber.
R.S.: Er ersitzt sich das dann wie eine Beförderung?
H.G.: So ähnlich. Er hat nicht die höchsten Weihen erreicht, er hat es bis zum Goldenen gebracht, aber da war dann wirklich Schluss.
R.S.. Mehr gab es doch gar nicht, oder?
H.G.: Da gab es noch die Ehrenspange und dann mit Brillanten und so etwas.
Meinem Mann waren diese Orden ziemlich egal. So etwas liebte er nicht. Er schilderte mir immer wie diese Ordensverleihungen vor sich gingen, die Treffen im Staatsratsgebäude. Vorher trafen sich alle im Palast der Republik, und die Militärs kamen mit ihren Ordensbrüsten. Ich entsinne mich, auf der Einladung stand immer: „Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.“ Da sagte ich zu ihm: „Na du hast doch welche,“ und wollte ihm die anstecken. Da sagte er, „nee lass das, ich will das nicht, ich gehe so.“ Ich entgegnete, „das kannst du doch nicht machen.“ Frauen sind da eben kompromissbereiter; deshalb habe ich ihm seinem Orden‚ ‚Kämpfer gegen den Faschismus‘ in die Jackentasche gesteckt. Er kommt in den Palast der Republik und trifft Ruth Werner (Anm. Ruth Werner war, Schriftstellerin und Agentin des sowjetischen Militärnachrichtendienstes GRU), die guckt ihn an und sagt zu ihm: „Sag mal du kommst ja hier so kahl an, du hast doch auch Orden.“ „Ja“, sagt er, „aber ich mag die nicht anlegen, meine Frau hat mir einen in die Jackettasche gesteckt.“ Da greift sie in seine Tasche und findet diesen einen Orden und sagt zu ihm, „na den kannst du doch aber mit Stolz tragen und den hefte ich dir jetzt an.“ Und das hat sie dann auch gemacht.
Er hat mal den Goethepreis der Stadt Berlin bekommen, der war für ihn wirklich wichtig, denn das war ein Preis für seine literarische Arbeit.
R.S.: Er hat später auch Jugendbücher geschrieben, „Die Verbannten von Neukaledonien“, z.B. aus der Reihe Spannend erzählt?
H.G.: Ja, diese Reihe. Dafür hat er sich persönlich sehr eingesetzt, weil er noch wusste, was er als junger Mensch so verschlungen hat an Abenteuerbüchern. Er glaubte immer, bei der Jugend sei dieser Hang auch heute noch vorhanden und er hielt es für wichtig, spannende Bücher herauszubringen. Diese Reihe wurde später sehr erfolgreich, es wurden hohe Auflagen erzielt. „Robinson spielt König“, war das Buch mit der höchsten Auflage, da sind fast eine Million Bücher gedruckt worden. Damit wurde mein Mann sehr populär.
R.S.: Er hat auch über Widerstandskämpfer geschrieben.
H.G.: Das stimmt. Diese drei Bücher, über Anton Saefkow, Artur Becker und Karl Liebknecht, bzw. eine Periode aus dem Leben Karl Liebknechts, waren Auftragsarbeiten. Der Verlag ist an ihn herangetreten, ob er das nicht machen will. Er hat lange überlegt, weil er sich lieber selber seine Stoffe und Themen gesucht hat. Und er hatte genug davon, daran mangelte es nicht.
Er wollte es eigentlich nicht machen und er sagte mir einmal, dass er sich bei Artur Becker und Anton Saefkow doch als ehemaliger Widerstandskämpfer in gewisser Weise verpflichtet fühlte, und er wollte es eben versuchen. Er wollte keine Helden darstellen, darum auch der Titel des Saefkow Buches „Keiner wird als Held geboren“, sondern er wollte sie wirklich menschlich darstellen. Darüber hat sich mein Mann mit dem Lektor überworfen, und alles hinwerfen wollen. Das war das, worunter er gelitten hat, weil er mit der Heldenverehrung, die ja immer schlimmer wurde, nicht fertig wurde. Die Führung mochte ja nur dieses strahlende Bild. Mein Mann hatte sich hingesetzt und nicht nur aus den üblichen, offiziellen Verlautbarungen sein Material geschöpft, sondern er hat die Angehörigen aufgesucht. Er hat von denen persönliche Brief bekommen, in denen eben auch Dinge standen die sehr menschlich waren und von denen er glaubte, dass sie unbedingt in einem Buch über diese Person dargestellt werden müssen, und da fingen die Schwierigkeiten an. Diese Menschen haben doch nicht nur auf den Barrikaden gestanden und gekämpft; mein Mann wollte eben auch das zeigen. Das wurde sofort als Diffamierung eines Widerstandskämpfers dargestellt. Die DDR war leider sehr moralinsauer. Was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, kam ja nicht an die Oberfläche. Also auch eine gewisse Heuchelei, das war beinahe wie in der Katholischen Kirche. Damit ist mein Mann so schwer fertig geworden.
R.S.: Ihr Mann war überzeugter Kommunist, ein richtiger Idealist?
H.G.: Ja, er ist ja so aufgewachsen, in einem sozialdemokratischen Elternhaus, seine Mutter war eine Rednerin bei den Sozialdemokraten, also für die damalige Zeit eine sehr emanzipierte Frau, sein Vater war Buchdrucker, sehr gebildet und belesen und den Künsten zugewandt. So war mein Mann als Kind praktisch schon politisch. Für mich war das ganz erstaunlich, weil ich aus einem ganz anderen Elternhaus komme.
Bei meinem Mann war das schon als Schuljunge selbstverständlich, dass man sich politisch betätigte und das hat sich durch sein Leben gezogen. Er war besonders in der proletarischen Jugend sehr aktiv, die SPD war ihm zu bürgerlich, aber in die KPD ist er auch nicht eingetreten. Er hatte bestimmte Ideale, z.B. kein Alkohol, kein Nikotin, das war so bei dem Jungproletarischen Bund, dem er angehörte, üblich. Im kommunistischen Jugendverband wurde doch hin und wieder über die Stränge geschlagen und das lehnte er ab. Mein Mann sagte, sie haben den Ausdruck „Radaukommunisten“ gebraucht. Und das wollten sie nicht sein. Sie hatten Ideale, sind auf Wanderschaft gegangen, haben gesungen, waren Mitglieder des Vereins „Freie Volksbühne“ und der Fichte Wandersparte. Mein Mann ist erst 1929 in die KPD eingetreten als die große Demonstration in Berlin war, bei der Arbeiter erschossen worden sind, was dieser sozialdemokratische Polizeipräsident angeordnet hatte. (Anm. Karl Zörgiebel war der Polizeipräsident von Berlin. Bei den Mai-Unruhen vom 1. bis 3. Mai 1929, wurden durch das harte Vorgehen der Polizei, zahlreiche Demonstranten und Unbeteiligte getötet oder verletzt.) Mein Mann war bei dieser Demonstration mit Freunden dabei und sagte unter diesem Eindruck, man muss in einer Partei sein um wirklich kämpfen zu können, um wirklich etwas verändern zu können.
Er hat dann ab 1933 illegal gearbeitet, Flugblätter gedruckt und verteilt, war arbeitslos, hatte dann Arbeit in kleinen Betrieben, Druckereien. Er ist 1939, noch vor Beginn des Weltkrieges, zur Hilfspolizei am Kottbusser Tor eingezogen worden. Natürlich hatte er immer noch Verbindungen zu alten Genossen, die eine illegale Druckerei eingerichtet haben. Und da war er ihnen als ehemaliger Schriftsetzer behilflich, Bleibuchstaben für den Schriftsatz zu bekommen. Diese Sache ist dann aufgeflogen und mein Mann wurde verhaftet. Er wurde wegen Hochverrat zu zweieinhalb Jahren verurteilt und hat die Strafe in Tegel abgesessen. Bevor die Zeit um war, hat er den blauen Schein bekommen auf dem ihm die Wehrfähigkeit, die ihm aberkannt worden war, wiedergegeben wurde. Noch vor Ablauf der Strafe erhielt er die Einberufung. Dann ist er zu den 999ern nach Nordafrika gekommen.
R.S.: Nach seinem Einsatz im Afrika Corps und der folgenden amerikanischen Kriegsgefangenschaft ist er 1947 nach Deutschland zurückgekehrt. Da gab es ja die DDR noch nicht.
H.G.: Er ist zunächst nach Süddeutschland gekommen. Von da wurde aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft niemand in die sowjetisch besetzte Zone entlassen. Aber er wollte unbedingt nach Hause, er hatte hier seine Familie und darum hat er sich zur amerikanischen Wachschutztruppe in Westberlin gemeldet, die Objekte bewachte. So wurde er nach Westberlin überstellt. In Westberlin hat er sich in die S-Bahn gesetzt und ist nach Hause gefahren.
R.S.: Dann kam die Staatsgründung der DDR 1949. Hat er eigentlich mit dem Gedanken gespielt die Seite zu wechseln, in den Westen zu gehen?
H.G.: Ja, später, aber erst viel später. Sie dürfen nicht vergessen, damals herrschte noch eine Aufbruchsstimmung. Ich habe das ja auch erlebt. Das kann man heute kaum nachempfinden, aber nach diesem schrecklichen Krieg und diesen bitteren Nachkriegsjahren 1946 und 47, da waren die Menschen wieder optimistisch obwohl noch alles in Trümmern lag.
E.R. Greulich schilderte seine Empfindungen an diese Zeit in einem Interview mit Ursula Reinhold, das in den Weimarer Beiträgen, Heft 5, 1991 erschien, wie folgt:
Ich war ehrlich bemüht zu helfen, die beste Sache der Welt zur wirklich besten Sache zu machen. Meinem bewussten Tun lag kein Eigennutz zugrunde. Ohne Abstriche meinte ich damals, die große Sache ist in Ordnung, die kleinen hässlichen Dinge muss man ändern. Sicher gab es Keime und Ansätze später deutlicher hervortretender politischer Abscheulichkeiten, doch dagegen stand die Überzeugung, der eingeschlagene Weg ist die einzig richtige Konsequenz aus den Erfahrungen von Krieg und Faschismus. Die negativen Erscheinungen der Weimarer Republik sollten vermieden werden. Heute wird zu leicht vergessen, was uns hinter der Elbe alles angestunken hat. Die fast gänzlich ausbleibende Abrechnung mit dem großen Kapital als dem Hauptnutznießer des Faschismus, die ganze Adenauerei mit den Globkes, mit dem alten Beamten- und Justizapparat, die politische Lahmlegung der Bevölkerung durch den Dollarsegen und dessen Wirtschaftswunder ...
… Ein guter Wurf war die Gründung der Wochenpost. Walther Victor und Rudi Wetzel bekamen von der SED-Parteileitung den Auftrag, eine überparteiliche Wochenzeitung zu organisieren. Walther Victor holte mich noch dazu, und wir drei legten dann ein Konzept vor, das diskutiert, variiert, wieder diskutiert und dann realisiert wurde. Ich sollte Redakteur werden, lehnte aber ab. Als freier Mitarbeiter habe ich Kurzgeschichten, Erzählungen und vor allem Reportagen für das Familienblatt geschrieben. Bis zu jenem Punkt, da der Spielraum für journalistische Arbeiten immer enger wurde. Selbst einer, der so beteiligt war wie ich, musste da stutzig werden. Die Redaktion schickte mich nach Eisenach, um eine Reportage zu schreiben über die Herstellung des Wartburg, dem damals neuentwickelten Glanzstück. Dort traf ich auf eine deutliche Unzufriedenheit der Arbeiter über die miserabel organisierte Produktion. An die siebzig Wartburgs standen herum und blockierten die Endfertigung, es fehlten die Scheibenwischer. Der verantwortliche Meister nahm mich mit in seinem F 8, wir fuhren zum Zulieferbetrieb und kamen mit einem Dutzend Scheibenwischer zurück. Kinderkrankheiten, dachte ich, in wenigen Jahren werden wir darüber lachen. Welch ein Irrtum. Von Jahr zu Jahr nahmen derartige Produktionsunsinnigkeiten zu. Selbst in der vergleichsweise offenherzigeren Wochenpost durfte über derartige Pannen am laufenden Band nichts erscheinen. Andere Kollegen erlebten ähnliches; im Schriftstellerverband wurde über all das relativ offen und kritisch diskutiert.
Reinhold: Wann wurde es so kompliziert und unergiebig, dass du aufgehört hast, Reportagen für die Wochenpost zu schreiben?
Greulich: Etwa Anfang, Mitte der Sechzigerjahre. Diese persönlichen Erlebnisse könnte man genauer an ZK-Beschlüssen und Parteitagsresolutionen festmachen, würde man entsprechendes Material wälzen. Ich sollte über den Schwermaschinenbau „VEB Heinrich Rau“ in Wildau schreiben, die bekannte Fotografin Lotti Ortner kam mit, um Aufnahmen vor Ort zu machen. Ich bekam leicht Kontakt, die Arbeiter schütteten ihren Groll aus über Sinnwidrigkeiten in der Produktion, über Schwierigkeiten mit dem Plan, und die Meister bestätigten es. Hätte ich im Sinne der Arbeiter geschrieben, wäre es nicht gedruckt worden, hätte ich im Sinne der Wochenpost geschrieben, hätten mich die Arbeiter verflucht. Über Wildau schrieb ich keine Zeile und das bedeutete eine Art Zäsur in meinem Autorendasein. Ich wandte mich dankbareren Aufgaben zu, schrieb Romane und Erzählungen. Die bekannten Anstände gab es dabei auch, denn man wünschte die makellose, geschönte Persönlichkeit, aber man konnte doch publizieren. Eine Zeitung erreicht Hunderttausende, ein Buch bestenfalls Tausende. Nicht zuletzt deshalb war die Zensierung der Literatur etwas lockerer. Manchmal konnte man auch eine gewünschte Korrektur zusagen und sie dann vergessen. Denn das Interessante, worüber kaum gesprochen wird, die ideologischen Krümelkacker mochten die absurdesten Einwände haben, das gedruckte Buch hat dann keiner von denen gelesen.
Zurück zu Hannelore Greulich:
Das Leben war zwar schwer, aber diese Aufbruchsstimmung war stark. Alle sagten, dieses Dunkle, Schlimme liegt hinter uns, jetzt muss was Neues kommen. Da erschien vielen die Ostzone, die DDR, als erstrebenswertes Ziel. Ich selbst kann mich noch erinnern, dass es diese Jugendausschüsse gab, vor Gründung der FDJ. Da traten dann Emigranten auf, wie Kessler, die später an der Spitze der DDR standen. Das waren damals junge Männer, voller Enthusiasmus. Da waren wir als junge Menschen auch hingerissen. Während man nach Westdeutschland schaute und zum Teil Beklemmungen hatte. Das wissen sie ja selbst auch, dass dort doch wieder so alte Nazis an der Macht waren.
Es entwickelte sich später dieser Missmut bei meinem Mann, diese Schwierigkeiten beim Schreiben. Dass zu seinem Liebknechtbuch gesagt wurde, was nicht geschrieben werden darf, weil das der sozialistischen Moral widerspricht. Er sagte immer ich will nicht den Revolutionär zeigen, der auf dem Potsdamer Platz steht und redet, sondern ich will den Menschen zeigen. Und Karl Liebknecht war ein interessanter Mensch, so gebildet. Er hatte auch eine langjährige Geliebte und deshalb natürlich familiäre Schwierigkeiten. Aber er wollte sich von seiner Familie nicht trennen. Und dabei hatte er immer noch die politische Arbeit. Mein Mann hat versucht das alles in einem Buch unterzubringen, und es ist schlimm ausgegangen. Es gab immer Katastrophen mit den Manuskripten, dann sollte gestrichen werden, dies und das sollte herausgenommen werden. Dabei ging es mitunter um lächerliche Dinge. Im Liebknecht Buch wird beschrieben, wie er bei einer Reise von London nach Paris, im Coupé mit einer Dame saß. Er war sehr charmant, daraus ist dann gar nichts entstanden. Nur mein Mann hat das sehr hübsch beschrieben, wie er so wohlgefällig die Dame betrachtet, wie er das Gespräch führte, er sprach ja mehrere Sprachen; dies allein hat Anstoß erregt. „Das Kapitel muss raus, was hat das mit dem Revolutionär zu tun? Und mit seinen hehren Zielen, dass er so gern schöne Frauen sieht und sich mit ihnen unterhält?“
Und so ging das immer weiter. Die Parteiversammlungen im Verband wurden immer ritualhafter. Es wurde nicht mehr so von der Leber weg gesprochen. Das hat meinen Mann sehr beschäftigt, weil er ein so grundehrlicher Mensch war.
Schon am 17. Juni wuchsen seine Zweifel und ich war eigentlich diejenige, das mache ich mir heute noch zum Vorwurf, die oft gesagt hat, „ach na ja das sind doch Dinge, die sich schon klären werden, das sind Schönheitsfehler.“ Obwohl ich niemals in der Partei war und dazu gar keine Veranlassung hatte. Aber ich wollte eben auch, dass er innerlich zur Ruhe kommt und sich mehr seiner schriftstellerischen Arbeit widmet.
E.R. Greulich schilderte seine Erinnerungen an diesen Tag im Interview mit Ursula Reinhold so:
Wir wohnten damals in der Immanuelkirchstraße. Unserem Haus gegenüber befand sich eine Abteilung der Bekleidungsfabrikation von „Fortschritt“. Stimmengewirr frühmorgens ließ uns auf den Balkon treten. Die Betriebsangehörigen versammelten sich vor der Toreinfahrt. Hinter roter Fahne und selbstgebasteltem Transparent, „Nieder mit den Normen“, formierten sie sich zur Demonstration und marschierten den Prenzlauer Berg hinab. Wir lebten mitten in der aufgeheizten Atmosphäre und waren doch erschrocken. Ich dachte, eine Demonstration gegen die Partei. Dann korrigierte ich mich: Gegen die falsche Politik der Partei. Doch wer hält das so präzise auseinander? Es ist ernster als wir ahnten, wusste ich jetzt, und machte mich auf zum Sekretariat des Schriftstellerverbandes in der Friedrichstraße. Mit einem Hexenschuss geschlagen, humpelte ich krumm und am Stock den ganzen Weg zu Fuß. Straßenbahnen standen leer und verlassen auf den Schienen, Geschäfte waren geschlossen, aus den Seitenstraßen strebten Demonstranten in lockeren Haufen zur Stadtmitte. Ihre Losungen waren hastig gemalt, aber eindeutig, ihre Parolen klangen aggressiv, teilweise hasserfüllt. Je näher ich dem Sekretariat kam, desto heftiger brodelte es überall. In der Friedrichstraße sah ich einige junge Burschen, die eine Republikfahne herunterholten und verbrannten. Deutlich erkennbar, eine Schar aus dem Westteil der Stadt. Kollegen, die mit und nach mir eintrafen, berichteten von ähnlichen Trupps, die Zeitungsstände ansteckten, Kioske demolierten und Autos umkippten. Wir verbarrikadierten das Haus und bewaffneten uns mit Stuhlbeinen. Sämtliche Versuche, telefonisch oder per Kurier die Kreisleitung, die Bezirksleitung oder das ZK zu erreichen, blieben den ganzen Tag erfolglos. Stefan Heym hat diese Episode in seinem Nachruf ironisch vermerkt. Ohne das Eingreifen von westlicher Seite zu übersehen, wurde nicht nur mir bewusst: das Desaster ausgelöst hatten Fehlentscheidungen der Regierung und Parteiführung. In einem Artikel im ND, gleich am nächsten Tag, unterstrich es der Ministerpräsident Otto Grotewohl mit dem Satz: „Wenn man eine Fackel auf Beton wirft, kann nichts brennen.“ Sehr bald schon wollte es die Parteispitze nicht mehr wahrhaben. In einer Sitzung des Parteiaktivs im Schriftstellerverband, kurze Zeit nach dem 17. Juni, machte ich meinem Unmut über das Versagen der Parteiführung Luft. In meinem ganzen Parteileben bin ich, salopp gesagt, nicht so brachial zusammengeschissen worden wie an diesem Abend von Michael Tschesno-Hell, Gründer und damals Verlagsleiter des Verlages Volk und Welt. Mit Marx, Engels, Lenin und selbstverständlich Stalin, bewies er mir meine politische Unreife, mein Kapitulieren vor dem Klassenfeind, meinen ideologischen Defätismus. Wie Brecht hat er nicht argumentiert, von dem der Satz stammt, wenn das Volk der Regierung nicht passe, dann müsse sich die Regierung halt ein anderes Volk wählen.
Hannelore Greulich weiter:
Also kurzum, es kann in den Siebzigerjahren gewesen sein, aber ich weiß es nicht mehr genau, da kam mein Mann eines Morgens, er hatte bis in die Nacht hinein gearbeitet, und gab mir ein paar Blätter. Er sagte, „lies dir das durch, das ist ein Entwurf.“ Da war das ein Brief an seine Partei in dem er seinen Austritt aus der Partei erklärt und einen Ausreiseantrag stellt. Da können sie sich ja vorstellen, was hier los war und wie wir diskutiert haben. Ich habe wirklich Angst um meinen Mann gehabt. Er war so deprimiert; ich hatte manchmal Angst er tut sich was an. Er war mit sich, der Welt und seiner Partei nicht zufrieden. Andererseits fürchtete er auch immer, wenn er jetzt aufsteht und sich öffentlich äußert, es könnte der Partei schaden. Er wollte ihr ja nicht schaden. Die alten Genossen hatten eine starke Parteidisziplin, die sie auch durch dick und dünn hochgehalten haben. Viel später ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass das ein Fehler war. Da hat er nicht nur zu mir, sondern auch zu anderen gesagt, dass ein Schriftsteller ein Künstler keiner Partei angehören darf. Das schränkt ihn ein in seiner künstlerischen Arbeit. Und da ist natürlich was dran.
R.S.: Der Brief mit dem Parteiaustritt wurde nie abgeschickt?
Gr.: Nein. Damals war ich diejenige, die gesagt hat: „Gut, wenn wir das tun, wie stellst du dir deine weitere Arbeit als Schriftsteller vor? Als Schriftsteller wirst du so nicht weiterleben können.“ Mir war klar: Er war ja doch parteipolitisch geprägt und er war auch nicht der Mensch der sich vielleicht gesagt hätte, na gut ich geh rüber und schreiben jetzt Schmonzetten.
R.S.: Aber er hat Abenteuergeschichten geschrieben, wie „Die Verbannten von Neukaledonien“. Das hätte sicher auch im Westen Leser gefunden.
H.G.: Aber ich hatte eben Angst, denn er war doch zu sehr verwurzelt um hier wegzugehen; mir wäre es leichter gefallen. Meine Eltern lebten ja in Westberlin. Aber seinetwegen hatte ich Angst. Bloß auf der anderen Seite habe ich ihn natürlich durch meine Kompromissbereitschaft oder Feigheit auch in gewisser Weise gebremst. Das muss ich heute sagen.
R.S.: Dieses Wort Feigheit verwendete er auch, ich zitiere ihn: „Abschließend auf einen Nenner gebracht: Ich habe mich nicht vor die Parteiführung hingestellt und meine Kritik herausgeschrien. Ich war feige. Nach zwölf Jahren Widerstand, Verhaftung, Zuchthaus und Stacheldraht hatte man mich das Fürchten gelehrt. Dennoch habe ich mich nach 1945 für eine bessere Welt engagiert. Es dauert lange, bis man entdeckt, dass die an der Spitze anderes tun als sagen, und wenn sie denken, dann vor allem an sich. Länger noch dauert es, bis man das in allen Dimensionen begreift. Dann aber ist man zu alt, um wiederum den Kampf aufzunehmen, diesmal gegen einstige Gefährten.“ Zitat Ende.
H.G.: Er war ja auch hin und her gerissen. Er hat zwar oft genug etwas gesagt; es war auch nicht so, dass er immer den Schnabel gehalten hätte und immer ja und amen gesagt hat, er hat schon versucht sich gegen bestimmte Dinge zu wehren, darum – wie hat er sich immer ausgedrückt – „ich hab ein rotes Kreuzchen in meiner Akte.“ Man begegnete ihm immer mit einem gewissen Misstrauen, und dass das auch realistisch war, haben wir dann erst 1990 erfahren. Mein Mann hat zwar nie seine Akten bei der Stasiunterlagenbehörde einsehen wollen, aber durch eine Bekannte haben wir doch etwas erfahren, eine verrückte Geschichte:
1990, als das Parteiarchiv aufgelöst wurde, ist sie dabei gewesen. Da waren Leute, die alle Akten herausrissen, zerrissen in die Ecken warfen. Sie hat nach einer bestimmten Sache gesucht, nach einem Manuskript, weil sie gehört hatte, dass das Parteiarchiv zerflattert. Sie hat das, was sie suchte, nicht gefunden, aber – aber so etwas könnte man noch nicht einmal in einem Roman schreiben - sie guckt so und sieht auf einem Blatt mit Schreibmaschine geschrieben, den Namen Greulich. Sie nimmt das Blatt auf und findet noch zwei andere dazu. Sie hat sich das durchgelesen und es uns gebracht.
Ich habe eine Kopie davon, das Original ist im Archiv. Da ist mein Mann schon verdächtigt worden, eine Plattform zu bilden (lacht), ich werde ihnen das mal vorlesen, das ist grotesk. Es ist ein Bericht: Besprechung mit dem Genossen Kurella. Ein Bericht des Sekretärs des Schriftstellerverbandes und Parteisekretärs, am 25.10 1958 an das ZK der SED. Nach einigen Anschmierereien über andere Kollegen, wird der Name Heinz Brandt erwähnt. Ist der ihnen ein Begriff? Heinz Brandt war in den KZ‘s Auschwitz und Buchenwald inhaftiert. Seine Geschwister waren in der Sowjetunion den stalinschen Repressionen zum Opfer gefallen, sie sind umgebracht worden. Er ist hier in hohe Funktion gekommen, war beispielsweise Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin. Mit seiner Vergangenheit ist er jedoch nie fertig geworden, Er, ein innerlich zerrissener Mensch, ist 1958 in den Westen gegangen und von dort hat ihn die DDR wieder hierher entführt. In der DDR hat er dann im Zuchthaus gesessen, bis ihn die Bundesrepublik freigekauft hat. Später hat er in der internationalen Gewerkschaftsbewegung gearbeitet und war Gründungsmitglied der Grünen. Heinz Brandt hat in grauer Vorzeit, in den Fünfzigerjahren, mit dem Schriftsteller und Drehbuchautor Gerhard Bengsch gearbeitet, der für den Film „Krupp und Krause“, später den Nationalpreis bekam. Mit meinem Mann hat Bengsch DEFA-Kurzfilme geschrieben, an denen auch Brandt mitgearbeitet hat. Sie kamen öfter zusammen und daraus ist dann hier in diesem Bericht des Parteisekretärs Folgendes gemacht worden:
„Heinz Brandt, dieser Fall wirkt sich bis tief in die Reihen der Partei und des Schriftstellerverbandes aus. Briefe von ihm sind an uns abgeliefert worden von: … (jetzt werden verschiedene Namen genannt). Eine Unterredung mit dem Genossen Hartel ergab, dass eine ständige private Verbindung des Heinz Brandt zu den Schriftstellern … folgende Namen enthält: Gerhard Bengsch, E.G. Greulich. Es ist bekannt, dass alle Genannten sich wiederholt mit Brandt in den Wohnungen der Genossen Bengsch und Greulich reihum getroffen haben. Es ist weiterhin bekannt, dass diese Genossen seit der Zeit keine positive Einstellung zur Partei gezeigt haben. Und dann kommt noch: Bengsch und Greulich, behaupten von Brandt bis heute keine Briefe erhalten zu haben. Beide haben von sich aus der Partei gegenüber noch keine Stellungnahme zu ihrem Verhältnis zu Brandt abgegeben. Die Bezirksleitung der Partei ist aufgefordert im Augenblick nichts zu unternehmen.“
So, und das haben sie auch nicht, das hat mein Mann erst nach der Wende erfahren. Sie können sich vorstellen, wie das auf ihn gewirkt hat. Er sagte meine Partei, hinter meinem Rücken hat solche Sachen behauptet, warum hat man mich nicht vorgeladen und gesagt: „Hör mal zu, du hast doch Verbindung mit Heinz Brandt gehabt, sag doch mal in welcher Art war diese Verbindung, usw.. Das muss er dann auf diese abenteuerliche Weise erfahren. Sie können sich doch vorstellen, dass das auch so spät noch wie ein Schock gewirkt hat.
R.S.: Ihr Mann wollte auch ein Buch über seine Wanderjahre in Spanien schreiben, und deshalb das Land besuchen?
H.G.: Ja das wollte er, er hatte sich um einen Vertrag für das Buch bemüht und natürlich waren dafür auch Genehmigungen und Devisen erforderlich. Es hätte die DDR nicht viel gekostet, denn meine Eltern hätten ihn unterstützt. Aber er bekam die Ausreise nicht. Das war auch eine Enttäuschung für ihn. Er hatte es sich sehr interessant vorgestellt, die Orte aufzusuchen, wo er in seiner Jugend war. Daraus ist leider nichts geworden.
Er wollte auch einmal ein Buch über den 20. Juli schreiben. Mit Wolfgang Schreyer zusammen. Schreyer wollte über den bürgerlichen Widerstand schreiben und mein Mann über den proletarischen Widerstand, weil er sich da ja besser auskannte. Das Projekt ist dann gestorben, sie hatten schon viel daran gearbeitet, hatten sogar dafür Geld bekommen, aber eines Tages wurde es abgeblasen.
Nochmal sei E.R. Greulich aus dem Interview mit Ursula Reinhold zitiert:
Mit vielen VdN-Kameraden (Anm. Verfolgter des Naziregimes) habe ich die Absolutsetzung unseres Widerstands als ungerecht empfunden, mag man auch in der Bundesrepublik den kommunistischen Widerstand totgeschwiegen haben. Ich weiß noch, wie bestürzt wir waren, als Falk Harnack, der selbst illegal aktiv gewesen ist, Regisseur des Films Das Beil von Wandsbek, nach dem Westen ging. Dieser Film nach dem gleichnamigen Roman von Arnold Zweig, behandelt das Mitläufer-Problem. Willfährige Kritik behauptete, der Henker Teetjen sei zum Helden hochstilisiert worden, und so landete auch dieses Kunstwerk im Keller. Die gleiche Problematik hat wesentlich später Fritz Selbmann angepackt mit seinem Roman Der Mitläufer und hätte ihn nicht der ehemalige Minister Selbmann geschrieben, dieses Buch wäre nie erschienen. Wolfgang Schreyer hatte vor, nach seinem Erfolg mit dem Unternehmen Thunderstorm einen Roman über den 20. Juli zu schreiben, er nannte es Projekt 207 und wollte mich als Berater dazu haben. Sozusagen als Vorversuch schrieb er eine Erzählung. Die erschien nach so vielen Einwänden, Bedenken und Änderungsansprüchen, dass Schreyer vom Projekt 207 Abstand nahm. „Schreibt über die Kommunisten im Widerstand“, lautete der Tenor aller Einwände, bürgerliche Helden brauchen wir nicht. Ich hatte über den Kommunisten Anton Saefkow geschrieben, den Leiter der größten deutschen Widerstandsgruppe. In dem Roman Keiner wird als Held geboren spielt eine höhere Tochter aus besserem Haus eine Rolle, die sich nicht zuletzt unter dem Einfluss Antons nach links hin entwickelt. Die Querelen wegen dieser Episodenfigur waren grotesk, und dies, obwohl die meisten Genossen in der Parteispitze alte Widerstandskämpfer waren. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass sie von den Ärgernissen auf diesem Gebiet wussten, doch ein normaler Sterblicher kam schon lange nicht mehr an die oben heran.
Hannelore Greulich weiter:
Nach 1989, als Schreyer an seine Akten heran kam, hat er festgestellt, dass die Staatssicherheit das Projekt unterbunden hatte. Der Verlag hatte der Staatssicherheit das Konzept übergeben, die haben gesagt, „um Himmels willen nein, der proletarische Widerstand ist nicht richtig dargestellt“.
R.S.: Stauffenberg war denen ja auch nie so ganz geheuer.
H.G.: Das stimmt, obwohl Verbindungen bestanden haben. Wir haben eine Menge Material gewälzt, es haben Verbindungen bestanden, es gab sogar ein Treffen zwischen proletarischen Widerstandskämpfern und Vertrauten von Stauffenberg.
Aber das hat eben auch nicht gepasst. Schreyer und mein Mann hatten keine Ahnung, warum, es wurde ihnen nur gesagt, aus diesem und jenem Grund, es ist nicht richtig dargestellt, aber wer wirklich dahinter steckte haben wir erst nach 1990 erfahren. Das war im Nachhinein eine große Enttäuschung.
R.S.: Hat ihr Mann in den Achtzigerjahren überhaupt noch veröffentlichen können?
H.G.. Da ist „Des Kaisers Waisenknabe“ erschienen, die Hetärenträume, Geschichten und Aphorismen, aber ich hab das nicht mehr genau im Kopf. Doch, da kam noch einiges.
R.S.: Wie war das für Sie am 9. November 1989?
H.G.: Wir haben das überhaupt nicht mitbekommen. Wir haben an dem Abend nicht ferngesehen, haben Musik gehört, geplaudert, und auch am anderen Morgen keinen Rundfunk gehört. Ich fahre zu meinem Zahnarzt, sitze in dem Zahnarztstuhl, und da sagt er, „meine Sprechstundenhilfe ist heute nicht gekommen, sie ist in Westberlin“. Ich sag, „wie bitte“, ich verstand das nicht, na vielleicht besucht sie ihre Oma, aber da sagt er: „Frau Greulich die Mauer ist offen!“ Da hab ich das erst mitbekommen. Ich bin nach Hause gefahren. Mein Mann hatte auch noch keine Zeitung gelesen und war völlig ahnungslos. Er war nicht etwa traurig, durchaus nicht.
Ich habe mich gewundert, wie er über die Dinge dachte, die sich vorher ereignet haben, die große Demonstration auf dem Alexanderplatz. Da hat er sich mit Horst Heitzenröther, seinem Freund, ausgetauscht, der dabei war. Mein Mann konnte schon nicht mehr, denn er war damals schon sehr krank, er war ans Haus gefesselt. Bei ihm war auch eine gewisse Angst vorhanden, denn es hätte auch alles aus dem Ruder laufen können, wir hätten auch einen Bürgerkrieg haben können. Andererseits gab es auch eine gewisse Befreiung. Mein Mann hat diesen Umbruch oder „Die Wende“ wie es genannt wurde, mit einer Ruhe aufgenommen, dass ich mich gefragt habe: „Was geht in ihm vor?“ Obwohl wir sonst so viel miteinander geredet haben, aber darüber haben wir seltsamerweise wenig gesprochen. Er hat das innerlich verarbeitet, aber viel ruhiger als ich das befürchtet habe. Man hörte ja auch von Leuten, die sich das Leben genommen haben, die wirklich zusammengebrochen waren. Aber er hatte wohl gefühlt, dass es nicht so weiter gehen konnte, dass sich etwas ändern musste. Es ist erreicht - und es ist gut so.
Er hat das, obwohl er wusste, dass damit seine schriftstellerische Laufbahn beendet ist, so gesehen. Er hat sich überhaupt keine Illusionen mehr gemacht. Diese politische Wende hat ihn irgendwie erleichtert. Dafür hab ich ihn bewundert, dass er so ruhig und gefasst war. Ja er hat seine Gefühle nicht gezeigt, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten.
Mein Mann ist seit 1990, um mal mit Tucholsky zu reden, ein „aufgehörter Schriftsteller“ gewesen. Da ist nichts mehr gekommen, nur noch ein Buch, sozusagen die Fortsetzung des Waisenknaben, das ist auch nicht mehr in seinem alten Verlag erschienen, sondern im Nora Verlag. Da hat mein Mann für das Buch bezahlt, weil das fertige Manuskript da lag, und er es um jeden Preis herausbringen wollte. Und ich hab auch gesagt: „Na gut in Gottes Namen, tun wir das.“ Aber leider ist es so, dass Nora sich in keiner Weise um ein Buch bemüht, keine Werbung, kein Vertrieb im üblichen Sinne, die drucken das Buch stellen es ins Regal und warten darauf, dass irgendeiner es bestellt.
Eine Zeit lang waren diese Bezahlverlage nach der Wende mächtig aktiv. Mein Mann hat laufend von diesen sogenannten Verlagen Angebote bekommen, aber irgendwie hatte er sich für Nora entschieden, das war auch nicht so teuer. Ich entsinne mich nicht mehr an eine genaue Summe. Aber das Ganze war ein tot geborenes Kind.
R.S.: Hat er nach der Wende überhaupt noch geschrieben.
H.G.: Er hatte noch unter dem Eindruck der Ereignisse ein Manuskript fertiggestellt, aber nur ein Rohmanuskript mit dem Titel. „Endlich Bananen“. In dem versucht er, sich direkt mit diesem Ereignis auseinanderzusetzen. Er hat das Manuskript seinem alten Verlag, der ja noch existierte, angeboten, aber die hatten überhaupt kein Interesse. Er hat auch nicht versucht, bei einem Westverlag unterzukommen, denn er war körperlich zu geschwächt und müde, und er hatte auch keine Lust mehr weiter daran zu arbeiten. Das Manuskript liegt in der Akademie, ist aber nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
Er hat dann noch versucht, weil er ja nicht mehr schreiben konnte, auf seiner geliebte Erika zu tippen…
R.S.: … das war die Schreibmaschine aus DDR Produktion.
H.G.: Ja, aber sie werden lachen. Die gibt es schon viel länger, denn ich habe diese Maschine in die Ehe mitgebracht. Die gehörte meinem Vater. Die Erika war schon vor dem Krieg ein ganz bekanntes Modell.
Mein Mann sagte immer das ist meine Geliebte, er brauchte auch dieses vertraute Geräusch. Zwar hatte er auch andere Maschinen, aber die waren alle nicht so wie Erika.
Aber am Ende war es so, dass er auf der nicht mehr schreiben konnte. Dann hat er -er schrieb noch diese alte Sütterlinschrift- auf Zetteln versucht, Aphorismen zu schreiben, Gedanken die ihm kamen. Er hat auch mal versucht zu diktieren, und ich habe es dann in die Maschine übertragen, aber das ist alles nichts geworden. Leider gilt das auch für seinen dritten biografischen Band des Waisenknaben, der sicherlich der interessanteste geworden wäre, denn der hätte die Zeit nach dem Krieg beinhaltet. Er hatte sich vorgenommen schonungslos zu schreiben und hat angefangen zu diktieren; aber er hat dann oft den Faden verloren, hat sich oft wiederholt, es ging nicht mehr.
Es hört sich nicht gut an für eine Schriftstellerwitwe, die ihren Mann eigentlich loben müsste. Aber ich bin eben kritisch, und habe immer seinen Arbeiten kritisch gegenüber gestanden. Das war nichts mehr. Deshalb habe ich durch einen Vermerk an diesem Manuskript die Veröffentlichung für die nächsten fünfzig Jahre untersagt; falls da jemand mal etwas herausbringen wollte …
Frau Greulich zeigt einen Ausschnitt aus der Zeitung „Freie Welt“.
Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Hier ist mein Mann bei einer Diskussion, im Schriftstellerverband. Typisch für ihn wie er den Mund aufreißt. Ich zitiere:
„Rudi Greulich, Schriftsteller: Sie sagen wir Schriftsteller müssen für unser Problem brennen, aber seien sie sicher, die Verlagslektoren haben schon das Wasser zum Löschen bereit…“
E.R. Greulich 1956.“
Veröffentlichungen (Auswahl)
1948 Der hässliche Engel, Erzählung
1949 Zum Heldentod begnadigt. Tatsachenbericht aus der Strafdivision 999
1951 Das geheime Tagebuch.
1953 Robinson spielt König.
1957 Die Pyrenäen, die Señoritas und die Eselchen.
1961 Keiner wird als Held geboren. Roman über Anton Saefkow.
1962 Der durchlöcherte Himmel
1964 ... und nicht auf den Knien. Roman über Artur Becker.
1965 Amerikanische Odyssee. Roman.
1968 Mit Mut und List.
1969 Tamtam um die Geisterburg.
1970 Manuela, Erzählung
1971 Der anonyme Brief. Roman über eine Episode aus dem Leben Karl Liebknechts.
1972 Die deftige Jungfrau und 99 andere Anekdoten.
1974 Sprung über den Schatten.
1975 Wintergefecht.
1976 Der Ochs im Dom.
1979 Die Verbannten von Neukaledonien. Abenteuerroman aus der Zeit der Pariser Commune
1984 Hinter vorgehaltener Hand.
1987 Des Kaisers Waisenknabe. Ein autobiografischer Roman.
1989 Ammenmärchen und Hetärenträume.
2002 Des Waisenknaben Sturm und Drang. Fortsetzung des autobiografischen Romans.