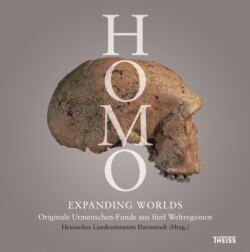Читать книгу Homo – Expanding Worlds - Ralf Schmitz - Страница 9
ОглавлениеGert Scobel
Vorwort
Rassismus ist eine seltsam starre, leider aber weit verbreitete Sicht auf »andere«, fremde Menschen. Erstaunlich ist am Phänomen des Rassismus weniger die Vehemenz, mit der Rassisten ihre Scheinargumente seit Jahrhunderten vortragen, sondern vor allem der Erfolg ihrer auf willkürlichen Grenzziehungen beruhenden Pseudotheorien. Wenn es nicht schon genügend Gegenargumente aus ethischer, juristischer, sozialer oder kultureller Sicht geben würde – allein die genetische und die neuere paläoanthropologische Forschung bietet die Grundlage für eine zwingende Widerlegung jeglicher Formen von Rassismus. Wir Menschen – und das bedeutet: alle Menschen, die je auf diesem Planeten gelebt haben, heute leben und leben werden – sind miteinander enger verwandt als es sämtliche sichtbaren Unterschiede wie Hautfarbe nahezulegen scheinen. Wir alle haben gemeinsame Vorfahren. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die genetischen Übereinstimmungen zwischen einem Europäer und einem Einwohner Kenias allen optischen Unterschieden zum Trotz größer sein können als die zwischen diesem Europäer (oder Kenianer) und seinem unmittelbaren Nachbarn. Diese enge Verwandtschaft aller ist keine Metapher, sondern Realität.1
Trotz der intensiven vergleichenden Genomanalysen von heute lebenden Individuen verschiedener Regionen und Nationalitäten miteinander, aber auch mit unterschiedlichen Affenarten und mit den Genomen unserer Vorfahren, die aus Knochenfunden gewonnen wurden, gibt es nach wie vor eine Reihe von Unklarheiten und offenen Fragen. Die Neandertaler sind dabei nur ein Aspekt von vielen.2 Trotz vieler Fortschritte insbesondere durch neue, wichtige Knochenfunde der letzten Jahrzehnte stehen wir mit Blick auf die lange »Genom-Reise« in unsere evolutionäre Vergangenheit am Anfang.3 Es wird noch lange dauern, bis eine umfassende genetische Klärung und Rekonstruktion all der Wanderungen »Out of Africa« vorliegt und eine Zeitkarte der vielen Expansionsbewegungen zwischen Europa und Asien – falls es je gelingt, all die Daten zu ordnen. Wenn sich das Puzzle unserer Herkunft mehr und mehr zu einem klaren Bild verdichtet, dann ist dieses völlig anders als erwartet. Statt fester Konturen gibt es vielfältige Übergänge unserer »modernen« Art und unserer Vorfahren – und dies in einem dreifachen Sinn. Zum einen zählen zu unseren Vorfahren diejenigen Mitbewohner auf dem Gen-Ast, die wir etwas herablassend als Tiere bezeichnen und Affen nennen. Biologisch sieht es heute so aus, dass wir mit Blick auf die tierischen Vorfahren in unserem Genom wenig Berechtigung haben, uns Homo statt Pan (d.h. Schimpansen-) sapiens zu nennen. Vorfahren sind aber zweitens auch eine Reihe von Wesen, deren tatsächliche Nähe wir mit lateinischen Begriffen wie Homo, Australopithecus, Homo rudolfensis, ergaster, erectus oder Homo floresiensis kaschieren. Selbst mit Blick auf die vergleichsweise menschlicher erscheinenden Vorfahren wie die Neandertaler, mit denen wir noch vor nicht allzu langer Zeit zusammenlebten und uns paarten, fremdeln wir. Drittens aber erscheinen unsere Vorfahren nicht nur in prototypischen, klaren Gestalten, die sich wie Vorzeigeexemplare an berühmten Schädeln und Skelettteilen festmachen lassen, sondern weisen tatsächlich sehr unterschiedliche regionale Formen auf. Die Funde der letzten Jahre zeigen, wie fließend die Übergänge zwischen den »Prototypen« sind. So ähnlich wie die meisten von uns weder wie George Clooney noch wie Angelina Jolie aussehen, so wenig entsprechen die Vorfahren, deren Überreste wir finden, den Idealtypen, die wir uns für sie ausgedacht haben.
Verwirrend sind also nicht nur die genetischen Übergänge zu den Menschenaffen, sondern auch die vielfältigen Verwandtschaftslinien zu unseren Vorgängern. Gerade die Knochenfunde der letzten Jahre sind überraschend vielfältig und haben den Paläoanthropologen gezeigt, dass klare Stammbäume in weite Ferne gerückt sind.4 Unsere Entwicklung verweist vielmehr auf eine ausgeprägte Patchwork-Vergangenheit. Vereinfacht gesagt beinhaltet die Recent African Origin (RAO)-These, dass moderne Menschen einerseits Auswanderer aus Afrika sind, die vor etwa 100.000 Jahren die (ebenfalls ursprünglich afrikanischen) Einwohner Eurasiens verdrängt haben. Andererseits zeigt sich, dass es vielfältige Assimilationsformen gibt – ein »interbreeding« von lokalen und eingewanderten Menschen.5 Wir neigen dazu, die Vielfalt und Komplexität unserer Welt, den Pluralismus der Lebensformen und die Überlappung unterschiedlichster Ethnien dem Prozess der Globalisierung und damit der Moderne zuzuschreiben. Tatsächlich ist jedoch unsere ferne Vergangenheit weitaus pluralistischer als wir je dachten. Das zeigen insbesondere die Schädel- und Knochenfunde, die die wissenschaftliche Sicht vom Stammbaum der Hominiden einschließlich von uns durch ein Patchwork – oder um im Bild zu bleiben einem Stammbusch – ersetzt haben. Wir alle kommen aus Afrika – und unsere Evolution ähnelt einem Mosaik, keinem Baum. Und doch bleibt es trotz aller Übereinstimmungen seltsam, unsere Vorfahren und entfernten Verwandten wirklich zu sehen.
Genau dieses Sehen ermöglicht die einzigartige Ausstellung in Darmstadt, die die Vielfalt unserer Vorfahren und damit unserer Vergangenheit vor Augen führt – und zwar mit den Originalfunden. Diese Originale haben »Aura«. Im Griechischen bedeutet dieses Wort so viel wie Luft oder Hauch. In der Mythologie ist Aura die Göttin der Morgenbrise – ein gutes Bild für die beginnende Dämmerung des Bewusstseins und des modernen Menschen. Die Funde wie die berühmte Lucy führten in der Vergangenheit zu einer Reihe von teils heftigen Kontroversen – und dazu, das bisherige Bild von uns immer weiter zu korrigieren. In der Ausstellung wird für den Besucher nachvollziehbar, dass weder die frühere eurozentrische noch die heutige »Out of Africa«-Perspektive der Bedeutung der vielfältigen regionalen Entwicklungen gerecht wird. Nach wie vor sind unsere Sichtweisen von Weltbildern geprägt, die zunächst religiös waren, dann weltanschaulich und heute zunehmend von wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert werden. Am Ende aber spiegelt unser heutiger Wissensstand nicht nur zugleich auch den Grad des bisherigen Unwissens wider, sondern auch zu einem guten Teil das, was wir sehen wollen.
Die Ausstellung in Darmstadt lehrt genau hinzusehen, auch wenn heute Genanalyse die Gestaltbetrachtung und molekulare Untersuchungen die Morphologie abgelöst zu haben scheinen. Noch 1784, mehr als 20 Jahre bevor Charles Darwin geboren wurde, konnte ein begabter Zeichner wie Johann Wolfgang Goethe allein durch genaues Hinsehen zu der ebenso erstaunlichen wie richtigen Einsicht kommen, dass »der Zwischenknochen der oberen Kinnlade dem Menschen mit den übrigen Tieren gemein sei«. Zählt die Beobachtung mit dem bloßen Auge heute, im Zeitalter der Genanalyse, überhaupt noch?
Der Paläoanthropologe Erik Trinkaus von der Washington University in St. Louis hat über mehr als ein Jahrzehnt hinweg seine Erfahrungen mit dieser Spannung gemacht. Nachdem er einen etwa 40.000 Jahre alten Unterkiefer, den Höhlenforscher 2002 in Rumänien gefunden hatten, genau betrachtet und untersucht hatte, kam Trinkaus zu dem Ergebnis, dass dieser Knochen zu grob und groß für einen »modernen« Menschen sei. Er hielt ihn deshalb für eine Mischung aus Neandertaler und Homo sapiens – eine These, die ihn zum Gespött vieler anderer Wissenschaftler machte und seitdem Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften im Wege stand. Die Peers lehnten ihn ab. Das änderte sich erst im Mai dieses Jahres bei einer Konferenz von Genetikern und Biologen in New York. Die Fachzeitschrift Nature musste im Internet einräumen, dass sie sich wohl geirrt habe.6 Qiaomei Fu, ein Paläogenetiker der Harvard Medical School in Boston, hatte den Unterkiefer sequenziert und das Genom rekonstruiert. Das überraschende Ergebnis: Der Knochen stellt eine klare und eindeutige Mischung aus Genanteilen eines männlichen Homo sapiens und bis zu 11 % eines Neandertalers dar. Trinkaus, der genau beobachtet hatte, lag also die ganze Zeit über richtig.
Es lohnt sich also nach wie vor, genau hinzusehen. Auch ohne große paläoanthropologische Vorkenntnisse bietet die Darmstädter Ausstellung nicht nur die Möglichkeit zur eigenen Betrachtung, sondern auch zu einer großartigen Erfahrung. Den Originalen zu begegnen, die sonst nie zusammen gezeigt werden, ist etwas Einmaliges. Im Zeitalter der digitalen Daten ist der Begriff des Originals zunehmend verblasst. Die Kopie eines digitalen Bildes enthält dieselben Daten wie die des ursprünglichen Bildes: Beide sind voneinander nicht zu unterscheiden. Doch in Darmstadt ist das, was Aura bedeutet, wieder erfahrbar. Man kann mit eigenen Augen sehen, wie nahe und wie fern wir uns Menschen wirklich sind – gestern wie heute.
Anmerkungen
1 Stellvertretend Jun Z. Li et al., Worldwide Human Relationships Inferred from Genome-Wide Patterns of Variation, in: Science 319, 1100 (2008); Mattias Jakobsson et al., Genotype, haplotype and copy-number variation in worldwide human populations, in: Nature 451, 998 (2008).
2 Janet Kelso, Svante Pääbo et al., The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains, in: Nature 505, 43 (2014) und Svante Pääbo et al., Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia, in: Nature 514, 445 (2014).
3 Eugene E. Harris, Anchestors in our Genome. The new Science of Human Evolution, Oxford 2015. Harris bietet die derzeit vermutlich kompakteste und umfassendste Geschichte der Evolution aus genetisch-paläoanthropologischer Sicht.
4 Erin N. DiMaggio et al., Late Pliocene fossiliferous sedimentary record and the environmental context of early Homo from Afar, Ethiopia, in: Science 347, 1355 (2015); Brian Villmoare et al., Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia, in: Science 347, 1352 (2015); Nicholas J. Conard and Michael Bolus, Chronicling modern human’s arrival in Europe, in: Science 348, 754 (2015); Ewen Callaway, Neanderthals gain human neighbour. Cranium discovery shows that Homo sapiens was living in Middle East 55,000 years ago, in: Nature 517, 541 (2015); Sriram Sankararaman, Swapan Mallick, Michael Dannemann, Kay Prüfer, Janet Kelso, Svante Pääbo, Nick Patterson, David Reich, The genomic landscape of Neanderthal ancestry in present-day humans, in: Nature 507, 354 (2014).
5 Chris Stringer, Lone Survivors: How We Came to Be the Only Humans on Earth, New York 2012.
6 Ewen Callaway, Early European may have had Neanderthal great-great-grandparent Genome of 40,000-year-old jaw from Romania suggests humans interbred with Neanderthals in Europe, Nature News (13. Mai 2015), doi:10.1038/nature.2015.17534.