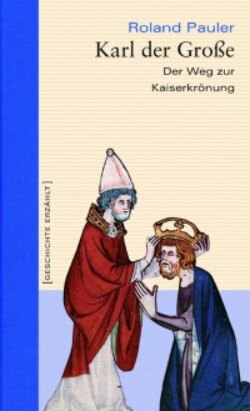Читать книгу Karl der Große - Roland Pauler - Страница 8
Das römische Kaisertum: Alleinherrschaft auf republikanischer Basis
ОглавлениеDie alten Römer hätten Karl trotz all seiner Macht in der Zeit der Herausbildung des Kaisertums nie und nimmer freiwillig zum Kaiser erhoben, denn Königsherrschaft war ihnen verhasst. In Krisenzeiten übertrugen sie die Herrschaft (imperium) zwar einem Alleinherrscher (dictator), damit der drängende Probleme zielstrebig und ohne langwierige Diskussionen löste, doch war diese herausragende Position bis in das Zeitalter Caesars zeitlich begrenzt. Karls Kaiserkrönung vereinte also zwei grundsätzlich unterschiedliche Traditionen. Indem er zwar den Kaisertitel annahm, aber seine Königstitel beibehielt, stellte er sich ganz bewusst in beide Traditionen.
Caesar und Augustus, Begründer des römischen Kaisertums
Gaius Julius Caesar beendete eine Zeit der Bürgerkriege, die immer wieder zur Alleinherrschaft immer mächtigerer Diktatoren geführt hatten, man denke nur an Marius und Sulla. Caesar und sein Nachfolger Augustus, der erste Kaiser, dürften keinen Gedanken daran verschwendet haben, ihre Alleinherrschaft über das römische Riesenreich unter dem Königstitel auszuüben. Beide wahrten als Alleinherrscher die republikanische Herrschaftsform zumindest pro forma, wenngleich ohne sie keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden konnten. Diesen Maßgaben folgten selbst Tyrannen wie Nero oder Domitian, die beide als blutrünstige Christenverfolger in die Geschichte eingegangen sind, Nero sogar als Paradebeispiel für einen entarteten Herrscher. Ein für das Königtum übliches dynastisches Nachfolgeprinzip bildete das römische Kaisertum nicht aus, wenngleich bisweilen ein Sohn oder Verwandter auf dem Kaiserthron nachfolgte.
Gaius Julius Caesar war vom römischen Senat zum Diktator auf Lebenszeit ernannt worden. Sein Adoptivsohn Octavianus/Augustus wurde nach seinen Siegen über die Cäsarmörder und Antonius Alleinherrscher. Er wollte wie vor ihm die Diktatoren Sulla, Pompeius und Caesar erster Bürger des Staates genannt werden, weshalb die sich unter ihm verfestigende Staatsform in der Forschung als Prinzipat (princeps = erster) bezeichnet wird. Seine Vorstellungen von der Machtfülle eines princeps definierte Augustus nicht, sondern übernahm diverse, im republikanischen Staatswesen verankerte Titel samt deren Machtfülle: Konsul, Volkstribun, Imperator und pontifex maximus, oberster „Brückenbauer“ zu den Göttern – diesen Titel legten sich seit dem 14. Jahrhundert vereinzelt Päpste zu, ohne dass er offizieller Papsttitel geworden wäre. Octavians neuartige Macht bestand aus der Summe der ihm verliehenen Einzelkompetenzen, von denen jede für sich dem herkömmlichen Verfassungsrecht entsprach. Zwar bestanden die republikanischen Einrichtungen, z. B. der Senat, die Konsuln, Komitien (Volksversammlungen) und sonstigen Ämter weiter, verloren aber zunehmend an Bedeutung gegenüber neuen Institutionen, die Augustus nach und nach ins Leben rief.
Der Kaisertitel
Der Titel Kaiser geht auf Caesar, gesprochen Kaisar, zurück. Caesars Neffe und Adoptivsohn Octavian erhielt den Beinamen Augustus (der Verehrte), der ebenso zum Titel aller späteren Kaiser gehören sollte wie der des Imperators (des obersten Heerführers), den Octavian neben anderen republikanischen Titeln beibehalten hatte. So lautete z. B. der Titel des Nerva (96 – 98) Imperator Nerva Caesar Augustus. Die mittelalterlichen Kaiser beschränkten ihren Titel auf Imperator und Augustus.
Machtvolle Herrschaft durch effiziente Verwaltung
Augustus schuf die Verwaltungsordnung, die mit diversen Anpassungen an die Gegebenheiten und Bedürfnisse für die gesamte antike Kaiserzeit grundlegend wurde, bot dadurch der Staatskorruption Einhalt, begründete stabile Rechtsverhältnisse und betrieb eine effektive Sozialpolitik zugunsten der besitzlosen Massen. Diese höchst effiziente Verwaltung ließ die kaiserliche Macht auch Zeiten überdauern, in denen die Herrschaft in den Händen unfähiger Trunkenbolde lag. Aus dem Senatorenstand wurden der für Ruhe und Ordnung zuständige Stadtpräfekt, die Legaten (,Botschafter‘) und Verwalter (curatores) genommen, aus dem Ritterstand die übrigen Präfekten und Prokuratoren. Die unteren Dienstgrade wurden vielfach mit Freigelassenen besetzt. Die Beamten erhielten im Gegensatz zu den Amtsinhabern der republikanischen Zeit eine nach Rangordnung gestaffelte Besoldung.
Unter Augustus’ Nachfolgern wurde die Tendenz der Lösung von den republikanischen Wurzeln deutlicher erkennbar. Die führenden republikanischen Organe, der Senat und die Konsuln, büßten ihre Eigenständigkeit zugunsten des Kaisers und seiner Beamten weitgehend ein.
Die Kaiser als Quelle und Wahrer des römischen Rechts
Die Kaiser, wiewohl in unseren Augen bisweilen mörderische Verbrecher, waren Quelle des im gesamten Reich geltenden römischen Rechts. Dieses erlebte vor allem unter dem oströmischen Kaiser Justinian (527–565) eine ungeahnte Blüte; er stellte eine systematische Sammlung sämtlicher kaiserlicher Gesetze zusammen und ergänzte sie durch eigene Edikte. Der Codex Justinianus sollte Jahrhunderte überdauern und zur Grundlage des modernen Rechts werden. Das überlegene, staatstragende römische Recht strahlte aus auf die durch Föderatenverträge an das Reich gebundenen germanischen Stämme, deren Könige die Volksrechte in Latein niederschreiben ließen. Gesetzgebung und Rechtsprechung gehörten zu den vornehmsten Aufgaben der römischen Kaiser, die sich als über dem Gesetz stehend betrachteten. Sie hatten in ihrer Funktion als Gesetzgeber Anteil an der Sphäre des Göttlichen. Trotz dieser ideellen Überhöhung begann bereits nach Augustus’ Tod der Niedergang des Weltreiches, was einerseits an dessen zum Teil unfähigen Nachfolgern lag, andererseits an der Bedrohung der Grenzen durch Perser und Germanen.
Der Kaiserkult
Der Kaiserkult entwickelte sich aus der Gewohnheit, bedeutende Verstorbene als Heroen zu verehren. Caesar, stolz von Venus abzustammen, wurde zum Gott erhoben, Augustus errichtete man einen Tempel und schuf zu seinem Kult ein Priesterkollegium, die Augustales. Aurelianus (270 –275) nannte sich bereits zu Lebzeiten Gott und Verkörperung der Sonne, während Diokletian (285 –305) Verehrung als Jupiter auf Erden forderte. Die christlichen Kaiser umgab nur noch eine Aura von Heiligkeit.
Krisenzeiten spalten das Reich
Im 3. Jahrhundert erlebte das Römische Reich einen Höhepunkt der Krise. Zwischen 235 und 285 regierten 22 Kaiser, ausgerufen vom Heer (Soldatenkaiser) und bisweilen nur wenige Monate Herren über einen begrenzten Raum, bekämpft von mindestens einem Gegenkaiser. Rom verlor mehr und mehr seine zentrale Stellung im Reich, denn die Kaiser bevorzugten Residenzen im bedrohten Grenzgebiet, wo ihre treuen Truppen lagen.
Eine grundsätzliche Veränderung brachte Diokletian im Jahr 293 auf den Weg, indem er, um die chaotischen Verhältnisse zu überwinden, die Tetrarchie (Vierherrschaft) einführte.
Das Reich sollte fortan unter der Oberhoheit Diokletians von zwei Augusti (Diokletian in Nikomedia und Maximinianus in Mailand) sowie zwei diesen untergeordneten Cäsaren (Galerius in Sirmium und Constantius in Trier) regiert werden. Auf diese Weise suchte Diokletian, die Probleme in Verwaltung und Rechtsprechung zu lösen, die einen einzigen Kaiser und dessen Zentralverwaltung überforderten. Zwar überlebte das System nicht einmal seinen Urheber, der sich im Jahr 305 zur Ruhe setzte und damit anarchische Zustände heraufbeschwor, doch hatte er die Trennung des Reiches in eine östliche und eine westliche Hälfte verfestigt.
Diokletian hat die Grundlage für die Politik Kaiser Konstantins geschaffen, der seine Residenz in die Kleinstadt Byzanz am Bosporus verlegte, die von ihm und seinen Nachfolgern mit jeglicher repräsentativer Pracht zur Metropole des Byzantinischen Reiches, Konstantinopel, ausgebaut wurde. Seit Konstantin war das Kaisertum mit der Kirche verbunden, die zu einer „staatstragenden“ Macht des Mittelalters werden sollte.
Das Ende der Christenverfolgung
Konstantin leitete durch seine Hinwendung zum Christentum und die Förderung der Kirche eine neue Ära ein, was ihm den Beinamen „der Große“ einbrachte. Von einer ganzen Reihe von Historikern wurde diese Veränderung für derart epochal angesehen, dass sie mit dem Toleranzedikt von Mailand (313) das Mittelalter beginnen ließen.
Noch gehörte das Römische Reich nicht nur ideell, sondern auch politisch zusammen. Konstantin hatte in seiner Nachfolgeregelung das Reich unter seine drei Söhne aufgeteilt. Ein Blutbad in der kaiserlichen Familie überlebten nur seine Söhne Constans, der fortan den Westen, und Constantius II., der den Osten regierte (seit 340). Der Westen war bereits zu dieser Zeit der instabilere Reichsteil: Constans fiel 350 dem Usurpator Magnus Magnentius, einem Franken, zum Opfer, der im Westreich regierte, bis er 353 von Constantius II. mit germanischen Hilfstruppen überwunden wurde. Letztlich verfestigte sich die Spaltung des Römischen Reiches, der Tod des Theodosius (395) markierte das Ende der Reichseinheit, spätere militärische Einigungsversuche brachten nur kurzfristige Erfolge, scheiterten aber letztlich. Rom, wiewohl noch ideelle und namengebende Hauptstadt dieses Reiches, verlor immer mehr an politischer Bedeutung gegenüber Residenzen wie Mailand, Ravenna, Lyon oder Paris. Der Herrschaft des Westreichs bemächtigten sich Usurpatoren, bis es schließlich die germanischen Stämme besetzten und jegliche Zentralgewalt beendeten.