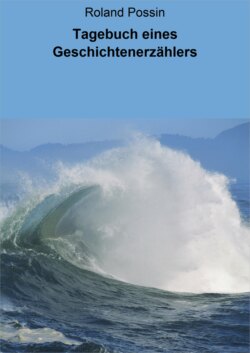Читать книгу Tagebuch eines Geschichtenerzählers - Roland Possin - Страница 3
1.
ОглавлениеIch heiße Ben. In mir fließt indianisches Blut und ich lebe in Deutschland, doch das ist nicht das Problem.
Angefangen hat alles damals, am Grab meiner Mutter …
April 1999
Ich vergoss keine Träne an ihrem Sarg. Das Einzige was ich in mir spürte war Einsamkeit und Leere, meine treuen Begleiter über all die Jahre. Jetzt, wo sie ein paar Fußbreit unter der Erde lag, schaute sie mich von dort noch immer mit verkniffenen Augen an. Sie peinigte mich aus ihrer fernen Welt. „Du hast mich im Stich gelassen!“ echote es mir aus ihrem Grab entgegen. Dieser Satz steckte tief in mir, mit zahlreichen Widerhaken versehen, ganz fest verankert. Keine Macht auf Erden wird mich je von diesem Pfeil befreien. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich ihn in mir tragen und mich von der Wunde peinigen lassen müssen! Wahrscheinlich sogar darüber hinaus, für immer.
All das was meine Mutter für mich verkörperte, Kälte, Strenge, Reichtum, Luxus, Macht, Gier, all das war mit ihr gegangen und lebte doch weiter, in meinen Erinnerungen. Ich schämte mich für sie und verachtete sie. Das Schlimme aber war, dass ich mich selbst dafür hasste, dass ich sie hasste.
Während der Trauerzug sich wie ein Lindwurm langsam den Weg von der Kapelle hin zu ihrer neuen und letzten Station dahin wand, nahm ich einen am Wegesrand liegenden Tannenzapfen auf. Ich schnupperte daran. Er roch nach Kälte, nach Trauer, nach Nichtverstandensein. Er roch nach Kindheit. Nicht nach irgendeiner, sondern nach meiner verdammten, verlorenen Kindheit. Ich musste an diesem kalten Aprilmorgen daran denken, wie oft mich Mutter ermahnt hatte, mich nicht schmutzig zu machen. Aus mir solle ein anständiger, sauberer Junge werden. Sie impfte mir von klein auf ein, dass ich gerade wegen meiner Hautfarbe disziplinierter und ordentlicher sein müsste, als die Anderen.
Der Tannenzapfen führte mich in meine Vergangenheit zurück. 1975. Ich war gerade mal ein fünfjähriger Junge, als ich für ein paar Stunden mein Zuhause verlassen hatte. Ich spielte zum ersten Mal überhaupt ohne Aufsicht draußen, ich war frei. Das war so ein unbeschreiblich tolles Gefühl, wie ich es vorher noch nie erlebt hatte, frei! Ich bin raus in den nahe gelegenen Wald gelaufen. Es war ein verregneter Tag und goss wie aus Kübeln, doch das machte mir nichts aus. Ich habe mich auf dem Boden herumgewälzt und mich dreckig gemacht, so richtig heftig. Als Erinnerung an dieses für mich einmalige Erlebnis nahm ich mir damals einen Tannenzapfen mit nach Hause. Es war schon dunkel, als ich heimkam, von oben bis unten mit Schlamm bedeckt. Ich erwartete, dass mich Mutter schlug oder mir zumindest eine Strafpredigt hielt, für mein Versagen. Doch sie empfing mich einzig und allein mit düsterem Schweigen. Solch ein Schweigen war für mich schlimmer als die größte Tracht Prügel. Sie schaute mich durchdringend an und sagte nur: „Geh dich waschen!“ Mehr nicht. Nur diese drei verfluchten Worte. „Geh dich waschen!“ Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich allein und verlassen fühlte. Ich hätte in diesem Augenblick so sehr einen Menschen gebraucht, der mich einfach nur in die Arme genommen und getröstet hätte, aber den gab es nicht. Es hat ihn bis heute nicht gegeben.
Es waren seelische Schmerzen, die sie mir zugefügt hat, in den Jahren meiner Kindheit. Und jetzt ist sie einfach weg, mir nichts dir nichts auf und davon, ohne dass ich noch irgendetwas zu ihr sagen kann. Sie lässt mich allein zurück, mit meiner verlorenen Kindheit.
Die Nachricht von ihrem Tod bekam ich vorige Woche in Jerusalem. Ich konnte es kaum glauben, dass diese Frau nicht mehr lebte. Und jetzt sitze ich in diesem großen, kalten Haus. Ich bin ein Fremder, hier in diesem Land, in dieser Stadt, in diesem Haus, in mir. Eine Frage hallt permanent wie ein Echo in mir. Wo gehöre ich hin? Acht Jahre reiste ich in der Welt umher. Ich war ein Suchender. Was habe ich eigentlich gesucht? Ich weiß es nicht, Gott nochmal, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, was ich gefunden habe: Nichts, rein gar nichts! Es ist komisch, obwohl ich viele Menschen kennengelernt und viele Freundschaften geschlossen habe, war niemand dabei, dem ich zugetraut hatte, mich auch nur annähernd zu verstehen. Niemand! Ich wünsche mir so sehr, dass es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der bis in die tiefsten Schluchten meiner Seele hinab erkennt, wer ich wirklich bin. Ohne zu urteilen, ohne zu belehren, ohne Ratschläge zu geben, der mich einfach nur versteht. In meinem Inneren lebt eine Trauer die schier nicht zu ertragen ist. Sie raubt mir die Fähigkeit zu lachen, zu weinen, glücklich zu sein. Manchmal spüre ich sie auf meiner Zunge, die Trauer. Das schmeckt dann salzig und bitter, nach jahrelang in einem Holzfass abgestandenen Meerwasser. Meine Trauer wohnt in einem großen, dunklen, mit schweren Metalltüren abgesicherten Haus, aus dem es kein Entrinnen gibt. Dieses Haus hat einen Namen. Es heißt Einsamkeit. Es fühlt sich kalt, feucht und stickig da drinnen an. Tag für Tag breitet es sich in mir immer mehr aus, wird größer und größer. In dem Haus leben die Dämonen. Sie haben sich in kleinen Nischen versteckt und lauern nur darauf, auf mich zu springen und mich zu töten. Und ich bin unfähig, mich gegen sie zu wehren.
Ich sitze gerade im Wohnzimmer meiner Mutter und schreibe diese Zeilen. Obwohl das Feuer im Kamin brennt ist es kalt hier. Es ist eine Kälte, die man mit einem Thermometer nicht messen kann. Diese Kälte hat mir meine Mutter zum Abschied hinterlassen. Sie ist ihr Vermächtnis an mich. Ich werde die Nacht draußen mit dem Schlafsack im Garten verbringen. Nicht hier, nicht hier in dieser Gruft mit Namen Dunkle Vergangenheit.
Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl nach all den Jahren wieder in Lübeck, im Haus meiner Kindheit zu sein. So lange war ich unterwegs, habe mich irgendwo in der Welt herumgetrieben. Ich habe gesucht, gehofft, gefleht, mich endlich von dieser Last der Einsamkeit und der Gefangenschaft zu befreien. Doch ich konnte die schweren Metalltüren, die das Haus sicherten, nicht sprengen. Nicht einmal einen Millimeter haben sie sich bewegt. Es gab Augenblicke, in denen ich dachte, ich hätte es geschafft. Meistens war das in der Gegenwart von Menschen, von denen ich meinte, dass sie mir meine Einsamkeit nehmen könnten. Aber es war nur eine gewünschte Projektion. Es war nicht ein Einziger dabei, der mir ein Gefühl von Zweisamkeit vermitteln konnte und mich wirklich verstand. Ich habe irgendwann aufgehört, es anderen zu erklären. Ich habe aufgegeben und mich damit abgefunden, allein zu sein.
Als ich heute Morgen den Tannenzapfen in Händen hielt und daran schnupperte, kamen die Schmerzen, die ich all die Jahre tief in mir vergraben hatte, wieder zum Vorschein und versuchten mich zu töten. Es war ein kurzer Kampf. Ich hatte nicht die Spur einer Chance gegen diese übermächtige Kraft. Genau in diesem kurzem Augenblick, als ich den unendlichen Schmerz der Todessehnsucht in mir spürte, hatte ich dieses Bild vor Augen. Das Bild eines Menschen, eigentlich nur seine Konturen. Ich erkannte, meinen Tod von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehend, dass es dich gibt, irgendwo auf der Welt. Dich, dem ich alles erzählen kann, Du, der du mich verstehst, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Es war ein unbeschreibliches Gefühl der Geborgenheit, wie ich es noch nie in meinem Leben gefühlt hatte. Rötlich schimmernde Wärme breitete sich von meiner Körpermitte aus und verteilte sich leicht wie ein Windhauch vom Kopf bis hinunter zu den Fußspitzen. Für den Bruchteil einer Sekunde, kurz nachdem ich dich gesehen hatte, spürte ich Frieden und Ruhe in mir. Das große dunkle Haus war verschwunden. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ganz kurz nur, dann war dieses Bild und auch der innere Frieden schon wieder weg. Aber es war keine Einbildung, da bin ich mir sicher, es war keine Einbildung! Jetzt bin ich wieder zurück im Hafen des normalen Lebens angekommen und spüre diese unendliche Leere und Trauer in mir. Doch ich kann diesen kurzen Augenblick nicht vergessen. Es gibt dich wirklich, irgendwo da draußen. Es ist diese Sehnsucht, die mir rät, dir alles anzuvertrauen. Es ist schon merkwürdig, mit einem Mal sentimental zu werden und damit anzufangen irgendeinem Menschen, der vielleicht nur in meiner Phantasie existiert alles zu erzählen. Ich riskiere es einfach!
Damit du mich ein bisschen kennenlernst erzähle ich dir, was bisher in meinem Leben geschah.
Ich bin vor neunundzwanzig Jahren in Lübeck auf die Welt gekommen, unerwünscht. In mir fließt indianisches Blut. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er ist Lakota-Indianer und war als Soldat in Deutschland stationiert, als Mutter ihn 1970 traf. Sie hatte, was selten vorkam, Lübeck verlassen und eine Geschäftspartnerin in Heidelberg besucht. Diese lud sie ein, zu einem Tag der offenen Tür in einer US-Kaserne zu gehen, da ihr Mann dort beruflich zu tun hatte. Die Geschichte der Beziehung meiner Eltern ist sehr kurz. Es gab nur eine gemeinsame Nacht in einem Hotel, in der ich gezeugt wurde. Mein Vater wurde kurze Zeit später nach Vietnam abberufen. Er ließ seinen One-Night-Stand geschwängert zurück. Mutter erzählte mir, dass sie nach ein paar Jahren einen Brief von ihm bekommen hatte, worin stand, dass er zurück in die USA, ins Reservat gegangen war. Das war es dann auch schon. Mein Vater hat nie erfahren, dass er einen Sohn in Deutschland gezeugt hat. Ich blieb das einzige Kind meiner Mutter. Sie ist nie eine feste Beziehung eingegangen, das hätte wohl auch kein Mann ausgehalten. Aufgewachsen bin ich gut situiert in einer großen Villa. Meine Mutter war Geschäftsfrau. Sie führte ein großes Keramik-Unternehmen, dass sie von ihren Eltern geerbt hatte. Da sie als alleinige Geschäftsinhaberin mit viel wichtigeren Dingen beschäftigt war, als sich um ihren Sohn zu kümmern, hat sie die Erziehung an eine Frau übergeben, die mit in unserem Haus wohnte. Liesi hatte den Auftrag, mir Anstand und Ordnung beizubringen. Um ganz ehrlich zu sein, so sehr sie sich auch bemühte, ihren Job gut zu machen, unterm Strich gesehen hat sie restlos versagt. Mutter schickte mich aufs Gymnasium, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann mal die Firma übernehmen würde. Ich versuchte die Schule so gut es ging hinzubekommen und den Ansprüchen meiner Mutter gerecht zu werden. Erfüllte aber die Auflagen der Lehrer nicht. Viele Schwänzzeiten und so, du weißt. Ich bin Zeit meines Lebens nie den Erwartungen meiner Mitmenschen gerecht geworden. An erster Stelle denen meiner Mutter, ein anständiger, guter, sauberer, braver Sohn zu sein. Dann denen meiner Anstandsdame Liesi, deren oberstes Anliegen es war, mir Manieren beizubringen. Meine Lehrer hofften bis zuletzt, dass ich das Talent, das sie in mir zu sehen meinten, endlich auch zutage befördere, verbunden mit einem emsigen Fleiß. Auch daraus wurde nichts. Und zu guter Letzt glaubten die Mädchen, die mit mir anbändelten, in mir einen pflegeleichten, verständnisvollen, Indian-Lover zu finden. Den Gefallen konnte ich ihnen leider ich tun.
Meine Karriere habe ich mir schon während der Schulzeit vermasselt. Jemand der sich permanent gleitende Arbeitszeiten gönnt, anstatt in die Schule zu gehen, hat auf der ersten Sprosse der Karriereleiter nichts verloren. Jahr für Jahr bin ich durch die Schulzeit gewandert, ohne, dass mich irgendetwas davon interessierte. Irgendwann waren die Lehrer es überdrüssig, mich in ihrer Gegenwart zu erdulden. Nach der zwölften Klasse wurde ich rausgeschmissen, wegen zu hoher Fehlzeiten, so die offizielle Version. Jemand, der regelmäßig schwänzte und sich nicht am Unterricht beteiligte störte einfach im System. Sie sind mir mit dem Rausschmiss nur zuvor gekommen, ich wäre auch so gegangen. Meiner Mutter erklärte ich, dass ich nicht vorhatte, die Klasse an einer anderen Schule zu wiederholen, geschweige denn zu studieren. Ich machte ihr klar, dass ich auch nicht beabsichtige, ihr Imperium zu übernehmen. Für sie brach damit eine Welt zusammen. Es war das erste Mal überhaupt, dass ich bei ihr eine gefühlsmäßige Regung wahrnahm. Sie drohte mir mit zitternden Händen, mich rauszuschmeißen und zu enterben, aber damit konnte sie mir nichts anhaben. Im Gegenteil, alles, was ihr so wertvoll war, Ansehen, Macht, Reichtum, all das interessierte mich nicht die Bohne. Im Gegenteil, es ekelte mich regelrecht an. Ich packte meine Siebensachen, schnappte mir meine Trommel und machte mich aus dem Staub, einfach so. Wir sollten uns nie wieder sehen. Das war 1988. Ich bin dann in der Welt umhergereist und habe mich in Südeuropa, Marokko, Sri Lanka und anderswo mit Gelegenheitsjobs und Trommeln über Wasser gehalten. Die letzten Monate lebte ich in Israel, im Mea Scharim, im orthodoxen Viertel Jerusalems. Dort habe ich vorige Woche einen Brief von ihrem Nachlassverwalter bekommen. Darin stand kurz und bündig, dass sie gestorben sei und dass die Beerdigung unmittelbar bevor stehe. Gestern wurde dann das Testament eröffnet. So erfuhr ich, dass es das Imperium meiner Mutter nicht mehr gab. Die sinkende Wirtschaftskonjunktur hatte der Firma den Todesstoß versetzt. Nachdem ihr Lebenstraum bankrott gegangen war, musste sie alles was ihr so wertvoll war verkaufen. Nur noch das Haus und ein paar Möbel sind davon übrig geblieben. Ich bin als alleiniger Erbe eingesetzt worden. Ich denke, ich werde das Haus verkaufen, das Geld irgendeinem Bettler in der Fußgängerzone schenken und mich wieder aus dem Staub machen.
November 1999
Hey, da bin ich wieder. Das Haus meiner Mutter ist mittlerweile verkauft. Ich habe das Geld nun doch nicht einem Bettler gegeben, sondern selbst behalten. Wäre ja auch irgendwie blöd gewesen, das ganze Geld zu verschenken. Ich bin auch nicht fort aus Lübeck. Ich bin es einfach leid, in der Weltgeschichte umher zu gondeln. All die Jahre, in denen ich unterwegs war, hatte ich gehofft, endlich zur Ruhe zu kommen und mich zu finden, den Menschen, der ich wirklich bin. Ich habe ihn nie gefunden. Jetzt hoffe ich, hier, an dem Ort meiner verlorenen Kindheit mehr über mich zu erfahren, wer ich wirklich bin. In einer Anzeige habe ich vor zwei Monaten gelesen, dass ein Typ aus Altersgründen ein kleines Antiquariat in gute Hände abgeben will. Komisch. Ich, der ich so wenig mit Büchern zu tun habe, sondern Musik als meine Kraftinspiration ansehe, bin da hin und habe mir diesen Laden mal angesehen. Dieser dunkle, langgezogene Raum, an dessen Wänden sich alte, verstaubte Bücher türmen, hat es mir angetan. Dazu dann der alte Mann, dessen Herz so an den Büchern hing und der den lustigen Namen Balthasar Brenzel trug. Ich habe das einfach mal gemacht und ihm für sein Geschäft die Hälfte meiner Erbschaft gegeben. Mit dem Rest kann ich noch ein paar Jahre über die Runden kommen, auch wenn es mit dem Verkauf von Büchern mal nicht so läuft.
Der Laden hat ein Hinterzimmer, das vorher als Abstellraum diente. Das ist jetzt mein Zuhause geworden. Eine Matratze als Schlafplatz, ein mit Holz betriebener Ofen, auf dem ich auch kochen kann und meine Trommel, das ist mein neues Heim. Im Flur, der zu weiteren, sich oben im Haus befindenden Wohnungen führt, ist die Toilette und ein kleines Waschbecken. Wenn ich daran denke, in was für Verschlägen ich auf Sri Lanka oder in Marokko gelebt habe, ist das hier der wahre Luxus. Wenn du jetzt denkst, dass ich ein Asket bin, so täuschst du dich gewaltig. Ich habe mir eine Musikanlage gegönnt, die im Verkaufsraum aufgebaut ist. Tja, und dann habe ich mir noch einen alten Ford Escort gezogen. Der wird mich von nun an überall hin begleiten. Wir werden sehen, was aus dem Abenteuer „back to the roots“ wird.
Dezember 1999
Nachdem ich in den ersten Wochen in meinem neuen Zuhause Aufwind hatte, fühle ich mich in letzter Zeit ausgelaugt und kraftlos. So ein Scheiß Durchhänger! Immer wieder muss ich an die Schatten meiner Kindheit denken. Weißt du, ich war in der Grundschule ein Aussätziger, wegen meiner Hautfarbe und meiner besonderen Art, wurde oft von meinen Mitschülern gehänselt und verprügelt. Und was das Schlimme war, ich konnte mich einfach nicht wehren. Tag für Tag haben sie mich gequält. Ich habe mich so geschämt, der zu sein, der ich bin. Ich wünschte mir, eine weiße Haut und ganz normal zu sein, so wie alle anderen. Wie oft habe ich morgens in den Spiegel geschaut und gehofft, dass ich über Nacht meine Farbe verloren hätte, aber nichts! Ich hatte keinen Vater der mich vor den anderen beschützen konnte und ich hatte keine Mutter, die mich, wenn es mir schlecht ging, in den Arm nahm und tröstete. Ich war allein auf mich gestellt. Als ich ihr davon erzählte, wie schwer es für mich in der Schule ist und dass ich am liebsten nicht mehr dort hingehen wollte, hat sie nur geantwortet, dass ich noch härter an mir arbeiten solle. Wenn ich erst mal sehr gute Leistungen im Unterricht bringe, würden mich meine Mitschüler schon in Ruhe lassen. Kannst du dir vorstellen, dass meine Mutter mich in meiner Kindheit nicht ein einziges Mal in den Arm genommen hat? Nicht ein einziges Mal, ich schwöre es dir! Wie sehr hätte ich doch den Schutz eines Vaters und die Zärtlichkeit einer Mutter gebraucht. Es gab sie nicht! Ich schämte mich dafür, auf der Welt zu sein. Und es war keiner da, der zu mir stand, der mir helfen konnte. Aber ich bin da irgendwie durchgegangen. Ich zog mich ganz in mich zurück und legte mir einen Panzer zu, durch den keiner durchdringen konnte, bis zum heutigen Tag. Ich schwor mir, nie wieder Schwäche zu zeigen, keine Träne zu vergießen und ich wollte mich nicht mehr für mich schämen, sondern stark sein.
Immer noch fühle ich diese Scham in mir, obwohl das doch alles schon so lange zurück liegt. Diese Scham verfolgt mich hier in dieser Stadt, vom ersten Augenaufschlag bis tief in die Nacht hinein. Ich muss raus hier, weg, ganz weit weg und mich endlich befreien. Am liebsten würde ich alles wieder hinwerfen und abhauen, so wie ich es immer gemacht habe, wenn es eng wurde. Aber ich weiß, ich wäre ein Feigling, wenn ich das tun würde. Und ich will kein Feigling mehr sein, nie wieder!