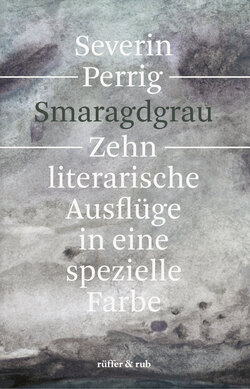Читать книгу Smaragdgrau - Severin Perrig - Страница 13
ОглавлениеSeit ich als Kind das erste Mal auf einem der hölzernen Stühle im Sternenturm saß, in dem ehemaligen Wasserspeicher, der wie eine Backstein-Arche aus dem Hamburger Stadtpark ragt, haben mich Planetarien fasziniert. Da steht vor einem diese schwarze Apparatur eines Projektors – eine Art schräg gestellte Tauchkapsel aus Jules Vernes Tagen oder gar ein ausgedienter Satellit des Sputnik- Schock-Zeitalters –, dessen Wirkungsweise nie gleich auf Anhieb ersichtlich ist. Geht das Saallicht aus, so wandert der Blick zur Decke, die wie ein Kirchengewölbe an den unteren Rändern ins Bläulichgraue ausfranst. Dann erscheinen allmählich unterschiedlich große und hell aufleuchtende Punkte, die dem Blick mehr und mehr eine nächtliche Himmelskuppel suggerieren, deren aufsteigende oder sinkende Kreisbahnen von Sternen und Planeten einen in der Illusion wiegen, der eigene Blick gehe nun ins Unendliche. Das Erlebnis in einem Sternentheater ist verbunden mit dem »seltsamen Gefühl«, das die Schriftstellerin Nathalie Sarraute in ihrem Gesellschafts- »Planetarium« der späten 1950er-Jahre beschrieben hat, als ob man sich »vom Boden höbe« und »seine Schwere verlöre«. Wie einst die hochgereckten Köpfe der Eltern, so gehen mir noch heute sämtliche Zuschauer im Raum – allesamt wohl »rauschhaft mit dem Kosmos kommunizierend « (Walter Benjamin) – verlustig im bewegten Gewimmel auf der Milchstraße in meiner Miniatursternwarte im Kopf. Schließlich werden aus diesem einmaligen Ausflug durch astronomische Rekonstruktion Tausende von nächtlichen Ausflügen in eine ganz verlorene Zeit, in der unsere Vorfahren zum Himmel blicken mochten. Die damalige Konstellation der Gestirne sehen wir nun in aller Selbstvergessenheit, wie einst die furchtsamen Urahnen. Das wirkt weit interessanter und bewegender als jeder noch so dramaturgisch sorgfältig fabrizierte Kinofilm, in welchem mit Tierfellen verkleidete Schauspieler in einer als prähistorisch nachempfundenen Gegenwartskulisse in die Frühphasen der Menschheitsentwicklung bis zur Erfindung des Steinkeils oder Feuers zurückversetzt werden.
Eigentlich funktioniert die dunkelblaue Stunde im Planetarium ganz ähnlich wie die Lektüre eines Buches, bei der auch alles Gegenwärtige der einen umgebenden Welt, genauso wie die Schriftsprache oder das Druckbild des Textes im Lesevorgang verschwinden, um das unmittelbar Gelesene allein im eigenen, inneren Projektionsraum sich bildlich entfalten zu lassen. Das kann zu ganz speziellen Träumereien und Verstiegenheiten führen. Es ist wohl alles in allem ein winziger, geradezu unbedeutender Schritt für die Menschheit, aber ein gewaltiger Sprung für den einzelnen Lesenden, dessen nach innen versenkter Blick vom Buch abhebt, die Realität weit unter sich zurücklassend, um in ein ganz neues, schwereloses Universum einzutauchen. Eine ungeheure Weite eröffnet sich einem da, in der Oberfläche und Tiefe derart ineinander verschwimmen, dass nicht mehr klar erkennbar ist, wo die Erde aufhört und wo der Himmel beginnt. Allein in diesem Schiefergrau glühen ab und zu doch noch ein paar erhellende, satellitenhafte Splitter zur Orientierung auf. Solch eine sphärische Stimmung hat aber auch etwas von der winterlichen Jahreszeit, welche uns in einer unendlichen Folge farblos monotoner und fruchtloser Tage die Sonne verschweigt und den Horizont verriegelt, während uns das Vereiste anblinkt. Hier lässt sich aber auch an »das Graue alter Winter« denken, wie es beim Dichter Rilke heißt. Der weiße Schnee scheint in die Jahre gekommen zu sein, wirkt schlierig und unansehnlich. An vielen Stellen hat ihn der Regen allmählich zu Matsch vergraut. Von den einst mächtig glänzenden Eisschollen ist der Belag längst wie Rinde abgeblättert. Der eisige Rest liegt als ein frostiges Gestoppel im Zwielicht, nichts als bizarre Schatten werfend.
Das ist ein Schiefergrund für Träume, von denen man beim Erwachen nicht mehr recht weiß, in welcher Farbe sie einem eigentlich erzählt wurden. Alles wirkte derart zwischen Schwarz und Weiß, dass die Unterschiede von Tag und Nacht, von Ferne und Nähe im Nachhinein nicht mehr feststellbar sind. Und dennoch eignet sich gerade dieses diffuse und schwache Licht ideal zur seelischen Entrückung wie Selbstversenkung.
Seit der Antike haben die Träume entsprechend mythologische Deutungen erfahren, indem allerhand geflügeltes Traumvolk den Geist des Menschen mit Dämmer überzieht. Alle gelten sie, laut dem griechischen Dichter Hesiod, als »Kinder der Nacht«: der sanfte Schlafgott Hypnos, sein tödlicher Zwillingsbruder Thanatos, der redliche Traumgott Morpheus und seine dämonischen Albtraum- Geschwister. Dazu gesellen sich zahlreiche bellende und geifernde Monster oder verführerisch hell singende Mischwesen. Sie bevölkern die Höhlen, die Erdspalten und Eingänge in die Unterwelt, aus denen sich finstere Schwaden ergießen, sowie die abgelegenen Eilande mit ihren schrundigen Klippen. Denn diese Gestalten sind schließlich Kinder allen dunklen Anfangs, entstammen dem riesigen Schoß der Nacht. Sie ist als Erzeugerin je nach griechischem Volksglauben und Erzähltradition die größte aller Ur-Göttinnen – neben dem ungeheuer potenten Okeanos und der »breitbrüstigen« Erdgöttin Gaia, die wiederum mit dem Himmelsgott Uranos die Titanen gezeugt haben soll, von denen alle Göttinnen und Götter des himmlischen Olymps und der dämonischen Unterwelt abstammen.
Dieser Ur-Nacht, der sogenannten Nyx, wird nachgesagt, sie sei ursprünglich ein riesiger Vogel gewesen, der im Dunkeln ein gewaltiges, silberglänzendes Ei gelegt habe. Daraus sei allerhand Merkwürdiges geschlüpft: der Liebesgott Eros, des Weiteren der alles ans Licht, in die Welt bringende Phanes, dann das gähnende Chaos, das den Hohlraum des Himmels erschuf, dazu Meergottheiten wie Okeanos und Tethys, schließlich all die Gestirne und endlich die Schicksalsgöttinnen, die gräulichen Moiren, die den Lebensfaden für die Menschen spinnen oder je nachdem durchschneiden, was für die toten Seelen jeweils einen mühseligen Weg in die Unterwelt bedeutet.
Dort unten bei den Mächten der Finsternis, wo bereits am Eingang die nichtigen Träume hausen, hat die Nacht sämtlichen Dingen ihre Farbe geraubt. Allein der alte Mond lässt noch sein weißes Licht über alles rieseln. Von diesem schattenhaften Dasein berichten zumindest sogenannte Totenbücher, orphische Mysterien, Hadesund Jenseits-Wanderer in der Literatur, bis hin zu Aufzeichnungen von Visionären, allerhand Bardo- und Karma- Meditationen aus Religion und Esoterik oder gar Nahtod- Erfahrungen. Und dieser Anblick der sich verdichtenden und verflüchtigenden Trugbilder, mit all ihren Totenmasken von knöcherner Kahlheit, gehört wohl zum »ältesten Grauen«, das die Menschheit kennt, wie der Philosoph Ernst Bloch schreibt.
Vor Schrecken über all diese Schatten in finsterster Nacht könnte selbst ein an Schenkeln und Fuß geradezu an den Stuhl gefesseltes Kind – weil es ja im Sternentheater wie in der berühmten Höhle Platons nicht den Kopf von den Lichterscheinungen abwenden soll – aus seinen schweren Träumen mit einem Mal auffahren und durch die Sitzreihen im Planetarium auf den Projektor vor ihm zustürzen, nicht um ein ultimatives Stopp durch den Lärm der Rotationsmotoren zu rufen, wie der verschlafene Comicheld Little Nemo, sondern vielmehr um gerade von diesem Ungetüm eines eisernen Kraken, diesem Projektionsapparat emporgehoben zu werden. Emporgehoben bis zur künstlichen Himmelskuppel, wo sich hinter dem bleichen Mond unvermittelt eine kleine, unscheinbare Luke anheben ließe, um etwas vom eigentlichen Himmel draußen zu erhaschen. Nur könnte das Kind schon beim Gedanken an all das weinen, ohne zu wissen weshalb, weil dort mit aller Wahrscheinlichkeit das genau gleiche, zuverlässig düsterste Lethe-Wetter Hamburgs herrschen dürfte, also »ein tiefgrauer Tag« (Peter Wawerzinek). Und in der Tat ziehen vor dem Planetarium kleine, fahle Nachmittagswölkchen pfeilschnell an den niedrig hängenden, schlauchgrauen Wolkenmassen dahin, wie vor einem unbeweglichen, gerundeten Wall, gar einer stählernen Sternschanze. Dunkle Flecke mit unregelmäßigem Rand legen sich dabei wie Spinngewebe über die Wand von Nichts im Hintergrund. Die hoch liegende, mit einem Mal pulsierende Wolkendecke franst wie ein alter Teppich an den Rändern aus, lässt aschige Fetzen emporschweifen, sich jagen und balgen – es ist fast, als blicke man in den Rauch des Großen Hamburger Brands von 1842 –, um sich dann plötzlich mit den ruhig dahingleitenden, perlfarbig geballten Wolkenpaketen zu verquirlen. Der kühle Wind wellt ihre Kämme wie brüchige Eisschollen immer höher übereinander, bis sie endgültig in sich zusammenfallen, mal wie massive Brocken und mal wie leichtester Schaum. Auf launisch, wirblige Art fährt das Grauwetter durchs schmutzige Wolkengebirge.
Wenn so der Westwind geht und das Gewölk von melancholischer Schönheit am Himmel zieht, schlägt den in Träumereien verlorenen Menschen genauso wie verträumten Romanfiguren, etwa Effi Briest in Fontanes gleichnamigem Roman, die ideale Wanderstunde an der frischen Luft, um im »Gefühl des Alleinseins« nach ehelichen oder andern Katastrophen des Lebens mit all ihren aufgewühlten Gefühlen selbst zurechtzukommen. Ein Blick an den wolkenverhangenen Himmel lenkt ab und tröstet zugleich, denn »jedes Wolkengewebe ist eine geheimnisvolle Schrift«, die es zu entziffern gilt, wie 1808 der romantische Philosoph und Staatsrechtler Adam Müller schreibt.
Und selbst wer diese Schrift nicht beherrscht, wird dort noch die unförmigen Gebilde sehen, an den Rändern von hellerem Licht umsäumt, die sich jederzeit in ein »seltsames Wolkengerüst mit Logen und Galerien« (Eichendorff) oder gar in eine leichte »Wolkenaue« (Droste-Hülshoff) verwandeln können, worauf Fantastisches erprobt und aufgeführt wird. Jedes der derart theatralisch inszenierten Stücke hat »Metamorphosen« im Untertitel: Greisenhafte Wolkenkönige blicken mit ihren patriarchalen Gesichtern streng herab auf die Erdenbewohner, mutieren dabei zu dickbäuchigen, bärtigen Menschenfressern, bevor sie sich in majestätische Botticelli-Schönheiten verwandeln, deren nackte Körperformen sich mit durchsichtigem Flor kaum richtig verschleiern lassen, um dann plötzlich wild verwegenen Heeren Platz zu machen, die mit Ross und Reiter dahinrasen, riesige Wolkenstiere verfolgend, die sich wiederum mit letzter Kraft aufbäumen, bis mit einem Mal eine Art gewaltiger Turban von dunklem Flanell darübergestülpt wird, der anschließend wiederum hinter einem neuartigen, aus dem Nichts auftauchenden, dunklen Raubschloss auf einem Eisberg spurlos verschwindet.
Das sind Geschichten, die allerhand Unterhaltsames von »unabsehbaren Göttersitzen« (Gottfried Keller) erzählen, wo jede Veränderung am dämmrigen Himmel etwas zu bedeuten hat, egal ob beschützende Wolkensäule oder bedrohliches Wetterzeichen in Windhosenform. Das Numinose ist anziehend wie erschreckend zugleich, wenn es von Zeit zu Zeit aus den trüben Dunstmassen schwergewichtig wetterleuchtet. Dann liegt es wieder still da in schwüler Grauhitze lichtloser Sommernachmittage, bis endlich das bleierne Unwetter donnergrollend aufzieht, in dem bereits trübe Flammen wie über Sodom und Gomorrha grell hervorblitzen.
Es kann aber auch, weiß aufschäumend am Himmel, den pechschwarzen Qualm als schräges Segel vor sich hertreiben, bis ein Hagel eiserner Speere daraus auf die Erde niedergeht oder sintflutartige Regenfälle eine derart dichte Wand errichten, dass niemand mehr an die leiseste Aufhellung in Zukunft mehr glauben mag. Und doch klärt sich der Himmel stets wieder zu einer Art Röntgenbild von Licht- und Schattengebilden. Denn es ist nicht nur Strafe, die da schwergewichtig vom Himmel auf die Erde niedergeht. »Schnell kommt der Herbst«, schreibt der russische Autor Jewgeni Samjatin 1918, »auf grauen Fledermausflügeln. « Dann steigen und sinken die undurchdringlichen Wassernebel in Wachtelgrau merkwürdig still und doch erfüllt mit einzigartig intensivierten Klängen vom leisen Wispern und Nieseln der Natur. Sie wecken Ahnungen und Hoffnungen zugleich, dass das Göttliche mit all seinen Boten mitten unter uns auf Erden wandeln könnte, um uns mit Liebe und Allwissenheit auf gute Wege zu leiten und bisweilen auch auf Abwege zu verführen. Da vermischt sich allerhand im Nebulösen, ja bisweilen weht das große Unbekannte uns einfach nur an, bläst mitunter gar als Geist in uns das Geistige regelrecht hinein.
Nur, »wie ist Gott? Wie sieht er aus?«, fragte sich schon Heinrich Heine, »als kleines Kind«, wie er in seinem Buch »Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland « von 1834 in der Rückschau schreibt: »Und damals konnte ich ganze Tage in den Himmel hinaufsehen, und war des Abends sehr betrübt, dass ich niemals das allerheiligste Angesicht Gottes, sondern immer nur graue, blöde Wolkenfratzen erblickt hatte. Ganz konfus machten mich die Mitteilungen aus der Astronomie, womit man damals, in der Aufklärungsperiode, sogar die kleinsten Kinder nicht verschonte, und ich konnte mich nicht genug wundern, dass alle diese tausendmillionen Sterne ebenso große, schöne Erdkugeln seien wie die unsrige, und über all dieses leuchtende Weltengewimmel ein einziger Gott waltete.«
Nun, die antike Götterdämmerung ist auch eine des monotheistischen Gottes geworden, im mausgrauen Wetter aufgeklärter Sachlichkeit. Wir sehen in der dunstigen Natur um uns nicht weniger an Unerklärlichem als unsere Vorfahren, aber es erzählt sich in der Neuzeit einfach wesentlich banaler, indem es sich eben wissenschaftlicher, wenn nicht gar intellektueller anhört. Ein wolkiger, bis zum Horizont nebulös verhangener Himmel ist dann in seiner ganzen Grauheit allein eine Frage der Perspektive auf die durchscheinenden, absorbierten oder reflektierten Lichtwellen, wenn sie auf die entsprechenden Luftmoleküle treffen. Und je nachdem, wie sich diese in Form von Wassertröpfchen, Gas oder Schwebestaub zusammensetzen, sehen wir bloß noch unterschiedlich zu deutende Phänomene der Optik – ebenso am hohen Himmel wie im tiefsten Nebel.
Der Physiker und großartige Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg schreibt in seinen »Sudelbüchern«: »Die Sehnerven sind doch beständig beschäftigt. Wenn ich in der dunkelsten Nacht im Bette liege, und noch über dies die Augen schließe, so sehe ich doch immer kein volles Schwarz, sondern immer etwas mit Grau meliert.« Die lichtergrauten Vorhänge des Abends bleiben zugezogen und machen die Farben von Tag und Nacht ununterscheidbar. Was soll man dazu eigentlich überhaupt noch weiter sagen? Und doch notiert sich der französische Philosoph und Literaturwissenschaftler Roland Barthes im Hochsommer 1977 »auf die hellere Neige eines grauen Tages «, dass er dabei eine eigentümliche »Schwebe-Euphorie « verspüre: »Alles ist flüssig, luftig, trinkbar (ich trinke die Luft, das Wetter, den Garten). Und da ich gerade Suzuki lese, scheint mir, dass dies dem Zustand verwandt ist, der im Zen Sabi heißt; oder (da ich Blanchot lese) der ›flüssigen Schwere‹, von der er in Zusammenhang mit Proust spricht.« In den schläfrigen, leicht säuerlich anmutenden Stunden des Feierabends kommt das Denken eben doch stets wieder zu erstaunlichen, aufschlussreichen, neuen Assoziationen und Interpretationen, die qualitativ das hellsichtig daherkommende Tageswerk durchaus in den Schatten stellen können.
Das fahle Licht, wie es der Mensch nach wie vor über den Himmel treiben sieht, ist und bleibt offensichtlich immer noch eines, das auch als Vorbote einer vielversprechenden Frühdämmerung gelten kann – das »Lichtgrau « des Morgens (Goethe) –, indem es alle Dunkelheit verscheucht und einen neuen Tag heraufziehen lässt, der, selbst wenn er gar zu gräulich werden sollte, einer Reihe von unerträglich guten Tagen nicht nachstehen muss. In Franz Kafkas »Gespräch mit einem Betrunkenen« plaudert denn Letzterer daher, sich mit allzu lauten Rülpsern stets von Neuem unterbrechend: »Nicht wahr, auf langen Stangen, überall verteilt, steigen Diener in grauen, frechgeschnittenen Fräcken und weißen Hosen, die Beine um die Stange gelegt, den Oberkörper aber oft nach hinten und zur Seite gebogen, denn sie müssen an Stricken riesige graue Leinwandtücher von der Erde heben und in die Höhe spannen, weil die große Dame einen nebligen Morgen wünscht.«
Die Faszination des magischen Dämmerlichts bei Tagesanbruch, wenn alles wieder aus der versteinernden Dunkelheit hervortritt, vieles geradezu frühlingshaft neu beleuchtet und belebt wirkt, hat auch etwas von diesem Moment, wo in den Planetarien das Saallicht wieder angeht und den zuvor derart präsenten, nahen Weltraum in einem Grau-in-Grau der Kuppel verschwinden lässt. Wir sind noch einmal davongekommen, sagt unser Inneres dann. Für einen ruhigen Moment sitzen wir auf unseren irdisch harten Stühlen noch wie unbeweglich da, um zu staunen, dass wir doch nicht auf Nimmerwiedersehen aus unserer Welt hinauskatapultiert worden sind. Der Sternenturm steht einfach immer noch unbeweglich da, wie eine Arche Noah eben. Und im Gegensatz zum antiken Astronomen Eudoxos von Knidos sind wir bei der Betrachtung der Gestirne kein Härchen grauer geworden.