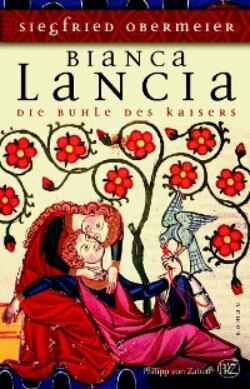Читать книгу Bianca Lancia - Siegfried Obermeier - Страница 7
Prologus
ОглавлениеWunderliche Gedanken gingen dem Kaiser durch den Kopf. Als er am Morgen dem Schreiber mit matter Stimme etwas diktierte und nach dem Datum fragte, flüsterte der Mann ehrfurchtsvoll: „Decembris decimus, Maiestas.“
Jetzt, einige Stunden später, bohrten sich diese Worte zwischen andere Gedanken, schoben sie beiseite wie unnützen Ballast. Decimus Decembris – Decembris decimus. Warum der zehnte Monat, wo er doch eigentlich der letzte, der zwölfte sein sollte? So müßte es eigentlich duodecimus – der Zwölfte – heißen. Hatte er diese Frage als Siebenjähriger nicht schon seinem Lateinlehrer Francisius gestellt? Ein Deutsch-Sizilianer, mit dem Vornamen Friedrich Wilhelm – Federico Guglielmo. Der Kaiser flüsterte die Namen vor sich hin und sogar die deutsche Form ging ihm leicht von den Lippen – dank Bianca. Auch mit Adelheid hatte er Deutsch gesprochen, ein sehr dürftiges Deutsch zwar … Wieder schob dieser lästige Decembris decimus alles andere beiseite. Ja, warum der zehnte Monat? Weil, so Magister Francisius, bei den alten Römern das Jahr mit dem ersten März begann und so der Dezember als zehnter Monat gezählt wurde. Das war noch vor Julius Caesar …
Der Kaiser blickte zum Fenster, wo sich draußen die Blätter der alten Steineiche im Wind bewegten wie Kastagnetten, und er glaubte sogar das erregte Klappern zu hören, als sei die Eiche eine vielarmige Tänzerin und hielte in Dutzenden von Händen dieses – dieses Musikinstrument. Lässt sich das Scheppern von Kastagnetten schon als Musik bezeichnen? Er schloss die Augen und hörte die leisen Stimmen des Arztes Johannes von Procida, der sich mit Manfred unterhielt. Sie standen am Fenster, doch nicht so nahe beieinander, dass sie die Eiche ganz verdeckten. Magister Johannes liebte den Abstand, umso mehr, da Manfred als kaiserlicher Prinz im Rang unendlich hoch über ihm stand. Der Medicus war kein Mann, der so etwas vergaß.
Der Kaiser fühlte sich so unendlich schwach, dass er glaubte, kein Glied regen zu können. Neugierig wie stets machte er einen Versuch. Zu glauben, bedeutete auch, etwas anzunehmen, zu vermuten. Wenn sich das Experiment bestätigte, wurde Wissen daraus. Er konzentrierte seinen Willen darauf, die linke Hand zu heben, und sah, wie seine abgemagerten, fast skelettierten Finger eine Spanne über der Bettdecke schwebten – zittrig und kraftlos. Schnell ließ er die Hand wieder sinken, doch der Medicus, der auch während des Gesprächs immer wieder seinen Blick auf das Bett gerichtet hatte, verstand es als einen Wink und kam schnell näher.
„Majestät?“
Friedrich hatte bei seinem Kommen die Augen geschlossen und stellte sich schlafend. Hatte Johannes es bemerkt? Nein, im Zimmer war es auch am Vormittag so dämmrig, als kündige sich schon die Nacht an. Das lag an den grauen Wolkenfetzen, die so hurtig über den Himmel sausten, als seien sie von Gott zu einer eiligen Audienz befohlen. Decembris decimus spaltete aufs Neue seine Gedanken. Da wurde der Kaiser unwillig und rief: „Nein, jetzt nicht!“ Doch er glaubte nur, es gerufen zu haben, in Wahrheit war es nur ein kaum hörbares Flüstern gewesen – so leise, dass sogar der stets aufmerksame Medicus es nicht bemerkt hatte. Prinz Manfred aber, sein liebster Sohn, sprach mit kaum gedämpfter Stimme. Er nahm wenig Rücksicht auf den Kranken – ein Vorrecht kraftvoller und auch gedankenloser Jugend.
So schwach sein Körper war, so geschärft war sein Gehör. Der Hofstaat fürchtete es, denn der Kaiser vernahm kritische Worte, auch wenn sie leise und ganz hinten im Saal gesprochen wurden. So versuchte er jetzt, ganz Ohr zu sein. Im Laufe seines Lebens hatte er festgestellt, dass die menschlichen Sinnesorgane über den Kopf zu steuern waren, nicht in jedem Fall und mit einer kleineren oder größeren Fehlerquote, aber manchmal war das sehr hilfreich; beim Verrat des Pietro delle Vigne etwa, der sich lateinisch Petrus de Vinea nannte und darauf achtete, so angesprochen und angeschrieben zu werden.
Wieder schlugen seine Gedanken Haken, wie der vom Falken gejagte Hase. Nutzlose Finten natürlich, im Falle des Hasen, denn das Hakenschlagen hatte nur einen Sinn, wenn ein quadrupes ihn verfolgte, also Fuchs oder Hund. Der Falke aber stieß von oben herab, da gab es kein Entrinnen. So erging es den meisten seiner Feinde, er stieß von oben herab, aus der Höhe seiner kaiserlichen Erhabenheit, und all diese Verräter, Wort- und Eidbrüchigen mochten sich ducken oder nach einem Loch schielen, in dem sie sich verkriechen konnten, sie wurden zur Strecke gebracht!
Eine Flut von Gedanken stürmte auf ihn ein, darunter nutz- und sinnlose. Warum eine Spanne im Italienischen zwar spanna, aber auch palmo heißt? Die Deutschen sagen Spanne und damit war die Entfernung von der Spitze des Daumens bis zur Spitze des kleinen Fingers einer Männerhand mit gespreizten Fingern gemeint. Gespannte Finger – Spanne.
Doch er wollte ganz Ohr sein, wie er bei Petrus de Vinea ganz Auge war und im bärtigen Gelehrtenkopf des ungemein geschickten Verräters den Verrat entdeckte. Nicht am Kopf, sondern an der Stelle des Kopfes, wo die beiden Augen saßen, schmale Augen, kluge Augen, doch eines Tages war darin der Schimmer des Verrats zu erkennen. Der Kaiser, vom Papst gebannt, wird bald stürzen, sagten die verräterischen Augen, und wird mich, den allzeit getreuen Petrus mit in den Abgrund reißen. Ist es das wert? Habe ich deshalb meine Reichtümer angehäuft, um mit dem entthronten und geächteten Kaiser zugrunde zu gehen? So aber ist er durch mich und nicht mit mir vernichtet worden. Vernichtet? Das richtige Wort? Ein besseres: ausgemerzt, zerstört, beseitigt, zerschmettert … Wie auch immer. Der größte Fehler dieser Verräter und Eidbrecher war, ihn, den Kaiser, zu unterschätzen. Was waren sie denn schon vor Seiner Herrlichkeit? Was hatten sie diesen majestätischen Worten entgegenzusetzen:
Imperator Fridericus Secundus
Romanorum Caesar Semper Augustus
Italicus Siculus Hierosolymitanus Arelatensis
Felix Victor Ac Triumphator?
Warum aber fehlt das Rex Germaniae? So fragten nicht wenige, und er war zu stolz, es zu beantworten, während die Klugen nicht fragten, sondern wussten, dass ihn die Kurfürsten zum deutschen König gemacht hatten – im Grunde ein leerer Titel, der sich auslöschen und auf einen anderen übertragen ließ. Aber alles Übrige hatte er ererbt und erheiratet oder – die Kaiserkrone – durch den Stellvertreter Christi auf Erden verliehen bekommen.
Da hörte er deutlich die Stimme seines Sohnes Manfred vom Fenster her. Ganz Ohr wollte ich doch sein …
„Wird er es überstehen?“
Nun war Magister Johannes kein Mann der Körpersprache, niemals nickte er, schüttelte den Kopf oder hob die Schultern. So auch jetzt. Er trat ein wenig näher und sagte etwas.
Er könnte ruhig lauter sprechen, dachte der Kaiser, er hat doch gesehen, dass ich schlafe. Aber aus Manfreds erfreutem Nicken konnte er sehen, dass es eine positive Antwort gewesen war.
Friedrich aber fühlte, dass er sterben musste. Seit wann? Seit heute, seit gestern? Eigentlich schon, seit sie nach dem Jagdausflug dieses kleine Kastell betreten hatten. So wenig der Kaiser an einen allmächtigen Gott glaubte, der als bärtiger Greis das Universum regierte, so viel hielt er von der Botschaft der Sterne. Der weithin berühmte Michael Scotus hatte bis zu seinem Tode, das war im Jahr von Manfreds Geburt gewesen, am kaiserlichen Hof gelebt. Der Astrologe hatte zu den wenigen gehört, die den Kaiser mit „Dominus“ anreden durften, auch zu den wenigen, die immer empfangen wurden.
Ob er nicht doch ein Betrüger war? Seine äußerliche Ähnlichkeit mit Petrus de Vinea war groß, doch die beiden mochten sich nicht. Scotus hielt den Großhofrichter für einen von maßlosem Ehrgeiz besessenen Mann, der alles tat, um bei mir in Gunst zu stehen. Petrus aber, um es geradeheraus zu sagen, nannte Scotus einen geschickten Betrüger, doch ich mischte mich nicht in diesen Streit. Michael Scotus hatte, wie man so sagt, des Kaisers Ohr – aber ich schweife ab …
Friedrich öffnete die Augen und da stand niemand mehr am Fenster. Hatte er geschlafen? Was war mit diesem Kastell, warum …? Ja, jetzt fiel es ihm ein und die Verbindungsschnur von Magister Scotus zum Castel Fiorentino spannte sich. Als er ihn nach der Art und dem Zeitpunkt seines Todes fragte, blickte der Bärtige ihn ernst an. Scotus gehörte zu den wenigen Menschen, die den jähen, feurigen Blick des Kaisers ruhig aushielten.
„Der Zeitpunkt, Domine, liegt allein in Gottes Hand. Die Art des Todes? Nun, alles weist darauf hin, dass Ihr sub flore sterben werdet.“
Sub flore – unter Blumen? Scotus gab trotz dringender Nachfrage keine weiteren Erklärungen. Er sagte, mehr wisse er auch nicht und sollte sich wider Erwarten sein diesbezügliches Wissen erweitern, so werde er es sofort an den Dominus weitergeben. Nun, es kam nichts mehr, aber Friedrich mied, um nur ein Beispiel zu nennen, zeitlebens die Stadt Florentia, die Blühende, die Blumenreiche. Zum Glück bestand kein Anlass, diese bedeutendste Stadt Mittelitaliens zu besuchen – da waren eher Gründe, es nicht zu tun. Florentia war kurz nach Friedrichs Geburt dem Tuscischen Bund beigetreten, eine gegen die deutsche Kaiserherrschaft gerichtete Liga. Als Kaiser war er klug genug, gegen diese wichtige, wohlgerüstete Handelstadt nichts zu unternehmen. Sie gehörte nicht zur Lombardei und er wusste, dass es auch in Florentia eine ganze Reihe von ghibellinisch gesinnten Familien gab, auf die er notfalls zählen konnte.
Wieder schloss er die Augen. Heute hatte es kaum diese passione iliaca gegeben – jene grässlichen Darmkrämpfe, die ihn zuvor tagelang gequält und geschwächt hatten. Nun aber stellte er sich die kritische Frage, ob er Florentia besucht hätte, wäre nicht die Warnung des Magisters Scotus gewesen? Neugierde und Wissensdrang, die ihn stets begleiteten, hätten wohl gesiegt und er wäre – vielleicht verkleidet und anonym – durch eine Stadt gewandert, von deren Kirchen und Palästen man sich Wunderdinge erzählte.
So hatte er Florentia, die Blumenreiche, gemieden, aber das unerbittliche Schicksal hatte ihn auf das Castel Fiorentino geführt und so würde sich die Prophezeiung seines Todes „sub flore“ erfüllen. Er lächelte leise und dachte: Was kann es denn Schöneres geben, als „unter Blumen“ zu sterben? Ein Geräusch riss ihn aus seinen bunt wirbelnden Gedanken. Er öffnete die Augen und blickte in das Greisengesicht von Berardo, dem Erzbischof von Palermo. Einer der Treuesten, die je des Kaisers Lebensweg begleitet hatten. Fast von Anfang an … Über vier Jahrzehnte, unbeirrt durch Niederlagen oder durch Siege, stand er Friedrich zur Seite, als er König von Sizilien war, später dem deutschen König und dem römischen Kaiser. Berardo gehörte zu den wenigen Priestern, die den von der Kirche Gebannten zur Krönung nach Jerusalem begleiteten. Dreimal traf ihn selber der päpstliche Bann, doch er blieb standhaft.
„Setzt Euch, Eminenz …“
Ein Diener brachte den Stuhl, der Erzbischof ließ sich ächzend nieder. Friedrich räusperte sich, hustete krampfhaft und flüsterte: „In allen Gefahren standet Ihr mir zur Seite und vieles habt Ihr um mich erduldet.“
„Du warst im Recht, mein Sohn, und das Recht ist bei Gott. Wir standen also auf Gottes Seite.“
Die zittrige Greisenstimme … Jedes Mal, wenn Friedrich sie hörte, musste er seine Rührung verbergen, was ihm nicht immer gelang. Berardo de Castanea war der einzige lebende Mensch, der den Kaiser noch duzen durfte, auch der einzige, den Friedrich schon in seiner Kindheit gekannt hatte.
„Es geht dir besser, sagen die Ärzte.“
„Die Ärzte sagen viel …“
„Empfindest du es nicht so?“
„Doch, Eminenz, aber das kann auch ein schlechtes Zeichen sein. Oft genug haben die Ärzte eine euphoria mortis beobachtet, eine Gnade der Natur, die Gott den Sterbenden schenkt.“
Berardo nickte. „Gut möglich, aber es kann auch ein Zeichen der beginnenden Genesung sein. Und gerade deshalb schlage ich eine Generalbeichte vor. Damit soll für dich ein neuer Lebensabschnitt beginnen.“
„Heute nicht … Ich muss mich dazu erst sammeln, morgen ist auch noch ein Tag.“
Der Erzbischof erhob sich, wieder laut ächzend. „Wie du willst, Federico.“ Es klang freundlich und verständisvoll.
Draußen senkte sich die Dämmerung über das Land, die Steineiche war nur noch als Schatten zu erkennen, aber der Wind hatte sich verstärkt und Friedrich hörte wieder den erregenden Ton der Kastagnetten. Doch nicht die vom Wind bewegten, immergrünen Blätter der Steineiche verursachten dieses Geräusch, sondern die Erinnerung an das aufreizende rhythmische Klopfen, das dieses primitive hölzerne Musikinstrument erzeugte. In den Händen der Tänzerinnen. In seinem Harem. Er hatte sich niemals geweigert, die Existenz eines solchen Frauenhauses zuzugeben. In Melfi, in Foggia, auf Reisen. Seine meisten Kinder hatte er wohl mit diesen braunhäutigen, schwarzhaarigen, dunkeläugigen Mädchen gezeugt. Da wurde er zum rasenden Satyr, der sich tagelang durch die Schöße der Mädchen wühlte, unermüdlich, unerbittlich, potent wie ein junger Stier.
Das hatte mit Bianca nicht aufgehört, doch er war ruhiger und besonnener geworden. War er fern von ihr, musste der Harem einspringen, lebten sie aber zusammen in einem Haus, dann war sie es und nur sie. Freilich, den Pfaffen hatte das alles nicht gepasst und es hagelte Kritik an seinem „orientalischen Lotterleben“ mit einem „muselmanischen“ Harem. Bianca, weitherzig, wenn es bloß um „lieblose Bettgeschichten“ ging – so hatte sie es einmal genannt –, fragte ihn im Scherz, ob sie auch einmal als halb nackte Bauchtänzerin mit Kastagnetten auftreten solle, um ihm Ähnliches bieten zu können wie seine Haremsdamen. Warum nicht, hatte er gesagt und ihr zwei Kastagnetten geschenkt. Getanzt hatte sie dann doch nicht für ihn, es war auch nicht nötig.
Würde man ihn heute fragen, welche seiner zahllosen Frauen – Gemahlinnen und Kebsen – er wirklich und wahrhaftig geliebt hatte, dann würde er ohne zu zögern antworten: Es waren zwei. Aber wer würde es wagen, eine solche Frage zu stellen? Bianca – ja, sie hatte ihn nach dem Tod seiner dritten Gemahlin gefragt, welche seiner drei Ehefrauen ihm die liebste gewesen sei. Nicht, welche von ihnen er geliebt habe. Zwei von ihnen ruhten, nur einige Dutzend Meilen von hier entfernt, im Dom von Andria, Jolanda von Brienne und Isabella von England. Konstanze aber, die zehn Jahre Ältere – er hatte sie mit fünfzehn auf päpstliches Geheiß heiraten müssen – hatte mit ihm in Rom die Kaiserkrone empfangen. Sie ruhte im Dom von Palermo. Bald werden wir uns dort treffen. Geliebtes Sizilien, mein goldener Apfel. Da hörte er Biancas rauchige Stimme: Du hast meine Frage nicht beantwortet, mein Falke. Ja, so nannte sie ihn wegen seiner scharfen, alles durchdringenden Augen: Falco oder Falcone. Auch er hatte sich ein Kosewort erdacht: Unica. Die Einzige. Ihm war nichts Besseres eingefallen, denn einzig in ihrer Art war Bianca Lancia ja tatsächlich und dieses „Unica“ ließ sich noch ergänzen: einzig Geliebte.
Damit war die erste Frage schon beantwortet, denn Adelheid war schon tot, als Bianca seine Geliebte wurde. Diese beiden Frauen hatte er tatsächlich geliebt, von Herzen, mit ganzer Seele, wie man so sagt, denn Friedrich war zu der Erkenntnis gelangt, dass es eine unsterbliche Seele nicht gab. Das behielt er für sich. Als Kaiser sah er sich manchmal veranlasst, etwas anzuordnen, woran er nicht glaubte. Er hatte die Ketzergesetze unterschrieben, obwohl es ihm persönlich völlig gleichgültig war, woran ein Mensch glaubte. Dem Kaiser aber durfte es nicht gleichgültig sein, denn er war der oberste Herr eines christlichen Landes und als solcher musste er Häretiker verfolgen. Sein Sohn Heinrich mochte das nicht einsehen und missachtete als deutscher König die von seinem Vater unterschriebenen Ketzergesetze. Das führte zu seinem Untergang. Friedrich schob diesen Gedanken beiseite, nicht, weil die Erinnerung an den verräterischen Sohn ihn quälte, sondern weil er dieses Kapitel ein für alle Mal abgeschlossen hatte. Auch diesen Sohn hatte er geliebt und seinen Tod als elender Gefangener bedauert, sogar beweint.
Da war noch die Frage offen – Bianca hatte sie gestellt –, welche seiner drei Gemahlinnen ihm die liebste gewesen sei. Er schaute Bianca in die wie dunkler Bernstein leuchtenden Augen. Eigentlich, so sagte er, wolltest du ja fragen, ob ich eine von ihnen geliebt habe. Nein, das habe ich nicht, aber Isabella von England ist mir in ihrer stolzen, fröhlichen Art die liebste gewesen. Bianca runzelte die Stirn. Aber weggesperrt hast du sie wie alle anderen, mein Falke. Niemand hätte so reden dürfen, nur sie, die Einzige, durfte es. Nur ihretwegen, so dachte Friedrich, hatte ich mir gewünscht, eine unsterbliche Seele zu besitzen, um mich im Jenseits mit der ihren zu vereinigen.
Schon länger hatten Zuträger ihm vom Minoritenmönch Salimbene von Parma berichtet, der an einer Chronik über Friedrichs Regentschaft arbeitete und bei jeder passenden Gelegenheit daraus zitierte. Ezzelino da Romano, sein raubeiniger, jähzorniger und rachsüchtig-grausamer Schwiegersohn, Herr über Verona, Vicenza, Padua und andere oberitalische Städte, hätte dem Mönchlein längst den Garaus gemacht, doch vor Klostermauern schreckte auch er zurück. So durfte Salimbene ungestraft verkünden: „Friedrich suchte jede Stelle auf, die er selbst oder seine Gelehrten in der Hl. Schrift finden konnten, wenn sie nur dem Beweis diente, dass es nach dem Tod kein zweites Leben gebe.“
Ein Lächeln flog über Friedrichs ausgezehrtes Gesicht. Als ob es da Beweise brauchte! Wer es nicht selber spürt, wird nach dem Tod überrascht sein, dass da nichts ist. Sofort verbannte er diese absurden Gedanken. Wenn da nichts ist, kann es keine Überraschung geben …
Als Magister Johannes nach ihm sehen wollte, war Friedrich eingeschlafen. Die Tagträume hatten ihn so geschwächt, dass keine Traumbilder seinen totenähnlichen Schlaf unterbrachen.
Der Kaiser erwachte bei Tagesanbruch. Ein trübes Dämmerlicht lag in dem Raum wie grauer Nebel, aus dem nun das liebliche Oval eines Frauengesichts auftauchte.
„Bianca“, flüsterte er, „du bist also gekommen …“
„Ich bin es, Vater, Violante.“
Friedrich lächelte. „Ach, Tochter, mit mir geht es zu Ende …“
Sie beugte sich tiefer und strich ihm das schweißfeuchte Haar aus der Stirn.
„Magister Johannes ist ganz und gar nicht Eurer Meinung. Er sagt sogar, es wäre an der Zeit, dass Ihr wieder eine Kleinigkeit …“
Friedrich schüttelte den Kopf, so gut das im Liegen ging.
„Nein, es ist Zeit für geistige Nahrung. Ich möchte heute beichten und das Abendmahl nehmen.“
Sie lächelte auf eine Art, wie er sie nur von Bianca kannte.
„Das kann nicht schaden und wird Eure Genesung fördern.“
Er hatte Violante als Vierzehnjährige dem Grafen Richard von Caserta zur Frau gegeben, dessen kriegerischer Sinn mit Klugheit und Umsicht gepaart war. Er war es, der die elende Verschwörung des Jakob von Morra aufgedeckt hatte. Das Ziel war, den Kaiser, seinen Sohn Enzio und Ezzelino da Romano bei einem Festmahl zu ermorden. Ein ungeheuerlicher Plan, der ihn tief getroffen hatte, denn außer diesem Jakob war noch eine Reihe von Männern beteiligt, an deren Treue er niemals gezweifelt hätte.
Er winkte Violante, sich tiefer zu beugen.
„Weißt du, dass ich einmal von deiner Mutter verlangt habe, für mich zu tanzen?“
„Nein …“
„Ich habe ihr dazu ein paar Kastagnetten geschenkt. Sie sollte tanzen wie … wie …“ Er schloss die Augen und flüsterte kaum hörbar: „Geh jetzt, Violante.“
Drei Kinder hatte Bianca ihm geboren. Zuerst Costanza, bei der die Natur wohl unentschlossen war, wem sie gleichen sollte. Aus Biancas Bernsteinaugen und seinen leuchtend blauen war ein unentschlossenes Graubraun geworden und sie hatte sein kräftiges Kinn geerbt – nein, eine Schönheit war nicht aus ihr geworden. Sie hatte es am weitesten gebracht, denn vor sechs Jahren war sie die Frau des Kaisers Johannes von Nikaia geworden. Michael Scotus hatte es prophezeit …
Dann kam Manfred, ein rechtes Vaterkind. Schön wie ein Apoll wuchs er heran, von edler Gestalt, dunkelblond mit großen blaugrauen Augen. Wo ist er jetzt? Er muss doch im Haus sein … Steckt wohl wieder mit dem Medicus zusammen und wacht über meine Gesundheit …
Aus Violante aber, dem dritten Kind, wurde ein Abbild Biancas. Das dunkle Haar, die Bernsteinaugen, das liebliche Oval des Gesichtes und die zierliche Gestalt – ja, Richard von Caserta wusste, was er an ihr hatte, und lohnte es mit unerschütterlicher Treue.
Warum willst du beichten, Kaiser Friedrich? Das Zimmer war leer, die Wachen standen draußen – woher kam die Frage? Hatte er sie selber gestellt? Wieder zischelte es ihm ins Ohr: Du glaubst weder an Gott noch an eine unsterbliche Seele, brauchst weder eine Strafe zu fürchten, noch einen Lohn zu erwarten. Sollte er darauf antworten? Die Frage war ja nur gewesen, warum er beichten wollte. Ich werde beichten, um der Welt ein Beispiel zu geben. Es käme vieles in Unordnung, wenn das Volk erführe, der Kaiser sei als verstockter Sünder gestorben. Kaiser bin und bleibe ich, auch im Sterben, auch im Tod, auch danach in dem von vier Löwen getragenen Sarg aus Porphyr im Dom zu Palermo. Der auf mich wartet. Kaiser in Ewigkeit.
Friedrich schloss die Augen und glitt in einen Traum hinein. Der führte ihn nach Aachen in die Pfalzkapelle des großen Karl auf die sechs Stufen zum Marmorthron des fränkischen Kaisers. Erzbischof Siegfried von Mainz setzte ihm die deutsche Krone auf, überreichte ihm Szepter und Schwert. Da war er zwanzig Jahre alt und schwebte wie auf Wolken, war in einer Hochstimmung, die sich dem ganzen Körper mitteilte, die seine Testes so anschwellen ließ, dass er darauf achten musste, nicht mit gespreizten Beinen zu gehen, als trage er eine Last zwischen den Schenkeln. Seine Gemahlin Konstanze war auf dem Weg in die deutschen Lande, doch das würde noch viele Wochen dauern. So lange konnte und wollte er nicht warten, aber als deutscher König musste er einige Rücksichten nehmen. Da gab es nun nach seiner Krönung mehrere rangmäßig gestufte Bankette: eines für den Hochadel und hohe Geistliche, eines für die Stadtväter und Zunftmeister von Aachen und eines für solche, die sich um den König verdient gemacht hatten. Darunter war auch ein Herr von Urslingen, aus dessen Familie ein Zweig mit Friedrichs Vater, dem Kaiser Heinrich, nach Sizilien gekommen war. Bei der Huldigung kniete neben dem rauschebärtigen Urslinger seine Tochter.
„Meine Gemahlin ist kürzlich verstorben, Majestät, und so habe ich meine Tochter Adelheid …“
Nach drei Jahren auf deutschem Boden hatte sich Friedrich so viel von der Landessprache angeeignet, dass er das meiste verstand und einfache Reden führen konnte.
„Euer Besuch ehrt Uns, Fräulein Adelheid.“
Das Mädchen senkte die Augen und errötete.
„Sie ist es noch nicht gewohnt, Majestät, vor so vielen Menschen …“
Friedrich sah nur sie, die Stimme ihres Vaters rauschte an ihm vorbei, er nahm sie kaum wahr. Blond war sie, mit Augen wie graue Rheinkiesel, groß, etwas üppig – ein Bild strotzender Weiblichkeit.
Friedrich wandte sich an ihren Vater.
„Meine Gemahlin wird in Kürze eintreffen und neben ihren sizilischen auch deutsche Hofdamen benötigen. Eure Tochter fände ich dazu sehr geeignet.“
Der brave Urslinger kam ins Stottern.
„Aber Ma-Majestät … das ist … ist eine gro-große Ehre …“
Dann sprang der Traum weiter, mitten hinein in Friedrichs dormitorio, wo er mit Fräulein Adelheid – er nannte sie Adelaide – im Bett lag. Es war, als hätte man bei einem Buch die mittleren Seiten herausgerissen. Zwischen ihrer ersten Begegnung und der Bettszene musste doch einiges geschehen sein? Doch ein Traum fragt nicht danach, er gehorcht seinen eigenen rätselhaften Gesetzen.
Es war ein rechter Kampf, der sich da im zerwühlten Bett abspielte, denn Adelaide legte sich nicht hin und spreizte ergeben die Beine wie später seine allzeit willigen Haremsdamen. Sie presste die üppigen Schenkel zusammen und verdeckte mit den Händen ihre nicht weniger üppige Brust. Niemals wäre es Friedrich in den Sinn gekommen, eine Frau mit Gewalt zu nehmen – damals nicht und auch nicht später. Er stieg aus dem Bett, wies auf seinen wie eine Lanze aufgerichteten Phallus und sagte:
„Was machen wir mit dem da? Er lässt mir keine Ruhe, er zielt auf Eure Leibesmitte, dolce Adelaide, ich kann ihm zureden, so viel ich will, er ist störrisch und lässt sich nicht belehren.“
Da musste Adelheid leise lachen, und um dies schicklich zu verbergen, nahm sie ihre rechte Hand von ihrer linken Brust und hielt sie vor den Mund. Friedrich tat, als bemerke er es nicht, hob die Hände und stimmte ein sizilisches Liebeslied an:
„Wer hat Augen, wie diese so schön
solch Lächeln um einen Mund gesehn.
Einen Leib, so verlockend und süß
doch verschlossen ist die Pforte zum Paradies …“
Der Kaiser erwachte und spürte am Geschlecht, wie ihn der Traum erregt hatte. Es dauerte noch eine Weile, bis Adelheid sich ihm – zögerlich zuerst, dann aber recht heftig – hingab. Aber wo waren die fehlenden Seiten dieser Geschichte geblieben? Schließlich hatte er Adelheid nicht vom Bankett gleich in seine Schlafkammer geführt.
Friedrich fühlte sich todesmatt; der Traum hatte ihn so erschöpft, als hätte er tatsächlich einer Frau beigelegen. Natürlich hatte er dem Ritter von Urslingen nicht die ganze Wahrheit gesagt, denn seine Gemahlin war nicht „in Kürze“ zu erwarten, sondern es dauerte bis zum Herbst des nächsten Jahres. Zudem war an „deutschen Hofdamen“ kein Bedarf, denn Konstanze von Aragon war eine stolze Spanierin, auch als Frau des Königs von Sizilien misstraute sie allen Deutschen. Sie hatte Friedrich dringend abgeraten, sich die deutsche Krone zu holen, und wenn es nach ihr gegangen wäre, säße Otto der Welf weiterhin unbehelligt auf dem deutschen Königsthron – den Segen des Papstes hatte er damals ohnehin.
Es war nicht, was man „Liebe auf den ersten Blick“ nennt, denn sein erstes und mächtigstes Verlangen war rein animalisch – er wollte sich mit diesem verlockenden Weibwesen paaren – endlos, heftig, immer wieder, tage- und nächtelang.
Der Ritter von Urslingen muss dann schon bald erfahren haben, dass an deutschen Hofdamen kein Bedarf bestand und Adelheid zur Geliebten des jungen deutschen Königs geworden war. Aber die Umstände machten es ihm leicht. Da fast alle Reichsfürsten – und damit ihre Lehnsmänner – von dem jungen Staufer begeistert waren, gaben sie dem Ritter von Urslingen zu verstehen, dass es eine hohe Ehre sei, wenn der deutsche König und künftige Kaiser das Fräulein Adelheid quasi zur linken Hand als zweite Ehefrau ansehe.
So war es ja tatsächlich und bei der Ankunft seiner Gemahlin im Herbst des nächsten Jahres war Adelheid auf die Burg ihres Vaters zurückgegangen und hütete dort ihr Söhnchen Enzio. Der süße kleine Blondschopf war neun Monate nach Friedrichs jetzt nachgeträumter Liebesnacht geboren worden. Damals hatte sich Friedrich die Fantasie und dichterische Kraft der großen deutschen Minnesänger gewünscht, deren Lieder er kannte. In königlicher Sorglosigkeit – wer hätte es ihm verbieten sollen? – wandelte er ein Lied des Walther von der Vogelweide etwas ab, ließ es mit kunstvollen Initialen auf ein Pergament bringen, das er um einen Rubinring verschnürte und der noch Schlafenden aufs Bett legte.
Herzensliebste Adelheid
Gott geb dir heut und ewig Heil!
Könnt ich schönern Preis dir leihn,
so würd dir gern auch das zuteil.
Doch hab ich Besseres für dich:
Keiner liebt dich mehr als ich!
Noch von manchem anderen Lied hatte Friedrich sich inspirieren lassen und er folgte – nobel, wie er stets war – des Vogelweides Bitte:
Schirmvogt von Rom, Apuliens König, hab Erbarmen,
lasst mich, der reich an Kunst, nicht so verarmen:
gern möchte ich, könnt es sein, am eigenen Herd erwarmen.
Der Kaiser ließ dem Sänger ein Lehen in Würzburg überschreiben – das Danklied dafür erreichte ihn unterwegs nach Rom.
Ich hab mein Lehen – alle Welt! Ich hab mein Lehen!
Nun fürcht ich nicht den Winter an den Zehen,
will nicht mehr viel von kargen Herrn erflehn!
Andere erzeigten sich weniger dankbar …
„Was ist?“
Der Medicus beugte sich über ihn.
„Majestät, Ihr habt den Wunsch geäußert, eine Beichte abzulegen – seid Ihr dazu jetzt kräftig genug?“
Über die Schulter des Arztes blickte der Erzbischof und die Augen in seinem faltigen Greisengesicht leuchteten vor Güte und Zuneigung.
„Ja – nein, schieben wir es ein wenig auf … Mein Geist ist so müde …“
Die Herren verneigten sich und Manfred kam ans Bett, stand da in der kraftvollen Jugendfrische seiner achtzehn Jahre.
„Vater, kann ich etwas für Euch tun?“
Laut tönte die helle Stimme, aus dem Gesicht, das dem des Vaters so sehr ähnelte, blickten ihn klare, blau-graue Augen besorgt an. Vor Rührung spürte der Kaiser seine Augen feucht werden.
„Ja, das kannst du, mein Sohn. Sei dem Volk von Sizilien ein guter Herrscher!“
Manfreds Gesicht zeigte Sorge und Bestürzung.
„Aber Vater, Ihr seid doch auf dem Weg der Besserung. Magister Johannes hat gesagt …“
„Der Medicus schließt aus dem, was er sieht oder zu sehen glaubt, aber er steckt nicht in meiner Haut. Der Tod wartet draußen vor der Tür – wenn du ihn beim Hinausgehen siehst, grüße ihn vom Kaiser und sage ihm, er fürchte ihn nicht!“
Mit letzter Kraft hatte Friedrich diesen Satz hervorgestoßen, dann wandte er sich ab und flüsterte: „Geh jetzt, Manfred, komme später wieder.“
Ein Problem gab es für Friedrich noch zu lösen oder, besser gesagt, eine Frage harrte noch ihrer Antwort. Was unterschied die beiden einzigen Frauen, die er jemals geliebt hatte, voneinander? Da drängte sich eine zweite Frage auf: Hätte Adelaide noch gelebt, als er auf dem – gescheiterten – Hoftag zu Cremona Bianca kennenlernte, wäre es dann zu einer näheren Beziehung gekommen? Adelheid wäre dann vielleicht sogar in seinem Gefolge gewesen, wie ihr damals zehnjähriger Sohn Enzio … Kann ein Mann zwei Frauen mit gleicher Kraft und Hingabe lieben? Andere können es vielleicht – ich könnte es nicht. Wäre Adelheid am Leben geblieben, hätte sie mir weitere Kinder geboren und mein Lieblingssohn Manfred hieße vielleicht Bernardo oder Arnoldo. Müßige Gedanken! Friedrich schalt sich einen Grübler, der sinnlosen Überlegungen nachhängt.
Blieb noch die Frage, was die beiden Frauen so unterschiedlich machte, denn innerlich wie äußerlich bildeten sie Gegensätze. Adelaide war knapp eine Handbreit größer als er, strohblond, grauäugig, mit einem runden, pausbäckigen Gesicht. Üppige Schenkel, üppige Brüste – das Urbild einer Frau. Vom Wesen her war sie etwas schweigsam, nachdenklich, sorgsam wägend, in ihrer Liebe zu ihm unerschütterlich – übrigens die einzige Eigenschaft, die beide gemeinsam besaßen.
Bianca hingegen war zierlich, eine Handbreit kleiner als er, mit tiefbraunem Haar, einem ovalen Gesicht und Augen von der Farbe dunklen Bernsteins. Ihre Brüste waren klein und fest, ihre Hüften so schmal, dass die Wehmuttter jedes Mal, wenn eine Geburt bevorstand, besorgt die Stirn runzelte. Aber immer ging es gut. Vom Wesen her war sie redselig, lachte viel und fasste spontane Entschlüsse. Über Gott und die Welt dachten sie beide recht ähnlich. Aber, so fragte sich der Kaiser, Frauen von der Art einer Adelheid oder einer Bianca gibt es viele. Warum ist meine Liebe nach Adelheids Tod nicht auf eine ihr ähnliche Frau gefallen? Weil es etwas geben muss, das uns über die äußere Erscheinung hinaus an einen Menschen fesselt. Was das genau ist, wird man wohl niemals herausfinden.
Enzio war drei Jahre alt, da wollte Friedrich seine geliebte Adelheid nach Würzburg kommen lassen – das war im Mai 1219 –, um sie und den Sohn mit nach Süden zu nehmen. Aber es kam anders. Zu dieser Zeit grassierte am Rhein die Blatternseuche, an der Adelheid und ihr Vater starben. Die Amme hatte das Kind rechtzeitig aufs Land bringen lassen und sie war es nun, die Enzio seinem Vater übergab.
Adelheid und Friedrich, sie hatten einander nicht lange gehabt – von Juli 1215 bis Februar 1216. Widerwillig entließ er die Hochschwangere zu ihrem Vater, doch sie wollte ihr Kind zuhause gebären. Acht Monate waren sie ein Paar, eine kurze Zeit, zugleich aber auch eine lange. Kaum ein Tag verging, da sie sich nicht sahen, das war mehr Zeit, als er mit seinen Ehefrauen Jolanda und Isabella verbracht hatte. Enzio war von nun an immer dabei – sein liebstes Kind, bis Manfred kam, doch Friedrichs Vaterliebe reichte für beide.
Wie mochte es Enzio jetzt gehen? Er hatte ihn vor sieben Jahren zum König von Sardinien gemacht, nachdem er eine sardische Fürstin geheiratet hatte. Die war dann zu Kreuze gekrochen und hatte ihre Ehe vom Papst annulieren lassen, denn dieser betrachtete Sardinien als Lehen der Kirche. Enzio aber hatte sich in den lombardischen Kriegen stets bewährt, bis der dunkle Tag bei Fossalta kam und er in bolognesische Gefangenschaft geriet. Das war vor über einem Jahr geschehen und nichts hatte die stolze Stadt bewegen können, Enzio wieder herauszugeben. Friedrich hatte es ein paarmal erleben müssen, dass sein Kaiserwort an den Mauern der reichen und wohlgesicherten Städte zerschellte.
Er schlief ein und als er am späten Nachmittag erwachte, schien draußen eine fahle Wintersonne, die Steineiche bewegte nur leicht ihre dunklen, vor Nässe glänzenden Blätter. Friedrich fühlte sich kräftig und ausgeruht. Fast hätte er sich von seinem Zustand täuschen lassen, doch er wusste, dass der Tod draußen vor der Tür nach wie vor geduldig auf seine Stunde wartete. Er ließ den Erzbischof rufen, der sich unter dem üblichen Schnaufen und Ächzen auf einen Hocker sinken ließ.
„Bist du bereit, mein Sohn?“
Friedrich nickte und Don Berardo winkte seinen Begleiter, einen Hofkaplan, hinaus.
„Was soll ich beichten, Eminenz? Ich habe immer nur nach den Geboten des mir von Gott verliehenen Kaiseramtes gehandelt, habe manches für die Kirche, auch gegen meine Überzeugung getan. Dass dabei einiges Unrecht geschehen ist, habe ich zu verantworten und ich bereue es.“
„Nicht selten hast du überaus grausam gehandelt und du weißt es. Verrat gehört mit dem Tode bestraft, aber müssen sich die Qualen über Wochen und Monate hinziehen? Auch einem Verräter muss letztlich verziehen werden, das verlangt unser christlicher Glaube.“
„Ja, Eminenz, aber ein Kaiser – auch ein christlicher – muss nach anderen Gesetzen handeln als ein Privatmann. Was der Kaiser tut, geschieht vor den Augen der ganzen Welt, wird dadurch exemplarisch. Verrat verzeihen, hieße aus einer schweren Sünde gegen Gott und die Obrigkeit ein leichtes Vergehen machen.“
Der Erzbischof hob unwillig seine weißen, buschigen Brauen. „Du sollst mich weder belehren, noch mit mir diskutieren, sondern in Demut und Reue deine Sünden bekennen!“
„Ja, Eminenz. Wenn ich es recht bedenke, habe ich gegen alle zehn Gebote Gottes verstoßen – ausgenommen vielleicht das vierte. An meinen Vater habe ich keine Erinnerung und meine Mutter starb, als ich vier Jahre alt war.“
„Das weiß ich so gut wie du. Ich halte dir deine Leibesschwäche zugute und werde dir die Absolution erteilen.“
Als das geschehen war, fragte der Kaiser: „Eminenz, wäre es eine große Sünde, wenn eine Frau zu mir ins Bett käme?“
Der Erzbischof brachte ein Lächeln zustande. „Was könntest du in deinem Zustand mit ihr anfangen?“
„Sie an mich drücken, mich an ihrem Leib erwärmen. Vielleicht würde es die Genesung, von der unser Medicus spricht, beschleunigen?“
„Dass du schon wieder zum Scherzen aufgelegt bist, ist ein gutes Zeichen.“
Auch als Adelheid schwanger war, ließen sie nicht voneinander. Die Ansichten der Medici gingen da ziemlich auseinander. Einige meinten, es gäbe nur sehr wenig, was dem Kind im Mutterleib schaden könne, und führten Beispiele an: lange, scharfe Ritte, schwere Stürze, Vergiftungen und manches mehr, das dem Körper der Mutter stark zugesetzt hatte, und trotzdem sei die Geburt normal verlaufen. Andere wieder wandten ein, dass die heranwachsende Leibesfrucht gegen den eindringenden väterlichen Samen zu kämpfen habe und dadurch geschwächt werde. Adelheid kümmerte das nicht und als ihr Bauch am Ende des siebten Monats dem Liebesverkehr hinderlich wurde, durfte Friedrich sie von hinten nehmen. „Was den Tieren recht ist, kann den Menschen nur billig sein“, scherzte er und meinte, nur der Verstand unterscheide uns von anderen Warmblütern. Wie gerne hätte Friedrich seinem Sohn Enzio erzählt, dass er zu Lebzeiten seiner Mutter zwar anderen Frauen beigelegen, aber nur sie geliebt habe.
Als Manfred gegen Abend erschien, fasste der Kaiser seine feste, jugendwarme Hand.
„Eines musst du mir versprechen, mein Sohn: Bemühe dich weiter, deinen Bruder Enzio frei zu bekommen – mit allen Kräften, hörst du? Biete ihnen Geld, Verträge, Privilegien, tue alles nur Menschenmögliche, um Enzio zu befreien!“
Manfred versprach es, beschwor es.
„Decembris tertius decimus“, sagte der Scriptor auf des Kaisers Frage.
„Warum soll diese Zahl Unglück bringen? Weißt du das?“
Der Schreiber, ein junger Mann, diente dem Kaiser noch nicht lange und erstarrte jedes Mal vor Ehrfurcht, wenn er angeredet wurde.
„N-nein, Majestät, das weiß ich nicht, a-alle halten die Dreizehn für – für eine Un-Unglückszahl …“
„Selbst wenn die ganze Menschheit dieser Meinung ist, so muss sie dennoch nicht richtig sein.“
Der Scriptor nickte eifrig. „Wie recht Eure Majestät haben!“
„Trotzdem erkläre ich es dir. Die Dreizehn wird als Unglückszahl verstanden, weil man die Zwölf für heilig hält: Jakobs zwölf Söhne, die zwölf Apostel und so fort. So glaubt man, etwa, dass, wenn dreizehn Menschen bei einem Mahl zusammensitzen, einer von ihnen binnen Jahresfrist sterben muss, um die heilige Zwölfzahl wiederherzustellen.“
Der Scriptor wollte etwas sagen, doch der Kaiser kam ihm zuvor.
„Es gibt jetzt Wichtigeres, ich brauche meine Freunde und Verwandten als Zeugen, sie sollen sich hier versammeln!“
Da sie alle im Haus weilten, dauerte es nicht lange und sie standen um sein Bett. Dem Kaiser am nächsten Prinz Manfred, daneben sitzend der greise Erzbischof, dann Medicus Johannes, Richard von Caserta mit Violante, dazu einige hohe kaiserliche Beamte. Der junge Schreiber stand am Fußende des Bettes vor einem Stehpult. Friedrich hob die Hand, der Scriptor tauchte seine Feder ein.
„Im Hinblick auf die Vergänglichkeit des Menschen wollen Wir, Friedrich, von Gottes Gnaden immer erhabener Kaiser der Römer, König von Jerusalem und Sizilien, für das Heil Unserer Seele sorgen und über Reich und Länder verfügen, da Uns das Ende des Lebens bevorsteht, in vollem Besitz der Sprache und des Denkvermögens, krank am Körper, aber bei klarem Verstande, auf dass Wir noch zu leben scheinen, auch wenn Wir dem irdischen Leben entrückt sind.“
Sein Erbe aber verteilte der Kaiser nach Rang und Gesetz, nicht nach persönlicher Neigung, denn sonst hätte Manfred alles erhalten. Jolandas Sohn Konrad – sie war bei seiner Geburt gestorben – war schon seit Jahren deutscher König und bekam nun Sizilien übertragen, würde er ohne Söhne sterben, sollte Manfred der Nachfolger sein. Der Kaiser wies mit zittriger Hand auf seinen Lieblingssohn.
„Da Konrad kaum nach Sizilien kommen wird, sollst du dort Statthalter sein.“
Als der Scriptor gegangen war, ließ Friedrich sich vor aller Augen das graue Habit der Zisterzienser anlegen, deren drittem Orden er seit seiner Krönung angehörte. Dann sprach der Erzbischof ein kurzes Gebet und ging mit den anderen hinaus. Nur Manfred durfte bleiben. Friedrich tätschelte die Hand seines Lieblings.
„Weißt du, was mich besonders freut?“
Manfred schüttelte betrübt den Kopf. Er ahnte, dass sein Vater im Sterben lag, stemmte sich aber mit aller Kraft gegen diese Vorstellung. Kaiser Friedrich doch nicht! Stupor mundi – das Staunen der Welt! Ein Gigant! Ein Ausbund an Macht und Wissen!
Da hörte er die leise Stimme seines Vaters und beugte sich tiefer.
„De arte venandi cum avibus – unser Buch! Es ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden …“
„Euer Buch, Vater! Mein Anteil daran war gering.“
„Es war deine Anregung, es zu schreiben – ohne dein Drängen wäre es wohl nicht entstanden.“
Was redete der Vater jetzt von dem Falkenbuch? Es gab doch viel Wichtigeres!
„Vater, ich danke Euch für das Erbe, aber ich werde es nicht antreten können, da ich kein legitimer Sohn bin.“
Der Kaiser lächelte und zwinkerte dabei mit den Augen.
„Öffne die Truhe am Fenster. Hinter anderen Papieren findest du eine gesiegelte und in Purpur eingeschlagene Rolle.“
Manfred folgte der Aufforderung, fand das Gesuchte und brachte es ans Bett.
„Verwahre es gut und öffne es gleich nach meinem Tod. Lass mich ein wenig schlafen, aber bleibe bei mir.“
Manfred nickte und ließ den Vater nicht aus den Augen. Später kam der Arzt Johannes von Procida herein und fragte leise:
„Wie geht es ihm?“
„Er schläft …“
„Ruft mich sofort, wenn er aufwacht.“
Manfred nickte und stellte etwa um die Mittagszeit fest, dass die Atemzüge des Kaisers mühsamer wurden, in ein rasselndes Keuchen übergingen. Er griff nach der Hand seines Vaters, die sich eiskalt anfühlte. Behutsam versuchte er, sie warm zu reiben, spürte einen leisen Gegendruck.
Friedrich öffnete kurz die Augen und sagte laut und deutlich: „Es gibt nur sie – die Einzige!“
Dann verstummte das Keuchen und der Kaiser lag mit offenen Augen da – leise lächelnd.
Als Manfred dem Erzbischof von den letzten Worten seines Vaters berichtete, sagte Berardo von Palermo: „Damit war gewiss die Kirche gemeint, mit der er sich sterbend versöhnt hat.“
Manfred aber wusste es besser, denn er war einige Male Zeuge gewesen, als sein Vater den Kosenamen „Unica“ für die Mutter benutzte. Als er den Purpurstoff öffnete, fand er ein gesiegeltes und von drei Zeugen unterzeichnetes Dokument. Er las es und brach in Tränen aus.