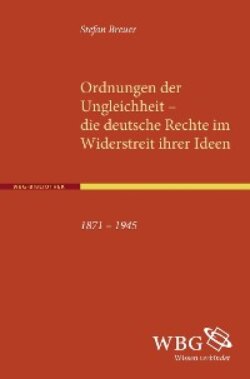Читать книгу Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945 - Stefan Breuer - Страница 26
Nationalismus und Nation I: Alter Nationalismus
ОглавлениеNationsbegriffe werden interessant, wenn mit ihnen Politik gemacht wird. Das muß nicht notwendig rechte Politik sein, denn man kann sich auf die Nation auch beziehen, ohne damit auf Ordnungen der Ungleichheit zu zielen. Wenn aber die Nation im Zeichen der Rechten angerufen wird, haben wir es mit Nationalismus zu tun, und das bedeutet: Wir können die Analyse auf die Haupttypen des Nationalismus beschränken und außer acht lassen, wie sich Neoaristokraten, planetarische Imperialisten oder ästhetische Fundamentalisten zur Nation stellen.
Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationsbegriffen und den Typen des Nationalismus sind alles andere als einfach. Wenig hilfreich ist die forciert vorgetragene These Gellners, es sei der Nationalismus, der die Nation hervorbringe (Gellner 1991, 87). Nationalismus ist eine besonders hochgespannte Form des Nationalbewußtseins und setzt damit ein bestimmtes Verständnis dessen, was die Nation sei und wer zu ihr gehört, voraus. Andererseits ist Gellner zuzugeben, daß der Nationalismus nicht einfach die Aktualisierung eines je schon vorhandenen, eindeutigen Nationsverständnisses ist, sondern mehr: ein Effekt der Prozesse funktionaler Differenzierung und Rationalisierung, die zur Formierung anonymer, unpersönlicher Regionalgesellschaften mit spezialisierter und standardisierter Ausbildung sowie einem einheitlichen Idiom führen (89). Da diese Prozesse nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern in historischen Milieus, die nicht zuletzt durch die Existenz von Staaten und deren Wechsel-Wirkung geprägt sind, ist es wenig wahrscheinlich, daß einem Typ des Nationalismus immer nur ein einziger Nationsbegriff entspricht: das hieße eine Starrheit und Inflexibilität der Selbst- und Fremdbeobachtungen annehmen, die ganz unrealistisch ist. Wahrscheinlicher ist die Annahme, daß auch und gerade in Nationalismen – in Bewegungen also, die für die eigene Nation den Rang eines höchsten Wertes beanspruchen – darüber gestritten wird, von welchen Kriterien die Zugehörigkeit zur Nation abhängig sein soll, anders gesagt: welcher Nationsbegriff und welcher Aspekt desselben als grundlegend anzusehen ist, und darüber hinaus: welche Rechte den Mitgliedern der Nation in welchem Umfang zugeteilt werden sollen. Ein Blick auf die verschiedenen Nationalismen in Deutschland bestätigt diese These.
Der alte Nationalismus bevorzugte zunächst das holistisch-territoriale Konzept, verband aber die Inklusion in die politische Ordnung mit einer Abstufung der Teilhaberechte, für deren Legitimation auf ständische und quasiständische Kriterien zurückgegriffen wurde. Die Passivbürgerschaft im Reich sollte allen Mitgliedern der Einzelstaaten zukommen, die Aktivbürgerschaft aber (also vor allem: das Wahlrecht) nur den besitzenden und gebildeten Schichten, und davon auch nur: dem männlichen Teil. Beide Präferenzen gerieten jedoch schon bald unter Druck. Gegen den auf Exklusion zielenden Teil des Programms richtete sich der Protest der Arbeiter- und Frauenbewegung, der bis in den Liberalismus hinein Resonanz fand; gegen die auf Inklusion gerichteten Aspekte der Widerstand der ethnischen Minoritäten, der besonders in den von Preußen annektierten polnischen Gebieten kontinuierlich an Stärke gewann: immerhin war jeder zehnte Preuße ein Pole (Wehler 1995, 961).
Erhebliche Probleme für die Schaffung einer homogenen Staatsnation ergaben sich außerdem aus der zunehmenden Bevölkerungsfluktuation: Von der Gründung des Norddeutschen Bundes bis 1914 verließen rund 3, 3 Millionen Auswanderer Deutschland, während sich die Zahl der Ausländer in Deutschland von 1871 bis 1910 verfünffachte (545). Besonders zugespitzt war die Lage in den ostelbischen Gebieten, die eine steigende (natürlich auch binnendeutsche) Abwanderung von Deutschen und ein stetiges Wachstum des polnischen Bevölkerungsanteils verzeichneten. Max Weber sprach damals für viele Liberale, als er die Gefahr einer „Polonisierung des Ostens“ beschwor und konstatierte: „Wir werden im Osten denationalisiert, und das ist keineswegs eine bloße Nationalitätensorge, sondern das bedeutet: es wird unser Kulturniveau, der Nahrungsstand der Landbevölkerung und ihre Bedürfnisse herabgedrückt auf das Niveau einer tieferen, östlicheren Kulturstufe“ (MWG I/4.1, 176).
Die Geschichte des Scheiterns aller Bemühungen, insbesondere von Seiten der preußischen Regierung, dieser Entwicklung entgegenzusteuern und die Minoritäten durch eine Verschärfung der Sprachenpolitik zur Assimilierung zu zwingen, kann in den einschlägigen Werken der Historiker nachgelesen werden. Hier ist nur festzuhalten, daß sich seit der zweiten Hälfte der 1880er Jahre das Bewußtsein dieses Scheiterns in immer weiteren Kreisen durchsetzte und einen Politikwechsel von Assimilation zu Dissimilation begünstigte. Immer häufiger, schreibt Rogers Brubaker, „wurden die Polen im allgemeinen Denken, in der politischen Rhetorik, in Rechtstexten und administrativer Praxis von den anderen Bürgern des Reiches unterschieden. Die Wörter ‘national’ und ‘deutsch’ wurden seltener in ihrer umfassenden staats-nationalen und häufiger in ihrer die Unterschiede betonenden ethnisch-nationalen Bedeutung verwendet. Die Reichspolen – polnischsprachige Bürger des Reiches – wurden als Polen oder in vorsichtigeren Formulierungen in der Öffentlichkeit als ‘unsere polnischen Mitbürger’ bezeichnet, doch mit Sicherheit nicht einfach als Deutsche oder deutsche Staatsbürger; sie wurden als Reichsfeinde stigmatisiert, rechtlich und administrativ als Bürger zweiter Klasse behandelt“ (Brubaker 1994, 172).
Dieser Wandel läßt sich bei den Vertretern des alten Nationalismus gut verfolgen. Während sich etwa noch Friedrich Ratzel am Widerspruch zwischen dem grundsätzlich zu Expansion und Assimilation fähigen holistisch-territorialen und dem auf Segregation drängenden ethnisch-rassischen Nationsbegriff stieß und dies mit einer klaren Absage an Gobineau und Chamberlain verband,14 sahen andere Mitglieder des Alldeutschen Verbandes kein Problem darin, beide Karten zugleich auszuspielen. Ernst Hasse, auf dessen Rolle im Rahmen des Nationalimperialismus noch ausführlicher zurückzukommen sein wird (siehe unten im Fünften Kapitel), wollte nur noch einen Teil der ethnischen Minderheiten – die nach Westen gewanderten deutschen Staatsbürger polnischer Abstammung – ‘eindeutschen’, d.h. in die deutsche Volksnation aufnehmen. Für die im Osten lebenden preußischen Polen oder polnischen Preußen dagegen hielt er Assimilationsbemühungen für vergeblich. Germanisiert werden sollte allenfalls ihr Grundbesitz, und zwar durch massive Enteignungen, wie sie ab 1908 gesetzlich möglich wurden (Hasse 1905, 56ff.; 1907, 56). In den Alldeutschen Blättern konnte man 1899 einen Artikel lesen, der nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die staatsrechtliche Diskriminierung der ‘volksfremden Staatsbestandteile’ forderte: ihren Ausschluß vom aktiven und passiven Wahlrecht, ihre Gleichstellung mit Ausländern in bezug auf Versammlungs-, Presse- und Vereinswesen sowie hinsichtlich der Freizügigkeit (Alldeutscher Verband 1910, 61). Noch rabiater klang es bei Eduard von Hartmann, der davon sprach, „das Slaventhum in unsern Grenzen aus(zu)rotten“ (Hartmann 1889, 202). Das war, wie der Kontext zeigt, wahrscheinlich weniger wörtlich gemeint als der vorstehende Forderungskatalog, läßt aber einen Verbalradikalismus erkennen, der das Seine dazu beigetragen hat, Hemmschwellen abzubauen.
Konsequent durchgehalten wurde diese Hinwendung zum holistisch-ethnischen Nationsverständnis freilich nicht, wie sich am Verhältnis zu den außerhalb des Reiches lebenden Deutschen ablesen läßt. Bei allen Sympathiebekundungen für das Deutschtum in Österreich etwa wurde am Fortbestand der Donaumonarchie nicht gerüttelt und allenfalls ein engeres Bündnis verlangt (Alldeutscher Verband 1910, 96, 109). Das Deutsche Reich, so verkündete Heinrich Claß kategorisch, „hat ein höchstes Interesse daran, daß ein starkes, in sich gefestigtes Österreich als einheitlicher Staat besteht und erhalten bleibt; dies Interesse ist so groß, daß zur Erreichung des Zweckes dem Hause Habsburg sogar Waffenhilfe geleistet werden sollte“.15 Über der Volksnation standen auch bei den Alldeutschen noch immer der Staat und die auf ihn bezogene Staatsnation, so daß dem ethnisch begründeten Nationalirredentismus Grenzen gesetzt waren.