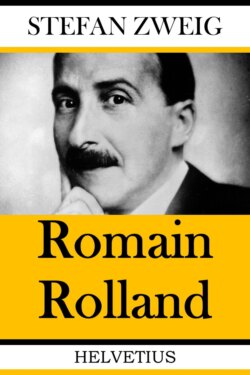Читать книгу Romain Rolland - Stefan Zweig - Страница 3
Lebensbildnis
Оглавление»Des Herzens Woge schäumte nicht
so schön empor und würde Geist,
wenn nicht der alte stumme Fels,
das Schicksal, ihr entgegenstünde.«
Hölderlin
Kunstwerk eines Lebens
Von dem Leben, das hier erzählt werden soll, stehen die ersten fünfzig Jahre ganz im Schatten einsam und namenlos erhobenen Werkes, die Jahre danach im Weltbrand leidenschaftlicher europäischer Diskussion. Kaum hat ein Künstler unserer Zeit unbekannter, unbelohnter, abseitiger gewirkt als Romain Rolland bis kurz vor dem apokalyptischen Jahr und gewiß keiner seitdem umstrittener: die Idee seiner Existenz wird eigentlich erst sichtbar im Augenblick, da sich alles feindlich verbündet, sie zu vernichten.
Aber dies ist des Schicksals Neigung, gerade den Großen ihr Leben in tragischen Formen zu gestalten. An den Stärksten erprobt es seine stärksten Kräfte, stellt steil den Widersinn der Geschehnisse gegen ihre Pläne, durchwirkt ihre Jahre mit geheimnisvollen Allegorien, hemmt ihre Wege, um sie im rechten zu bestärken. Es spielt mit ihnen, aber erhabenes Spiel: denn Erlebnis ist immer Gewinn. Den letzten Gewaltigen dieser Erde, Wagner, Nietzsche, Dostojewski, Tolstoi, Strindberg, ihnen allen hat das Schicksal zu ihren eigenen Kunstwerken noch jenes dramatischen Lebens gegeben.
Auch das Leben Romain Rollands versagt sich solcher Frage nicht. Es ist im doppelten Sinn heroisch, denn erst spät, von der Höhe der Vollendung gesehen, offenbart sich das Sinnvolle seines Baues. Langsam ist hier ein Werk gebildet, weil gegen große Gefahr, spät enthüllt, weil spät vollendet. Tief eingesenkt in den festen Grund des Wissens, dunkle Quadern einsamer Jahre als Fundament, trägt reiner Guß alles Menschlichen, im siebenfachen Feuer der Prüfung gehärtet, die erhobene Gestalt. Aber dank solchen Wurzelns in der Tiefe, der Wucht seiner moralischen Schwerkraft, kann gerade dies Werk dann unerschüttert bleiben im Weltensturme Europas, und indes die andern Standbilder, zu denen wir aufblickten, stürzen und sich neigen mit der wankenden Erde, steht es frei, »au dessus de la mêlée« , über dem Getümmel der Meinungen, ein Wahrzeichen für alle freien Seelen, ein tröstender Aufblick im Tumult der Zeit.
Kindheit
Romain Rolland ist in einem Kriegsjahr, dem Jahr von Sadowa, am 29. Januar 1866 geboren. Clamecy, schon die Vaterstadt eines anderen Dichters, Claude Tilliers (des Autors von »Mon oncle Benjamin« ), hat er zur Heimat, ein sonst unberühmtes Städtchen im Burgundischen, uralt und still geworden mit den Jahren, leise lebendig in behaglicher Heiterkeit. Die Familie Rolland ist dort altbürgerlich und angesehen, der Vater zählt als Notar zu den Honoratioren der Stadt, die Mutter, fromm und ernst, lebt seit dem tragischen und nie ganz verwundenen Verlust eines Töchterchens einzig der Erziehung zweier Kinder, des zarten Knaben und seiner jüngeren Schwester. Sturmlose, abgekühlte Atmosphäre geistiger Bürgerlichkeit umschließt den täglichen Lebenskreis; aber im Blute der Eltern begegnen einander noch nicht versöhnt uralte Gegensätze französischer Vergangenheit. Väterlicherseits sind Rollands Ahnen Kämpfer des Konvents, Fanatiker der Revolution, die sie mit ihrem Blute besiegelt haben; mütterlicherseits erbt er Jansenistengeist, Forschersinn von Port-Royal ; von beiden also gleiche Gläubigkeit zu gegensätzlichen Idealen. Und dieser jahrhundertealte urfranzösische Zwiespalt der Glaubensliebe und der Freiheitsideen, der Religion und der Revolution, blüht später fruchtbar in dem Künstler auf.
Von seiner ersten Kindheit, die im Schatten der Niederlage von 1870 wächst, hat Rolland einiges in »Antoinette« angedeutet: das stille Leben in der stillen Stadt. Sie wohnen in einem alten Hause am Ufer eines müde gewordenen Kanals; nicht aus dieser engen Welt aber kommen die ersten Entzückungen des trotz seiner körperlichen Zartheit so leidenschaftlichen Kindes. Aus unbekannter Ferne, unfaßbarer Vergangenheit, hebt ihn gewaltiger Aufschwung, früh entdeckt er sich, Sprache über den Sprachen, die erste große Botschaft der Seele: die Musik. Seine sorgliche Mutter unterrichtet ihn am Klavier, aus den Tönen baut sich unendliche Welt des Gefühls, früh schon die Grenzen der Nationen überwachsend. Denn indes der Schüler die verstandesklare Sphäre der französischen Klassiker neugierig und verlockt betritt, schwingt deutsche Musik in seine junge Seele. Er selbst hat es am schönsten erzählt, wie diese Botschaft zu ihm kam. »Es gab bei uns alte Hefte mit deutscher Musik. Deutscher? Wußte ich, was das Wort sagen wollte? In meiner Gegend hatte man, glaube ich, nie einen Menschen aus diesem Lande gesehen ... Ich öffnete die alten Hefte, buchstabierte sie tastend auf dem Klavier ... und diese kleinen Wasseradern, diese Bächlein von Musik, die mein Herz netzten, sogen sich ein, schienen in mir zu verschwinden wie das Regenwasser, das die gute Erde getrunken hat. Liebesseligkeit, Schmerzen, Wünsche, Träume von Mozart und Beethoven, ihr seid mir Fleisch geworden, ich habe euch mir einverleibt, ihr seid mein, ihr seid ich ... Was haben sie mir Gutes getan! Wenn ich als Kind krank war und zu sterben fürchtete, so wachte irgendeine Melodie von Mozart an meinem Kissen wie eine Geliebte ... Später in den Krisen des Zweifels und der Zernichtung hat eine Melodie von Beethoven (ich weiß sie noch gut) in mir die Funken des ewigen Lebens wieder erweckt ... In jedem Augenblick, wenn ich den Geist und das Herz verdorrt fühlte, habe ich mein Klavier nahe und bade in Musik.«
So früh hebt in dem Kinde die Kommunion mit der wortlosen Sprache der ganzen Menschheit an: schon ist die Enge der Stadt, der Provinz, der Nation und der Zeiten durch das verstehende Gefühl überwunden. Die Musik ist sein erstes Gebet an die dämonischen Mächte des Lebens, täglich in andern Formen wiederholt, und heute noch, nach einem halben Jahrhundert, sind die Wochen, sind die Tage selten, da er nicht Zwiesprache hält mit Beethovens Musik. Und auch der andere Heilige seiner Kindheit, Shakespeare, kommt aus der Ferne: mit seiner ersten Liebe ist der unbewußte Knabe schon jenseits der Nationen. In der alten Bibliothek, zwischen dem Gerümpel eines Dachstuhls, hat er die Lieferungen seiner Werke entdeckt, die sein Großvater als Student in Paris – es war die Zeit des jungen Victor Hugo und der Shakespearemanie – gekauft hatte und seitdem verstauben ließ. Ein Band verblichener Gravüren, »Galerie des Femmes de Shakespeare« , lockt mit fremd seltsamen, lieblichen Gesichtern und den zauberischen Namen Perdita, Imogen, Mirando die Neugier des Kindes. Aber bald entdeckt er sich lesend die Dramen selbst, wagt sich, für immer verloren, in das Dickicht der Geschehnisse und Gestalten. Stundenlang sitzt er in der Stille des einsamen Schuppens, wo nur manchmal unten aus dem Stalle der Hufschlag der Pferde oder vom Kanal vor dem Fenster das Rasseln einer Schiffskette herauftönt, sitzt, alles vergessend und selbst vergessen, in einem großen Fauteuil mit dem geliebten Buche, das wie jenes Prosperos alle Geister des Weltalls ihm dienstbar gemacht. Vor sich hat er in weitem Kreise Stühle mit unsichtbaren Zuhörern gestellt: sie sind ihm ein Wall seiner geistigen Welt gegen die wirkliche Welt.
Wie immer beginnt hier ein großes Leben mit großen Träumen. Am Gewaltigsten, an Shakespeare und Beethoven, entzündet sich seine erste Begeisterung, und dieser leidenschaftlich erhobene Blick zur Größe empor ist dem Jüngling, ist dem Mann von dem Kinde vererbt geblieben. Wer solchen Ruf gespürt, kann schwer in engem Kreise sich begrenzen. Schon weiß die kleinstädtische Schule den aufstrebenden Knaben nichts mehr zu lehren. Den Liebling allein nach der Großstadt zu lassen, können sich die Eltern nicht entschließen, so bringen sie in heroischer Entsagung lieber die eigene geruhige Existenz zum Opfer. Der Vater gibt seine einträgliche unabhängige Stellung als Notar, die ihn zum Mittelpunkt des Städtchens machte, auf und wird einer von den unzähligen Angestellten einer Bank in Paris: das altvertraute Haus, die patriarchische Existenz, alles opfern sie auf, um des Knaben Studienjahre und Aufstieg in Paris begleiten zu können. Eine ganze Familie blickt einzig auf den Knaben; und so lernt er schon früh, was andere erst den Mannesjahren abgewinnen: Verantwortlichkeit.
Schuljahre
Der Knabe ist noch zu jung, um die Magie von Paris zu erfassen: fremd und fast feindlich mutet den Verträumten diese lärmende und brutale Wirklichkeit an; irgendein Grauen, einen geheimnisvollen Schauer vor dem Sinnlosen und Seelenlosen der großen Städte, ein unerklärliches Mißtrauen, daß hier alles nicht ganz wahr und nicht ganz echt sei, trägt er von diesen Stunden noch weit mit in sein Leben. Die Eltern schicken ihn in das Lycée Louis le Grand , das altberühmte Gymnasium im Herzen von Paris: viele der Besten, der Berühmtesten Frankreichs sind unter den kleinen Jungen gewesen, die man dort mittags, summend wie ein Bienenschwarm, aus der großen Wabe des Wissens herausdrängen sah. Er wird dort in die klassische, französisch-nationale Bildung eingeführt, um ein »bon perroquet Cornélien« zu werden, aber seine wirklichen Erlebnisse sind außerhalb dieser logischen Poesie oder poetischen Logik, seine Begeisterungen glühen längst in lebendiger Dichtung und in der Musik. Aber dort auf der Schulbank findet er seinen ersten Kameraden.
Seltsames Spiel des Zufalls: auch dieses Freundes Namen hat zwanzig Jahre Schweigen benötigt zu seinem Ruhm, und die beiden – die größten Dichter des Frankreich von heute –, die dort gemeinsam die Schwelle der Schule betreten, treten fast gleichzeitig nach zwei Jahrzehnten in den weiten europäischen Ruhm. Paul Claudel, der Dichter der »Annonce faite à Marie« , ist jener Gefährte. In Glaube und Geist hat dies Vierteljahrhundert ihre Ideen und Werke weit entfremdet, des einen Weg führt in die mystische Kathedrale der katholischen Vergangenheit, der des andern über Frankreich hinaus einem freien Europa entgegen. Damals aber gingen sie täglich ihren Schulweg zusammen und tauschten in unendlichen Gesprächen, gegenseitig sich befeuernd, ihre frühe Belesenheit und jugendliche Begeisterung aus. Das Sternbild ihres Himmels war Richard Wagner, der damals über die französische Jugend zauberische Macht gewann: immer hat nur der universale weltschöpferische Mensch, nie der Kunstdichter auf Rolland Einfluß gehabt.
Die Schuljahre sind schnell verflogen, schnell und ohne viel Freude. Zu plötzlich war der Übergang aus der romantischen Heimat in das allzu wirkliche, allzu lebendige Paris, von dem der zarte Knabe vorläufig nur die Härte der Abwehr, die Gleichgültigkeit und den rasenden, wirbelnden, mitreißenden Rhythmus fast ängstlich fühlt. Das Jünglingsalter wird für ihn zu schwerer, beinahe tragischer Krise, deren Widerschein man in mancher Episode des jungen Johann Christof nachleuchten sehen kann. Er sehnt sich nach Anteil, nach Wärme, nach Aufschwung, und wieder bleibt ihm Erlöserin »die holde Kunst in so viel grauen Stunden«. Seine Beglückungen sind – wie schön ist dies in »Antoinette« geschildert – die seltenen Sonntagsstunden in den populären Konzerten, wo die ewige Welle der Musik sein zitterndes Knabenherz aufhebt. Auch Shakespeare hat nichts verloren von seiner Gewalt, seit er seine Dramen auf der Bühne schauernd und ekstatisch gesehen, im Gegenteil, ganz gibt der Knabe ihm seine Seele hin: »Er überfiel mich, und ich warf mich ihm wie eine Blüte hin, zur selben Zeit überflutete mich gleich einer Ebene der Geist der Musik, Beethoven und Berlioz noch mehr als Wagner. Ich mußte es büßen. Unter diesen überströmenden Blüten war ich ein oder zwei Jahre wie ertrunken, gleichsam eine Erde, die sich vollsaugt bis zu ihrem Verderben. Zweimal wurde ich bei der Aufnahmeprüfung in die École Normale dank der eifersüchtigen Gesellschaft Shakespeares und der Musik, die mich erfüllten, zurückgewiesen.« Einen dritten Meister entdeckt er sich später, einen Befreier seines Glaubens, Spinoza, den er an einem einsamen Abend in der Schule liest und dessen mildes geistiges Licht nun für immer seine Seele erhellt. Immer sind die Größten der Menschheit ihm Vorbilder und Gefährten.
Hinter der Schule gabelt sich der Weg ins Leben zwischen Neigung und Pflicht. Rollands glühendster Wunsch wäre, Künstler zu sein im Sinne Wagners, Musiker und Dichter zugleich, Schöpfer des heroischen Musikdramas. Schon schweben ihm einige Tondichtungen vor, deren Themen er im nationalen Gegensatz zu Wagner dem französischen Legendenkreis entnehmen will und von denen er eines, das Mysterium des Saint Louis , später bloß im schwingenden Worte gestaltet hat. Aber die Eltern widerstreben dem zu frühen Wunsche, sie fordern praktische Betätigung und schlagen die »École Polytechnique« , die Technik vor. Endlich wird zwischen Pflicht und Neigung ein glücklicher Ausgleich geschaffen, man wählt das Studium der Geisteswissenschaften, die »École Normale« , in die Rolland 1886 nach schließlich glänzend bestandener Prüfung aufgenommen wird und die durch ihren besonderen Geist und die historische Form ihrer Geselligkeit seinem Denken und Schicksal entscheidende Prägung gibt.
École Normale
Zwischen Feldern und freien Wiesen burgundischen Landes hat Rolland seine Kindheit verlebt, die erste Jugend der Gymnasiumsjahre in den brausenden Straßen von Paris: die Studienjahre schließen ihn noch enger ein, gleichsam in luftleeren Raum, in das Internat der École Normale . Um jede Ablenkung zu vermeiden, werden die Schüler dort abgesperrt gegen die Welt, ferngehalten vom wirklichen Leben, um das historische besser zu begreifen. Ähnlich wie im Priesterseminar, das Renan so wundervoll in seinen »Souvenirs d'enfance et de jeunesse« beschrieben hat, die jungen Theologen und in St. Cyr die zukünftigen Offiziere, so wird hier ein besonderer Generalstab des Geistes herangezogen, die »Normaliens« , die zukünftigen Lehrer zukünftiger Generationen. Traditioneller Geist und bewährte Methode vererben sich in fruchtbarer Inzucht, die besten Schüler sind bestimmt, an der selben Stelle als Lehrer wieder zu wirken. Es ist eine harte Schule, die unermüdlichen Fleiß fordert, weil sie sich Disziplinierung des Intellekts zum Ziele setzt, aber eben durch die angestrebte Universalität der Bildung gibt sie Freiheit in der Ordnung und vermeidet die gerade in Deutschland so gefährliche methodische Spezialisierung. Nicht durch Zufall sind gerade die umfassendsten Geister Frankreichs, wie Renan, Jaurès, Michelet, Monod und Rolland, aus der École Normale hervorgegangen.
So sehr in diesen Jahren die Leidenschaft Rollands auf Philosophie gerichtet ist – er studiert leidenschaftlich die Vorsokratiker und Spinoza –, so wählt er sich doch im zweiten Jahre Geschichte und Geographie als Hauptfach. Sie bietet ihm die meiste geistige Freiheit, indes die philosophische Sektion das Bekenntnis zum offiziellen Schulidealismus, die literarische zum rhetorischen Ciceronianismus erfordert. Und diese Wahl wird für seine Kunst Segnung und Entscheidung. Hier lernt er zum erstenmal für seine spätere Dichtung die Weltgeschichte als eine ewige Ebbe und Flut von Epochen zu betrachten, für die gestern, heute und morgen eine einzige lebendige Identität bedeuten. Er lernt Überblick und Ferne, und jene seine eminente Fähigkeit, Historisches zu verlebendigen und andererseits die Gegenwart als Biologe des Zeitorganismus kulturell zu betrachten, dankt seine Jugend diesen harten Jahren. Kein Dichter unserer Zeit hat auch nur annähernd ein ähnlich solides Fundament von tatsächlichem und methodischem Wissen auf allen Gebieten, und vielleicht ist im gewissen Sinne sogar seine beispiellose Arbeitsfähigkeit, sein dämonischer Fleiß ein Erlerntes aus jenen Jahren der Klausur.
Auch hier im Prytaneum – das Leben Rollands ist reich an solchen mystischen Sinnspielen – findet der Jüngling einen Freund, und wiederum ist es einer der zukünftigen Geister Frankreichs, wieder einer, der gleich Claudel und ihm selbst erst nach einem Vierteljahrhundert in das Licht des großen Ruhmes trat. Es wäre klein gedacht, dies bloß Zufall nennen zu wollen, daß die drei großen Vertreter des Idealismus, der neuen dichterischen Gläubigkeit in Frankreich, daß Paul Claudel, André Suarès, Charles Peguy gerade in ihren entscheidenden Schuljahren die täglichen Kameraden Romain Rollands gewesen sind und fast zu gleicher Stunde nach langen Jahren des Dunkels Gewalt über ihre Nation gewannen. Hier war längst aus Gesprächen, aus geheimnisvoll glühender Gläubigkeit eine Sphäre gewoben, die den Dunst der Zeit nicht sogleich zu durchdringen vermochte: ohne daß jedem dieser Freunde das Ziel deutlich geworden wäre – und in wie verschiedener Richtung hat der Weg sie getrieben! –, wurde das Elementare der Leidenschaft, der unerschütterliche Ernst zu großem Weltgefühl in ihnen doch gegenseitig bestärkt. Sie fühlten die gemeinsame Berufung, durch Aufopferung des Lebens, durch Verzicht auf Erfolg und Ertrag, ihrer Nation in Werk und Anruf die verlorene Gläubigkeit zurückzugeben; und jeder der vier Kameraden hat – Rolland, Suarès, Claudel, Peguy, jeder aus einer andern Windrichtung des Geistes – ihr Erhebung gebracht.
Mit Suarès verbindet ihn, so wie schon im Gymnasium mit Claudel, die Liebe zur Musik, besonders jener Wagners, dann die Leidenschaft für Shakespeare. »Diese Leidenschaft«, schrieb er einmal, »war erstes Band unserer langen Freundschaft. Suarès war damals noch ganz was er heute, nachdem er durch die vielen Phasen seines reifen und vielfältigen Wesens gegangen, wieder geworden ist – ein Renaissancemensch. Er hatte diese Seele, diese stürmischen Leidenschaften, ja, er sah mit seinen langen schwarzen Haaren, seinem blassen Gesicht und brennenden Augen selbst wie ein Italiener, gemalt von Carpaccio oder Ghirlandajo, aus. In einer der Schulaufgaben stimmte er einen Hymnus auf Cesare Borgia an. Shakespeare war sein Gott, wie er der meine war, und oft kämpften wir Seite an Seite für ›Will‹ gegen unsere Professoren.« Aber bald überflutet eine andere Leidenschaft jene für den großen Engländer, die »invasion scythe« , die begeisterte und wieder durch ein ganzes Leben weitergetragene Liebe zu Tolstoi. Diese jungen Idealisten, abgestoßen von dem allzu täglichen Naturalismus Zolas und Maupassants, Fanatiker, die nur zu einer großen heroischen Umspannung des Lebens aufblickten, sahen endlich über eine Literatur des Selbstgenusses (wie Flaubert und Anatole France) und der Unterhaltung eine Gestalt sich erheben, einen Gottsucher, der sein ganzes Leben auftat und hingab. Ihm strömten alle ihre Sympathien zu, »die Liebe zu Tolstoi vereinte alle unsere Widersprüche. Jeder liebte ihn zweifellos aus anderen Motiven, denn jeder fand in ihm nur sich selbst, aber für uns alle war er ein Tor ins unendliche Weltall aufgetan, eine Verkündigung des Lebens«. Wie immer seit den frühesten Kinderjahren ist die Spannung Rollands einzig auf die äußersten Werte eingestellt, auf den heroischen Menschen, den allmenschlichen Künstler.
In Jahren der Arbeit türmt der Fleißige in der École Normale Buch auf Buch, Schrift auf Schrift: schon haben seine Lehrer, Brunetière und vor allem Gabriel Monod, seine große Begabung für die historische Darstellung erkannt. Der Wissenszweig, den Jakob Burckhardt damals gewissermaßen erst erfindet und benennt, die Kulturgeschichte, das geistige Gesamtbild der Epoche, fesselt ihn am meisten, und unter den Zeiten ziehen ihn vor allem jene der Religionskriege an, in denen sich – wie früh doch die Motive seines ganzen Schaffens eigentlich klar sind! – das Geistige eines Glaubens mit dem Heroismus der persönlichen Aufopferung durchdringt; er verfaßt eine ganze Reihe von Studien und plant gleich ein Riesenwerk, eine Kulturgeschichte des Hofes der Katharina von Medici. Auch im Wissenschaftlichen hat der Beginner schon jene Kühnheit zu äußersten Problemen: nach allen Seiten spannt er sich, aus Philosophie, Biologie, Logik, Musik, Kunstgeschichte, aus allen Bächen und Strömen des Geistigen trinkt er gierig Fülle in sich. Aber die ungeheure Last des Gelernten erdrückt ebensowenig den Dichter in ihm, als ein Baum seine Wurzeln erdrückt. Der Dichter schreibt in weggestohlenen Stunden poetische und musikalische Versuche, die er aber verschließt und für immer verschlossen hat. Und ehe er, im Jahre 1888, die École Normale verläßt, um dem Leben als Erfahrung gegenüberzutreten, verfaßt er ein merkwürdiges Dokument, gewissermaßen ein geistiges Testament, ein moralisch philosophisches Bekenntnis »Credo quia verum« , das auch heute noch nicht veröffentlicht ist, aber nach Aussage eines Jugendfreundes schon das Wesentliche seiner freien Weltanschauung zusammenfaßt. Im spinozistischen Geist geschrieben, fußend nicht auf dem »Cogito ergo sum« , sondern einem »Cogito ergo est« , baut es die Welt auf und darüber ihren Gott: für sich allein legt er Rechenschaft ab, um nun frei zu sein von aller metaphysischen Spekulation. Wie ein versiegeltes Gelübde trägt er dies Bekenntnis hinaus in den Kampf und braucht nur sich selbst treu zu bleiben, um ihm treu zu sein. Ein Fundament ist geschaffen und tief in die Erde gesenkt: nun kann der Bau beginnen.
Das sind seine Werke in jenen Lehrjahren. Aber über ihnen schwebt noch ungewiß ein Traum, der Traum von einem Roman, der Geschichte eines reinen Künstlers, der an der Welt zerbricht. Es ist »Johann Christof« im Puppenstadium, erste verwölkte Morgendämmerung des späten Werks. Aber noch unendlich viel Schicksal, Begegnung und Prüfung ist vonnöten, ehe sich die Gestalt, farbig und beschwingt, dem dunklen Zustand der ersten Ahnung entringen mag.
Botschaft aus der Ferne
Die Schuljahre sind zu Ende. Und wieder erhebt sich die alte Frage der Lebenswahl. So sehr ihn Wissenschaft bereichert und begeistert, den tiefsten Traum erfüllt sie dem jungen Künstler noch nicht: mehr als je neigt seine Leidenschaft zu Dichtung und Musik. Selbst aufzusteigen in die erhabene Reihe derer, die mit ihrem Wort, ihrer Melodie die Seelen aufschließen, ein Gestaltender, ein Tröstender zu werden, bleibt Rollands brennende Sehnsucht. Aber das Leben scheint geordnetere Formen zu verlangen. Disziplin statt Freiheit, Beruf statt Berufung. Unschlüssig steht der Zweiundzwanzigjährige am Scheidewege des Lebens.
Da kommt Botschaft aus der Ferne zu ihm, Botschaft von der geliebtesten Hand. Leo Tolstoi, in dem die ganze Generation den Führer verehrt, das Sinnbild gelebter Wahrheit, läßt in diesem Jahre jene Broschüre erscheinen »Was sollen wir tun?«, die das fürchterlichste Anathema über die Kunst ausspricht. Das Teuerste für Rolland zerschmettert er mit verächtlicher Hand: Beethoven, zu dem der Jüngling täglich aufblickt in klingendem Gebet, nennt er einen Verführer zur Sinnlichkeit, Shakespeare einen Dichter vierten Ranges, einen Schädling. Die ganze moderne Kunst fegt er wie Spreu von der Tenne, das Heiligste des Herzens verstößt er ihm in die Finsternis. Diese Broschüre, die ganz Europa erschreckte, mochten Ältere mit leichtem Kopfschütteln abwehren – in diesen jungen Menschen aber, die Tolstoi als den Einzigen einer verlogenen und mutlosen Zeit verehrten, wirkt sie wie ein Waldbrand des Gewissens. Furchtbare Entscheidung zwischen Beethoven und dem anderen Heiligen ihres Herzens ist ihnen zugemutet. »Die Güte, Klarheit, die absolute Wahrhaftigkeit dieses Menschen hatten ihn mir zum fehllosen Führer in der moralischen Anarchie gemacht,« schreibt Rolland von dieser Stunde, »aber gleichzeitig liebte ich seit meiner Kindheit leidenschaftlich die Kunst, sie war, insbesondere die Musik, meine lebendige Nahrung, ja, ich kann sogar sagen, daß die Musik meinem Leben so nötig war wie das Brot.« Und eben diese Musik verflucht Tolstoi, sein geliebter Lehrer, der Menschen Menschlichster, als einen »pflichtlosen Genuß«, verhöhnt als Verführer zur Sinnlichkeit den Ariel der Seele. Was tun? Das Herz des jungen Menschen krampft sich zusammen: soll er dem Weisen von Jasnaja Poljana folgen, sein Leben loslösen von jedem Willen zur Kunst, soll er seiner innersten Neigung gehorchen, die alles Leben in Musik und Wort verwandeln will? Einem muß er untreu werden: entweder dem verehrtesten Künstler oder ihr selbst, der Kunst, dem geliebtesten Menschen oder der geliebtesten Idee.
In diesem Zwiespalt entschließt sich der junge Student, etwas ganz Unsinniges zu tun. Er setzt sich eines Tages hin und richtet aus seiner kleinen Mansarde einen Brief in die unendliche russische Ferne hinüber, einen Brief, in dem er Tolstoi die Gewissensnot seines Zweifels schildert. Er schreibt ihm, wie Verzweifelte zu Gott beten, ohne Hoffnung auf das Wunder einer Antwort, nur aus dem brennenden Bedürfnis der Konfession. Wochen vergehen, Rolland hat längst die törichte Stunde vergessen. Aber eines Abends, als er in sein Dachzimmer heimkehrt, findet er auf dem Tisch einen Brief oder vielmehr ein kleines Paket. Es ist die Antwort Tolstois an den Unbekannten, in französischer Sprache geschrieben, ein Brief von 38 Seiten, eine ganze Abhandlung. Und dieser Brief vom 14. Oktober 1887 (der später als das 4. Heft der dritten Serie der Cahiers de la Quinzaine von Peguy veröffentlicht wurde) beginnt mit den liebenden Worten »Cher frère« . Er spricht zuerst die tiefe Erschütterung des großen Mannes aus, dem der Schrei des Hilfesuchenden bis in das Herz gedrungen. »Ich habe Ihren Brief empfangen, er hat mich im Herzen berührt. Ich habe ihn mit Tränen in den Augen gelesen.« Dann versucht er dem Unbekannten seine Ideen über die Kunst zu entwickeln: daß nur jene einen Wert habe, die Menschen verbinde, und daß nur jener Künstler zähle, der seiner Überzeugung ein Opfer bringt. Nicht Liebe zur Kunst, sondern Liebe zur Menschheit sei die Vorausbedingung aller wahren Berufung; nur wer von ihr erfüllt sei, dürfe hoffen, jemals in der Kunst etwas Wertvolles zu leisten.
Diese Worte sind lebensentscheidend für die Zukunft Romain Rollands geworden. Aber was den Beginnenden noch mehr erschüttert als die Lehre – die Tolstoi ja noch oft und in deutlicheren Formen ausgesprochen –, ist das Geschehnis der menschlichen Hilfsbereitschaft, nicht also so sehr das Wort, sondern die Tat dieses gütigen Menschen. Daß der berühmteste Mann seiner Zeit auf den Anruf eines Namenlosen, eines Unbekannten, eines kleinen Studenten in einer Pariser Gasse, sein Tagewerk weggelegt und einen Tag oder zwei darauf verwandt hatte, diesem unbekannten Bruder zu antworten und ihn zu trösten, dies wird Rolland ein Erlebnis, ein tiefes und schöpferisches Erlebnis. Damals hat er in Erinnerung eigener Not, in Erinnerung der fremden Tröstung gelernt, jede Krise eines Gewissens als etwas Heiliges zu betrachten, jede Hilfeleistung als erste moralische Pflicht des Künstlers. Und von jener Stunde, da er das Briefblatt löste, war in ihm der große Helfer, der brüderliche Berater erstanden. Sein ganzes Werk, seine menschliche Autorität hat hier ihren Anbeginn. Nie hat er seitdem, auch in der drückendsten Fülle eigener Arbeit im Gedenken an die empfangene Tröstung, einem Anderen Hilfe in zwingender Gewissensnot verweigert, aus dem Briefe Tolstois erwuchsen unzählige Rollands, Tröstung aus Tröstung weitwirkend über die Zeit. Dichter zu sein, ist ihm von nun ab eine heilige Mission, und er hat sie erfüllt im Namen seines Meisters. Selten hat die Geschichte schöner als an diesem Beispiel bezeugt, daß in der moralischen Welt wie in der irdischen nie ein Atom an Kraft verloren geht. Die Stunde, die Tolstoi wegwarf an einen Unbekannten, ist auferstanden in tausend Briefen Rollands an tausend Unbekannte, unendliche Saat weht heute durch die Welt von diesem einzelnen hingestreuten Samenkorn der Güte.
Rom
Aus allen Fernen sprechen Stimmen auf den Unschlüssigen ein: die französische Heimat, die deutsche Musik, die Mahnung Tolstois, der feurige Anruf Shakespeares, Wille zur Kunst, Zwang zu bürgerlicher Existenz. Da tritt zwischen ihn und die rasche Entscheidung noch verzögernd der ewige Freund aller Künstler: der Zufall.
Alljährlich verleiht die École Normale ihren besten Schülern zweijährige Stipendien zur Reise, den Archäologen nach Griechenland, den Historikern nach Rom. Rolland strebt die Berufung nicht an: zu ungeduldig drängt sein Wunsch, schon im Wirklichen tätig zu wirken. Aber das Los sucht immer den, der es sich nicht selber ersehnt. Zwei Kameraden haben Rom ausgeschlagen, die Stelle ist vakant, so wird er gewählt, fast wider seinen Willen. Rom, das ist für den noch Unbelehrten tote Vergangenheit, in kalte Trümmer geschriebene Geschichte, die er aus Schrift und Pergamenten entziffern soll. Eine Schulaufgabe, ein Pensum und nicht lebendiges Leben; ohne viel Erwartung pilgert er zur ewigen Stadt.
Sein Amt, seine Aufgabe wäre dort, in dem finstern Palazzo Farnese Dokumente zu sichten, Geschichte aus Registern und Büchern zu klauben. Einen kurzen Tribut zahlt er diesem Dienst und verfaßt in den Archiven des Vatikans eine Denkschrift über den Nuntius Salviati und die Plünderung Roms. Aber bald hat nur das Lebendige über ihn mehr Macht: die wunderbare Klarheit des Lichtes der Campagna, die alle Dinge in eine selbstverständliche Harmonie auflöst und das Leben als leicht und rein empfinden läßt, strömt nach innen ein. Zum ersten Male wahrhaft frei, fühlt er sich zum ersten Male auch wahrhaft jung, eine Trunkenheit des Lebens kommt über ihn, bald ihn hinreißend in leidenschaftliche Gefühle und Abenteuer, bald seine ziellosen Träume zu wahrhafter Schöpfung steigernd. Unwiderstehlich wie bei so vielen erregt die linde Anmut dieser Stadt künstlerische Neigung; aus den steinernen Denkmälern der Renaissance hallt Ruf zur Größe dem Wandernden entgegen, die Kunst, die man in Italien stärker denn irgendwo als Sinn und heroisches Ziel der Menschheit empfindet, reißt ganz den Schwankenden an sich. Vergessen sind für Monate die Thesen, selig und frei schlendert Rolland durch die kleinen Städte bis nach Sizilien hinab, vergessen ist auch Tolstoi: in dieser Sphäre sinnlicher Erscheinung, im bunten Südland hat die Entsagungslehre der russischen Steppe keine Macht. Aber der alte Freund und Führer der Kindheit, Shakespeare, wird plötzlich wieder nah: ein Zyklus von Vorstellungen Ernesto Rossis zeigt ihm plötzlich die Schönheit seiner dämonischen Leidenschaft und weckt hinreißendes Verlangen, gleich Shakespeare Geschichte in Gedicht zu verwandeln. Um ihn stehen täglich die steinernen Zeugen vergangener großer Jahrhunderte: er ruft sie auf. Der Dichter ist plötzlich wach in ihm. In seliger Untreue zu seinem Berufe schafft er gleich eine ganze Reihe von Dramen, schafft sie im Fluge, mit jener brennenden Ekstase, die unverhoffte Beseligung immer im Künstler erweckt: die ganze Renaissance soll wie Shakespeares England in den Königsdramen erstehen; und sorglos, noch heiß vom Rausche der Verzückung, schreibt er eines nach dem andern, ohne um ihr irdisch-theatralisches Schicksal besorgt zu sein. Keine einzige jener romantischen Dichtungen erreicht die Bühne, keine ist heute mehr zu finden oder öffentlich zu erlangen, denn der reife Künstler hat sie verworfen und liebt in den verblaßten Handschriften nur mehr die eigene schöne und gläubige Jugend.
Aber das tiefste und weitreichendste Erlebnis jener römischen Jahre ist eine menschliche Begegnung, eine Freundschaft. Es gehört zum Mystisch-Symbolischen der Biographie Rollands, daß jede Epoche seiner Jugend ihn immer mit den wesentlichsten Menschen der Zeit verbindet, obwohl er eigentlich nie Menschen sucht, im tiefsten ein Einsamer ist, der am liebsten seinen Büchern lebt. Immer aber bringt ihn das Leben nach dem geheimnisvollen Gesetze der Anziehung in heroische Sphäre, immer wird er durch Beziehung den Gewaltigsten verbunden. Shakespeare, Mozart, Beethoven sind die Sterne seiner Kindheit; in den Schuljahren findet er Suarès, Claudel als Kameraden; in den Lehrjahren wird Renan ihm in einer Stunde, da er kühn den großen Weisen besucht, zum Führer, Spinoza sein religiöser Befreier, von ferne grüßt ihn brüderlich der Gruß Tolstois. In Rom nun weist ihn eine Empfehlung Monods an die edle Malvida von Meysenbug, deren Leben eine einzige Rückschau ist in heroische Vergangenheit. Wagner, Nietzsche, Mazzini, Hertzen, Kossuth war sie immer befreundet gewesen, Nationen und Sprachen sind diesem freien Geiste keine Grenze, den eine Revolution der Kunst oder der Politik nie erschreckte, der, »ein Menschenmagnet«, unwiderstehlich große Naturen vertrauend an sich zog. Nun ist sie eine alte Frau, milde geworden und klar, ohne Enttäuschung als ewige Idealistin dem Leben aufgetan. Von der Höhe ihrer siebzig Jahre überschaut sie weise und verklärt verklungene Zeiten, Reichtum des Wissens und der Erfahrung strömt von ihr dem Lernenden zu. In ihr findet Rolland die gleiche sanfte Verklärtheit, die erhabene Ruhe nach vieler Leidenschaft, die Italiens Landschaft ihm teuer macht, und wie dort aus Steinen, Bildern und Monumenten die Gewaltigen der Renaissance, so wird ihm hier aus Gespräch und mancher Vertrautheit das tragische Leben der Künstler unserer Zeit bewußt. In Gerechtigkeit und Liebe lernt er hier in Rom den Genius der Gegenwart erkennen, und dieser freie Geist zeigt ihm, was unbewußt längst eigenes Gefühl vorahnte, daß es eine Höhe des Erkennens und Genießens gibt, wo Nationen und Sprachen gleichgültig werden vor der ewigen Sprache der Kunst. Und auf einem Spaziergang auf dem Janikulus bricht plötzlich in einer einzigen Vision das zukünftige europäische Werk in ihm mächtig auf: der »Johann Christof«.
Wunderbar diese Freundschaft zwischen der siebzigjährigen deutschen Frau und dem dreiundzwanzigjährigen Franzosen: bald weiß keiner mehr von ihnen, wer dem andern zu tieferem Dank verpflichtet ist: er, weil sie ihm in großer Gerechtigkeit die großen Gestalten erweckt, sie, weil sie in diesem jungen leidenschaftlichen Künstler neue Möglichkeiten der Größe sieht. Ein und der gleiche Idealismus, der geprüfte und geläuterte der Greisin, der ungestüme und fanatische des Jünglings, klingen rein ineinander: jeden Tag kommt er zur verehrten Freundin in die via della polveriera und spielt ihr auf dem Klavier die geliebten Meister vor; sie wieder führt ihn ein in den römischen Kreis der Donna Laura Minghetti, wo er die intellektuelle Elite Roms und des wirklichen Europa kennen lernt, und lenkt mit sachter Hand seine Unruhe zu geistiger Freiheit. Auf der Höhe des Lebens, im Aufsatz über die »Antigone éternelle« , bekennt Rolland, daß es zwei Frauen waren, seine christliche Mutter und der freie Geist Malvida von Meysenbugs, die ihm die volle Tiefe der Kunst und des Lebens im Gefühl bewußt werden ließen. Sie aber schreibt in ihrem »Lebensabend«, ein Vierteljahrhundert ehe Rollands Name in irgendeinem Lande auch nur genannt wird, schon ein gläubiges Bekenntnis seines zukünftigen Ruhmes. Mit Rührung liest man heute dieses Jugendbild Rollands von der zitternden Greisenhand dieser freigeistigen, klaren Deutschen hingezeichnet: »Aber nicht nur in musikalischer Hinsicht erwuchs mir aus der Bekanntschaft mit diesem Jüngling hohe Freude. Es gibt gewiß gerade im vorgerückten Alter keine edlere Befriedigung, als in jungen Seelen denselben Drang der Idealität, dasselbe Streben nach den höchsten Zielen, dieselbe Verachtung alles Gemeinen und Trivialen, denselben Mut im Kampfe um die Freiheit der Individualität zu finden ... Zwei Jahre des edelsten geistigen Verkehres wurden mir durch die Anwesenheit dieses Jünglings zuteil ... Wie schon erwähnt, war es nicht nur die musikalische Begabung des jungen Freundes, welche mir die so lange entbehrte Wohltat brachte, auch auf allen anderen Gebieten des geistigen Lebens fand ich ihn einheimisch und zu voller Entwicklung strebend, so wie ich dagegen in der beständigen Anregung die Jugend des Gedankens und die volle Intensität des Interesses für alles Schöne und Poesievolle in mir wieder empfand. Auf diesem letzten Gebiete der Poesie entdeckte ich denn auch allmählich die schöpferische Begabung des Genannten, und zwar in überraschender Weise durch eine dramatische Dichtung.« In prophetischer Weise knüpft sie an dieses Erstlingswerk die Verkündigung, daß von der sittlichen Kraft dieses jungen Dichters vielleicht eine poetische Regeneration der französischen Kunst ausgehen könne, und in einem schön empfundenen, ein wenig sentimentalischen Gedicht spricht sie ihre ganze Dankbarkeit für das Erlebnis dieser zwei Jahre aus. Die freie Seele hat geschwisterlich den europäischen Bruder erkannt wie der Meister in Jasnaja Poljana seinen Schüler: zwanzig Jahre, ehe die Welt von ihm weiß, rührt Rollands Leben so schon an heroische Gegenwart. Dem, der das Große will, bleibt es nicht verborgen: Tod und Leben senden ihm Bilder und Gestalten entgegen als Mahnung und Beispiel, aus allen Ländern und Völkern Europas grüßen Stimmen den, der einst für sie alle sprechen soll.
Die Weihe
Die beiden Jahre in Italien, Jahre des freien Empfangens und schöpferischen Genießens, gehen zu Ende. Aus Paris ruft die Schule, die Rolland als Schüler verlassen, ihn nun als Lehrer zurück. Der Abschied ist schwer, und Malvida von Meysenbug, die gütige greise Frau, findet ihm noch einen schönen symbolischen Abschluß. Sie lädt den jungen Freund ein, mit ihr nach Bayreuth zu kommen, in die unmittelbarste Sphäre des Menschen, der mit Tolstoi das Sternbild seiner Jugend war und den er nun lebendiger fühlt aus ihrer beseelten Erinnerung. Rolland wandert zu Fuß durch Umbrien, in Venedig treffen sie zusammen, sehen den Palazzo, in dem der Meister starb, und fahren dann nach Norden in sein Haus zu seinem Werk. »Damit er« – wie sie in ihrer seltsam pathetischen und doch irgendwie ergreifenden Art sagt – »mit diesem erhabenen Eindruck die Jahre in Italien und diese reiche Jünglingszeit beschließe und denselben gleichsam als Weihe auf der Schwelle des Mannesalters mit seiner voraussichtlichen Arbeit und seinen wohl nicht ausbleibenden Kämpfen und Täuschungen empfange.«
Nun ist Olivier in Johann Christofs Land. Gleich am Morgen der Ankunft führt Malvida, noch ehe sie sich bei den Freunden in Wahnfried anmeldeten, ihn in den Garten zu des Meisters Grab. Rolland entblößt wie in einer Kirche das Haupt, schweigend stehen sie lange im Gedenken an den heroischen Menschen, der dieser einen ein Freund, dem andern ein Führer war. Und abends empfangen sie sein Vermächtnis, den Parsifal. Dieses Werk, das geheimnisvoll wie auch die Stunden jener Gegenwart mit der Geburt des Johann Christof verbunden ist, wird eine Weihestunde für seine zukünftige Zeit. Dann ruft ihn das Leben aus so großen Träumen. Ergreifend schildert die Siebzigjährige diesen Abschied: »Durch die Güte meiner Freunde für alle Aufführungen in ihre Loge eingeladen, hörte ich noch einmal Parsifal zusammen mit Rolland, der dann nach Frankreich zurückgehen mußte, um in die große Gewerbstätigkeit als schaffendes Glied einzutreten. Es war mir furchtbar leid um ihn, den Hochbegabten, daß er sich nicht frei zu ›höheren Sphären‹ heben und ganz in der Entfaltung künstlerischer Triebe vom Jüngling zum Manne reifen konnte. Aber ich wußte auch, daß er dennoch am sausenden Webstuhl der Zeit mithelfen würde, der Gottheit lebendiges Kleid zu wirken. Die Tränen, die beim Schluß der Aufführung des Parsifal in seinen Augen standen, verbürgten mir aufs neue diese Annahme, und so sah ich ihn scheiden mit innigem Danke für die poesieerfüllte Zeit, die mir seine Talente bereitet hatten, und mit dem Segen, den das Alter der Jugend mitgibt in das Leben.«
Eine reiche Zeit für sie beide endet in dieser Stunde, aber nicht ihre schöne Freundschaft. Noch durch Jahre, bis zu dem letzten ihres Lebens, schreibt Rolland ihr allwöchentlich, und in diesen Briefen, die er nach ihrem Tode zurückerhielt, ist vielleicht die Biographie seiner eigenen Jugend vollkommener gebildet, als je andere sie werden sagen können. Unendliches hat er gelernt in dieser Begegnung: Weite des Wissens um das Wirkliche ist ihm nun gegeben, Zeitgefühl ohne Grenze, und er, der nach Rom gegangen, um nur vergangene Kunst zu erfassen, fand dort das lebendige Deutschland und die Gegenwart der ewigen Helden. Der Dreiklang aus Dichtung, Musik und Wissenschaft harmonisiert sich unbewußt mit dem andern: Frankreich, Deutschland, Italien. Europäischer Geist ist nun für immer der seine, und noch ehe der Dichter eine Zeile geschrieben, lebt schon in seinem Blute der große Mythos des Johann Christof.
Lehrjahre
Nicht nur die innere Linie des Lebens, auch die äußere Richtung des Berufes hat in diesen beiden Jahren in Rom entscheidende Form gewonnen: ähnlich wie bei Goethe harmonisiert sich in der erhabenen Klärung südlicher Landschaft das Widerstreitende des Willens. Ein Unsicherer, Unentschiedener war Rolland nach Italien gegangen, Musiker dem Genius nach, Dichter aus Neigung, Historiker aus Notwendigkeit. Allmählich hatte sich dort in magischer Bindung die Musik der Dichtung verschwistert: in jenen ersten Dramen strömt lyrische Melodik in das Wort übermächtig ein, gleichzeitig hatte der historische Sinn das farbige Kolorit großer Vergangenheit hinter diesen beschwingten Worten als eine mächtige Kulisse aufgestellt. Der Heimgekehrte vermag nun die dritte Bindung seiner Begabung und seines Berufes zu vollziehen, er wird nach Erfolg seiner These »Les origines du théatre lyrique moderne« (Histoire de l'Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti) Lehrer der Musikgeschichte zuerst an der École Normale , dann von 1903 an der Sorbonne ; die »éternelle floraison« , die ewige Blüte der Musik, als eine unendliche Folge durch die Zeiten zu schildern, deren jede doch wieder ihre seelische Schwingung in den Gestaltungen verewigt, ist seine Aufgabe, und er zeigt – zum erstenmal sein Lieblingsthema entdeckend –, wie die Nationen in dieser scheinbar abstrakten Sphäre zwar ihre Charaktere ausprägen, aber doch immer die höhere, die zeitlose, die internationale Einheit unbewußt aufbauen. Fähigkeit des Verstehens und des Verstehenlassens ist ja der innerste Kern seiner menschlichen Wirksamkeit, und hier, im vertrautesten Element, wird seine Leidenschaft mitteilsam. In lebendigerem Sinne als alle vor ihm lehrt er seine Wissenschaft, erzeigt im unsichtbar Seienden der Musik, daß das Große in der Menschheit niemals einer Zeit, einem Volke allein zugeteilt ist, sondern in ewiger Wanderschaft über die Grenzen und Zeiten als heiliges Feuer glüht, das ein Meister dem andern weiterreicht und das nie verlöschen wird, solange noch der Atem der Begeisterung vom Munde der Menschen ausgeht. Es gibt keinen Gegensatz, keinen Zwiespalt in der Kunst, »die Geschichte muß zum Gegenstand die lebendige Einheit des menschlichen Geistes haben, darum ist sie gezwungen, die Bindung aller seiner Gedanken aufrechtzuerhalten«.
Von jenen Vorträgen, die Romain Rolland in der »École des hautes études sociales« und der Sorbonne hielt, erzählen Zuhörer noch heute mit unverminderter Dankbarkeit. Historisch war an jenen Vorträgen eigentlich nur der Gegenstand, wissenschaftlich bloß das Fundament. Rolland hat heute neben seinem universalen Ruhm noch immer den fachlichen in der Musikforschung, das Manuskript von Luigi Rossis »Orfeo« entdeckt und die erste Würdigung des vergessenen Francesco Provencale gegeben zu haben, aber seine menschlich umfassende, wahrhaft enzyklopädische Betrachtung machte jene Stunden über »die Anfänge der Oper« zu Freskobildern ganzer verschollener Kulturen. Zwischen den Worten ließ er die Musik sprechen, gab am Klavier kleine Proben, die längst verklungene Arien in demselben Paris, wo sie vor dreihundert Jahren zum erstenmal aufgeblüht waren, aus Staub und Pergament wieder silbern aufwachen ließen. Damals begann in dem noch jungen Rolland jene unmittelbare Wirkung auf die Menschen, jene erläuternde, fühlende, erhebende, bildende und begeisternde Kraft, die seitdem, durch sein dichterisches Werk immer fernere Kreise erfassend, sich ins Unermeßliche gesteigert hat, im Kernpunkt aber ihrer Absicht treu geblieben ist: in allen Formen der Geschichte und Gegenwart einer Menschheit das Große ihrer Gestalten und die Einheit aller reinen Bemühung zu zeigen.
Selbstverständlich machte seine Leidenschaft für die Musik nicht im Historischen halt. Nie ist Romain Rolland Fachmensch geworden, jede Vereinzelung widerstrebt seiner synthetischen, seiner bindenden Natur. Für ihn ist alle Vergangenheit nur Vorbereitung für die Gegenwart, das Gewesene nur Möglichkeit gesteigerten Erfassens der Zukunft. Und an die gelehrten Thesen und die Bände der »Musiciens d'autrefois« , »Händel« der »Histoire de l'Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti« reihen sich die Aufsätze der »Musiciens d'aujourd'hui« , die er als Vorkämpfer für alles Moderne und Unbekannte in der »Revue de Paris« und »Revue de l'Art dramatique« zuerst veröffentlicht hatte. Das erste Porträt Hugo Wolfs in Frankreich, das hinreißendste des jungen Richard Strauß und Debussys ist in ihnen gezeichnet; unermüdlich blickt er nach allen Seiten, die neuen schöpferischen Kräfte der europäischen Tonkunst zu gewahren; er reist zum Straßburger Musikfest, Gustav Mahler zu hören, und nach Bonn zu den Beethovenfesttagen. Nichts bleibt seiner leidenschaftlichen Wissensgier, seinem Gerechtigkeitssinn fremd: von Katalonien bis Skandinavien lauscht er auf jede neue Welle im unendlichen Meer der Musik, im Geist der Gegenwart nicht minder heimisch als in dem der Vergangenheit.
Lehrend in diesen Jahren, lernt er auch selbst vom Leben viel. Neue Kreise tun sich ihm auf in demselben Paris, das er bisher kaum anders als von dem Fenster der einsamen Studierstube gekannt. Seine Stellung an der Universität, seine Verheiratung bringen den Einsamen, der bisher nur mit einzelnen vertrauten Freunden und den fernen Heroen gelebt, in Berührung mit der geistigen und mondänen Gesellschaft. Im Hause seines Schwiegervaters, des berühmten Archäologen Michel Breal, lernt er die Leuchten der Sorbonne kennen, in den Salons das ganze Getümmel von Finanzmännern, Bürgern, Beamten, alle Schichten der Stadt, durchwoben mit den in Paris unvermeidlichen kosmopolitischen Elementen. Der Romantiker Rolland wird in diesen Jahren unwillkürlich Beobachter, sein Idealismus gewinnt, ohne an Intensität zu verlieren, kritische Kraft. Was er an Erfahrungen (oder besser an Enttäuschungen) aus diesen Begegnungen in sich sammelt, dieser ganze Schutt von Alltäglichkeit, wird später Zement und Unterbau für die Pariser Welt in »Der Jahrmarkt« (»La foire sur la place«) und »Das Haus« (»Dans la maison«) . Gelegentliche Reisen nach Deutschland, die Schweiz, Österreich, das geliebte Italien bringen Vergleich und neues Wissen; immer weiter spannt sich über dem Wissen der Geschichte der wachsende Horizont der modernen Kultur. Der Heimgekehrte aus Europa hat sich Frankreich und Paris entdeckt, der Historiker die wichtigste Epoche für den Lebendigen: die Gegenwart.
Kampfjahre
Alles ist nun in dem Dreißigjährigen gespannte Kraft, verhaltene Leidenschaft zur Tat. In allen Zeichen und Bildern, in der Vergangenheit und an den künstlerischen Gestalten der Gegenwart hat sein begeisterter Sinn Größe gesehen: nun drängt es ihn, sie zu erleben, sie zu gestalten.
Aber ein Wille zur Größe findet eine kleine Zeit. Als Rolland beginnt, sind die Gewaltigen Frankreichs schon dahingegangen, Victor Hugo, der unentwegte Rufer zum Idealismus, Flaubert, der heroische Arbeiter, Renan, der Weise, sind tot, die Gestirne des nachbarlichen Himmels, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche, sind gesunken oder verdunkelt. Die Kunst, selbst die ernste eines Zola, eines Maupassant, dienen dem Täglichen, schaffen nur Bildnis einer verderbten und verweichlichten Zeit. Die Politik ist kleinlich und vorsichtig, die Philosophie schulmäßig und abstrakt geworden: nichts Gemeinsames bindet mehr die Nation, deren Glaubenskraft in der Niederlage für Jahrzehnte erschüttert worden ist. Er will wagen, aber die Welt will kein Wagnis. Er will kämpfen, aber die Welt will Behaglichkeit. Er will Gemeinschaft, aber die Welt keine andere als die des Genusses.
Da stürzt plötzlich ein Sturm über das Land. Die untersten Tiefen Frankreichs sind aufgewühlt, mit einem Male steht die ganze Nation in Leidenschaft um ein geistiges, ein moralisches Problem: und leidenschaftlich wie ein verwegener Schwimmer stürzt sich Rolland als einer der Ersten in die aufgeregte Flut. Über Nacht hat die Dreyfus-Affäre Frankreich in zwei Parteien zerrissen, es gibt da kein Abseitsstehen, keine kühle Betrachtung, die Besten faßt die Frage am stärksten, für zwei Jahre ist die ganze Nation messerscharf in zwei Meinungen, in Schuldig oder Unschuldig zerrissen, und dieser Schnitt geht erbarmungslos – am besten kann man es im »Johann Christof« und den Memoiren Peguys nachlesen – mitten durch Familien, trennt Brüder von Brüdern, Väter von Söhnen, Freunde von Freunden. Wir von heute können kaum mehr verstehen, daß die Angelegenheit eines wegen Spionage verdächtigten Artilleriehauptmanns für ein ganzes Land zur Krise wurde, aber die Leidenschaft wuchs über den Anlaß hinaus ins Geistige: eine Frage des Gewissens war jedem Einzelnen gestellt, Entscheidung zwischen Vaterland und Gerechtigkeit, und mit explosiver Wucht schmettert sie aus jedem Aufrichtigen die moralischen Kräfte in den Kampf. Rolland war einer der ersten in jenem engen Kreise, der von allem Anfang an für die Unschuld des Dreyfus eintrat, und gerade die Aussichtslosigkeit jener allerersten Bemühungen war für ihn Anreiz des Gewissens; während Peguy mehr von der mystischen Kraft des Problems ergriffen war, von der er eine sittliche Reinigung seines Vaterlandes erhoffte, während er agitatorisch in Broschüren mit Bernard Lazare die Affäre zum Flammen brachte, begeisterte Rolland das immanente Problem der Gerechtigkeit. Mit einer dramatischen Paraphrase »Die Wölfe«, die er unter dem Pseudonym St. Just veröffentlichte und die in Gegenwart Zolas, Scheurer-Kestners, Piquarts unter leidenschaftlicher Anteilnahme der Zuhörer gespielt wurde, hob er das Problem aus der Zeit ins Ewige hinaus. Und je mehr der Prozeß politisch wurde, seit sich die Freimaurer, die Antiklerikalen, die Sozialisten seiner als Sturmbock für ihre eigenen Absichten bedienten, je mehr der tatsächliche Erfolg für die Idee sich kundgab, um so mehr zog Rolland sich wieder zurück. Seine Leidenschaft gilt immer nur dem Geistigen, dem Problem, dem ewig Aussichtslosen – auch hier ist es sein Ruhm, einer der ersten und ein einsamer Kämpfer in einem historischen Augenblick gewesen zu sein.
Gleichzeitig aber eröffnet er Schulter an Schulter mit Peguy und dem alten im Kampf zurückgefundenen Jugendkameraden Suarès einen neuen Feldzug, aber keinen lauten, lärmenden, sondern eine Kampagne, deren stiller verschwiegener Heroismus mehr einem Passionswege glich. Sie spüren schmerzhaft die Korruption, die Verhurtheit, die Banalität und Käuflichkeit der Literatur, die in Paris den Tag beherrscht: sie offen zu bekämpfen wäre aussichtslos gewesen, denn diese Hydra hat alle Zeitschriften in Händen, alle Journale sind ihr dienstbar. Nirgends ist ihre glatte, quallige, tausendarmige Wesenheit tödlich zu treffen. Und so beschließen sie, ihr entgegenzuarbeiten, nicht mit den eigenen Mitteln, dem Lärm und der Betriebsamkeit, sondern mit dem moralischen Gegenbeispiel, der stillen Aufopferung und beharrlichen Geduld. Fünfzehn Jahre lang erscheint ihre Zeitschrift, die »Cahiers de la quinzaine« , die sie selbst schreiben und verwalten. Kein Centime wird für Reklame verausgabt, kaum findet man bei irgendeinem Buchhändler ein Heft, Studenten, ein paar Literaten, ein kleiner enger Kreis sind die Leser, die allmählich erst eine Gemeinde werden. Über ein Jahrzehnt läßt Romain Rolland alle seine Werke in diesen Heften erscheinen, den ganzen Johann Christof, Beethoven, Michelangelo, die Dramen, ohne – der Fall ist beispiellos in der neueren Literatur – einen Franken Honorar zu erhalten (und seine finanziellen Verhältnisse waren damals wahrhaftig keine rosigen). Aber nur um ihren Idealismus zu erhärten, um ein moralisches Beispiel zu schaffen, verzichten diese heroischen Menschen ein Jahrzehnt auf Besprechungen, auf Verbreitung und Honorar, auf diese heilige Dreifaltigkeit aller Literatengläubigkeit. Und als endlich die Zeit der Cahiers gekommen war durch Rollands, durch Peguys, durch Suarès' späten Ruhm, da endet ihre Herausgabe, ein unvergängliches Denkmal des französischen Idealismus und künstlerisch menschlicher Kameradschaft.
Und noch ein drittes Mal versucht sich die geistige Leidenschaftlichkeit Rollands in einer Tat. Noch ein drittes Mal tritt er für eine Lebensstunde in eine Gemeinschaft, um Lebendiges im Lebendigen zu schaffen. Eine Gruppe junger Leute hat in richtiger Erkenntnis des Unwertes und der Verderblichkeit des französischen Boulevarddramas, dieser ewigen Ehebruchsakrobatik einer gelangweilten Bürgerlichkeit, versucht, das Drama wieder dem Volke, dem Proletariat und damit einer neuen Kraft zurückzugeben. In ungestümer Feurigkeit nimmt Rolland die Bemühung auf, schreibt Aufsätze, Manifeste, ein ganzes Buch, und vor allem, er verfaßt aus dem innersten Gedanken heraus selbst eine Reihe von Dramen im Geiste und zur Verherrlichung der französischen Revolution. Jaurès führt mit einer Rede seinen Danton den französischen Arbeitern vor, auch die andern werden gespielt, aber die Tagespresse, offenbar in geheimer Witterung feindlicher Kraft, sucht sorglich die Leidenschaft abzukühlen. Und wirklich, die andern Teilnehmer erkalten im Eifer, und bald ist der schöne Elan der jugendlichen Gruppe gebrochen: Rolland bleibt allein zurück, reicher an Erfahrung und Enttäuschung, aber nicht ärmer an Gläubigkeit.
Allen großen Bewegungen leidenschaftlich verbunden, war Rolland doch immer innerlich frei geblieben. Er gibt seine Kraft in die Bestrebungen der andern, ohne sich willenlos von ihnen mitreißen zu lassen. Alles enttäuscht ihn, was er gemeinsam mit andern schafft: das Gemeinsame wird immer trübe durch das Unzulängliche aller Menschlichkeit. Der Dreyfusprozeß wird eine politische Affäre, das Théatre du Peuple geht zugrunde an Rivalitäten, seine Dramen, die dem Volke bestimmt waren, erlöschen an einem einzigen Theaterabend, seine Ehe zerbricht – aber nichts kann seinen Idealismus zerbrechen. Wenn das gegenwärtige Leben nicht durch den Geist zu bezwingen ist, so verliert er darum nicht den Glauben an den Geist: aus Enttäuschung erweckt er sich die Bilder der Großen, die die Trauer durch die Tätigkeit, das Leben durch die Kunst besiegen. Er läßt das Theater, er läßt den Lehrstuhl, er tritt zurück aus der Welt, um das Leben, das sich den reinen Taten verweigert, in gestaltetem Bilde zu fassen. Enttäuschungen sind für ihn nur Erfahrungen, und über eine kleine Zeit baut er nun in zehn Jahren der Einsamkeit ein Werk, das wirklicher ist im ethischen Sinne als die Wirklichkeit, und das den Glauben seiner Generation in eine Tat verwandelt: den »Johann Christof«.
Ein Jahrzehnt Stille
Einen Augenblick lang war der Name Romain Rollands dem Pariser Publikum als der eines gelehrten Musikers, eines hoffnungsvollen Dramatikers vertraut gewesen. Dann ist er durch Jahre wieder verschollen, denn keine Stadt besitzt die Fähigkeit des Vergessens so gründlich und meistert sie so schonungslos wie Frankreichs Hauptstadt. Nie mehr wird der Name des Abseitigen genannt, nie selbst in den Kreisen der Dichter und Literaten, die doch die Wissenden um ihre eigenen Werte sein sollten. Man blättere zur Probe nach in allen den Revuen und Anthologien, in den Geschichten der Literatur: nirgends wird man Rolland auch nur verzeichnet finden, der damals schon ein Dutzend Dramen, die wundervollen Biographien und sechs Bände des »Johann Christof« veröffentlicht hatte. Die »Cahiers de la quinzaine« sind Geburtsstätte und gleichzeitig Grab seiner Werke, er selbst ist ein Fremder in der Stadt zur selben Zeit, da er ihre geistige Existenz so bildnerisch und umfassend wie kein zweiter gestaltet. Längst ist das vierzigste Lebensjahr überschritten, noch kennt er kein Honorar, keinen Ruhm, noch bedeutet er keine Macht, keine Lebendigkeit. Wie Charles Louis Philippe, wie Verhaeren, Claudel, Suarès, die Stärksten um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts, ist er unwirksam, unbekannt auf der Höhe seines Schaffens. Sein Leben ist lange das Schicksal, das er selbst so hinreißend erzählt: die Tragödie des französischen Idealismus.
Aber eben diese Stille ist notwendig zur Vorbereitung von Werken solcher Konzentration. Das Gewaltige braucht immer erst Einsamkeit, ehe es die Welt gewinnt. Nur jenseits des Publikums, nur in heroischer Gleichgültigkeit gegen den Erfolg wagt sich ein Mensch an ein so aussichtsloses Beginnen wie einen Giganten-Roman in zehn Bänden, der sich überdies in einer Zeit auflodernden Nationalismus gerade einen Deutschen zum Helden nimmt. Nur in solcher Abseitigkeit kann sich eine ähnliche Universalität des Wissens zum Werk entwickeln, nur die ungestörte, vom Atem der Menschen unberührte Stille es ohne Hast in vorgedachter Fülle entfalten.
Ein Jahrzehnt ist Rolland der große Verschollene der französischen Literatur. Ein Geheimnis umgibt ihn: es heißt Arbeit. Ein dunkler Puppenzustand von Unbekanntheit umschließt jahrelang, jahrzehntelang seine einsame Mühe, der sich dann beflügelt das kraftbeschwingte Werk entringt. Viel Leiden ist in diesen Jahren, viel Schweigen und viel Wissen um die Welt, das Wissen eines Menschen, um den niemand weiß.
Bildnis
Zwei Zimmerchen, nußschalengroß, im Herzen von Paris, knapp unter dem Dach: fünf Stockwerke hoch schraubt sich die hölzerne Treppe. Unten donnert ganz leise wie ein fernes Gewitter der Boulevard Montparnasse . Manchmal zittert auf dem Tisch ein Glas, wenn unten der schwere »Motorbus« vorüberdröhnt. Aber von den Fenstern geht der Blick über die niederen Nachbarhäuser in einen alten Klostergarten, und im Frühling weht ein weicher Duft von Blüten in die aufgetanen Fenster. Kein Nachbar hier oben, keine Bedienung als die alte Conciergefrau, die den Einsamen vor Gästen und Besuchern schützt.
Im Zimmer Bücher und Bücher. An den Wänden klettern sie auf, den Boden überhäufen sie, bunte Blumen wuchern sie über Fensterbrett, Sessel und Tisch, dazwischen Papiere verstreut, ein paar Gravüren an der Wand, Photographien von Freunden und eine Büste Beethovens. Nah dem Fenster ein kleiner Holztisch mit Feder und Papier, zwei Sessel, ein kleiner Ofen. Nichts in der engen Zelle, was kostbar wäre, nichts was weich zur Ruhe lüde oder zu gemächlicher Geselligkeit. Eine Studentenbude, ein kleiner Kerker der Arbeit.
Vor den Büchern er selbst, der milde Mönch dieser Zelle, immer dunkel gekleidet in der Art eines Geistlichen, schmal, hoch, zart, das Gesicht ein wenig blaß und gegilbt, wie das eines Menschen, der selten im Freien lebt. Feine Falten unter den Schläfen, man spürt einen Schaffenden, der viel wacht und wenig schläft. Alles ist zart an seinem Wesen, das reine Profil, dessen ernste Linie keine Photographie ganz wiedergibt, die schmalen Hände, das Haar, das feinsilbern hinter die hohe Stirn tritt, der Bart, der spärlich und sanft wie ein heller Schatten über der dünnen Lippe liegt. Und alles ist leise an ihm, die Stimme, die sich nur zögernd im Gespräche gibt, der Gang, der leicht vorgeneigt, auch im Ruhenden noch unsichtbar die Linie der gebückten Arbeit nachzeichnet, die Gesten, die sich immer bändigen, der zögernde Schritt. Nichts Leiseres kann man sich denken als seine Gegenwart. Und fast wäre man versucht, dieses Sanfte seines Wesens für Schwäche zu halten oder eine große Müdigkeit, wären nicht die Augen in diesem Antlitz, klar, messerscharf vorblinkend unter dem leicht geröteten Lidrand und dann wieder sanft sich vertiefend in Güte und Gefühl. In ihrem Blau ist etwas von der Tiefe eines Wassers, das seine Farbe nur von seiner Reinheit hat (und alle seine Bilder sind darum arm, weil sie dies Auge nicht bilden, in dem sich seine ganze Seele sammelt). Das ganze feine Antlitz ist von dem Blick so belebt, wie der schwache enge Körper vom geheimnisvollen Feuer der Arbeit.
Diese Arbeit, die unendliche Arbeit dieses Menschen im Gefängnis des Körpers, im Gefängnis des engen Raumes in all jenen Jahren, wer kann sie ermessen! Die Bücher, die geschriebenen, sind nur ihr kleinstes Teil. Alles umfaßt die brennende Neugier dieses Einsamen, die Kulturen aller Sprachen, die Geschichte, Philosophie, Dichtung und Musik aller Nationen. Mit allen Bestrebungen ist er in Verbindung, über alles hat er Aufzeichnungen, Briefe und Notizen, er hält Zwiesprache mit sich und den andern, indessen die Feder vorwärts gleitet. Mit seiner feinen aufrechten Schrift, die doch gleichzeitig mit Kraft die Buchstaben hinter sich wirft, hält er die Gedanken fest, die ihm begegnen, die eigenen und die fremden, Melodien vergangener und neuer Zeit, die er in schmalen Heften notiert, Auszüge aus Zeitschriften, Entwürfe, und sein gesparter, gesammelter Besitz an solchem selbst geschriebenen geistigen Gut ist unermeßlich. Immer brennt die Flamme dieser Arbeit. Selten gönnt er sich mehr als fünf Stunden Schlaf, selten einen Spaziergang in den nahen Luxembourg , selten kommt zu stillem Gespräch ein Freund die fünfmal gewundene Treppe empor, und auch seine Reisen sind meist Suche und Forschung. Ausruhen heißt für ihn eine Arbeit tauschen für eine andere, Briefe gegen Bücher, Philosophie gegen Dichtung. Sein Alleinsein ist tätige Gemeinsamkeit mit der Welt, und freie Stunden sind einzig jene kleinen Feste inmitten des langen Tages, wenn er in der Dämmerung auf dem Klavier Zwiesprache hält mit den großen Geistern der Musik, Melodien holend aus andern Welten in diesen kleinen Raum, der selbst wieder eine Welt des schaffenden Geistes ist.
Der Ruhm
1910. Ein Automobil saust die Champs Elysées entlang, seinen eigenen späten Warnruf überrennend. Ein Schrei – und der Unbedachte, der gerade die Straße überquerte, liegt unter den Rädern. Blutend, mit gebrochenen Gliedern hebt man den Überfahrenen auf und rettet ihm mühsam den Rest des Lebens.
Nichts sagt so sehr das Geheimnisvolle im Ruhme Romain Rollands aus als der Gedanke, wie wenig noch damals sein Verlust für die literarische Welt bedeutet hätte. Eine kleine Notiz in den Zeitungen, daß der Musiklehrer an der Sorbonne, Professor Rolland, einem Unfall zum Opfer geworden sei. Vielleicht hätte auch einer oder der andere sich daran erinnert, daß ein Mann dieses Namens vor fünfzehn Jahren hoffnungsvolle Dramen und musikalische Schriften verfaßt habe und in ganz Paris, der Dreimillionenstadt, hätte kaum eine Handvoll Menschen von dem verlorenen Dichter gewußt. So mystisch unbekannt war Romain Rolland zwei Jahre vor seinem europäischen Ruhm, so namenlos noch zu einer Zeit, als das Werk, das ihn zum Führer unserer Generation gemacht, im wesentlichen geschaffen war: das Dutzend Dramen, die Biographien der Heroen und die ersten acht Bände des »Johann Christof«.
Wunderbar das Geheimnis des Ruhms, wunderbar seine ewige Vielfalt. Jeder Ruhm hat seine eigene Form, unabhängig vom Menschen, dem er zufällt, und doch ihm zugehörig als sein Schicksal. Es gibt einen weisen Ruhm und einen törichten, einen gerechten und einen ungerechten, einen kurzatmigen, leichtfertigen, der wie ein Feuerwerk verprasselt, einen langsamen, schwerblütigen, der erst zögernd dem Werke nachfolgt, und es gibt einen infernalischen, boshaften, der immer zu spät kommt und sich von Leichen nährt.
Zwischen Rolland und dem Ruhm ist ein geheimnisvolles Verhältnis. Von Jugend an lockt ihn die große Magie, und so sehr ist schon der Jüngling bezaubert von dem Gedanken jenes einzig wirklichen Ruhmes, der moralische Macht und sittliche Autorität bedeutet, daß er stolz und sicher die kleinen Gelegenheiten des Klüngels und der Kameraderie verschmäht. Er kennt das Geheimnis und die Gefahr, die menschliche Versuchung der Macht, er weiß, daß man durch Geschäftigkeit nur seinen kalten Schatten fängt, nie das feurig wärmende Licht. Keinen Schritt ist er ihm darum entgegengegangen, nie hat er die Hand nach ihm ausgestreckt, so nahe er ihm mehrmals im Leben schon war, ja, er hat den nahenden sogar eigenwillig zurückgestoßen durch das grimmige Pamphlet seiner »Foire sur la Place« , die ihm für immer die Gunst der Pariser Presse nahm. Was er von seinem Johann Christof sagt, gilt ganz seiner eigenen Leidenschaft: »Le succès n'était pas sonbut, son but était la foi« . »Nicht der Erfolg, der Glaube war sein Ziel.«
Und der Ruhm hebt diesen Menschen, der ihn von ferne liebt, ohne sich ihm anzudrängen, er zögert lang, denn er will das Werk nicht stören, will eine lange Scholle der Dunkelheit um den Keim lassen, daß er reife in Leiden und Geduld. In zwei andern Welten wachsen sie beide heran, das Werk und der Ruhm, und warten der Begegnung. Kristallinisch bildet sich eine kleine Gemeinde seit dem »Beethoven«, die still dann mit Johann Christof sein Leben entlang geht. Die Getreuen von den »Cahiers de la quinzaine« werben neue Freunde. Ohne Mithilfe der Presse, einzig durch die unsichtbare Wirkung der werbenden Sympathie wachsen die Auflagen, im Auslande erscheinen Übersetzungen. Der ausgezeichnete schweizer Schriftsteller Paul Seippel gibt endlich 1912 in umfassender Darstellung die erste Biographie. Lange hat Rolland schon Liebe um sich, ehe die Zeitungen seinen Namen drucken, und der Preis der Akademie für das vollendete Werk ist dann nur gleichsam der Fanfarenstoß, der die Armeen seiner Getreuen zur Heerschau sammelt. Mit einemmal bricht die Welle der Worte über ihn herein, knapp vor seinem fünfzigsten Jahr. 1912 ist er noch unbekannt, 1914 ein Weltruhm. Mit einem Schrei der Überraschung erkennt eine Generation ihren Führer.
Es ist mystischer Sinn in diesem Ruhm Romain Rollands, wie in jedem Geschehnis seines Lebens. Er kommt spät zu dem Vergessenen, den er in bitteren Jahren der Sorge und materiellen Not allein gelassen. Aber er kommt noch zur rechten Stunde, er kommt vor dem Krieg. Wie ein Schwert gibt er sich ihm in die Hand. In entscheidendem Augenblick schenkt er ihm Macht und Stimme, damit er für Europa spreche, er hebt ihn hoch, damit er sichtbar sei im Getümmel. Er kommt rechtzeitig, dieser Ruhm, denn er kommt, als durch Leiden und Wissen Romain Rolland reif ist zu seinem höchsten Sinne, zu europäischer Verantwortlichkeit und die Welt des Mutigen bedarf, der gegen sie selbst ihre ewige Sendung, die Brüderlichkeit, verkünde.
Ausklang in die Zeit
So erhebt sich dieses Leben aus dem Dunkel in die Zeit: still bewegt, aber immer von den stärksten Kräften, scheinbar abseitig, aber wie kein anderes mit dem unheilvoll wachsenden Schicksal Europas verbunden. Von seiner Erfüllung aus gesehen, ist alles Hemmende, die vielen Jahre des unbekannten, des vergeblichen Ringens, notwendig darin, jede Begegnung symbolisch: wie ein Kunstwerk baut es sich auf in einer weisen Ordnung von Wille und Zufall. Und es hieße klein vom Schicksal denken, betrachtete man es bloß als Spiel, daß dieser Unbekannte gerade in den Jahren zu einer öffentlichen moralischen Macht geworden war, da wie nie ein Anwalt des geistigen Rechtes uns allen vonnöten war.
Mit diesem Jahre 1914 verlischt die private Existenz Romain Rollands: sein Leben gehört nicht mehr ihm, sondern der Welt, seine Biographie wird Zeitgeschichte, sie läßt sich nicht mehr ablösen von seiner öffentlichen Tat. Aus seiner Werkstatt ist der Einsame zum Werk in die Welt geschleudert: er, den bisher niemand gekannt hat, lebt bei offenen Türen und Fenstern, jeder Aufsatz, jeder Brief wird Manifest, wie ein heroisches Schauspiel baut seine persönliche Existenz sich auf. Von der Stunde ab, da seine teuerste Idee, die Einheit Europas, sich selbst zu vernichten droht, tritt er aus der Stille seiner Verborgenheit ins Licht, er wird Element der Zeit, unpersönliche Gewalt, ein Kapitel in der Geschichte des europäischen Geistes: und so wenig man Tolstois Leben trennen darf von seiner agitatorischen Tat, so wenig kann man hier den wirkenden Menschen von seiner Wirkung abzugrenzen versuchen. Seit 1914 ist Romain Rolland ganz eines mit seiner Idee und ihrem Kampf. Er ist nicht mehr Schriftsteller, Dichter, Künstler, nicht mehr Eigenwesen. Er ist die Stimme Europas in seiner tiefsten Qual. Er ist das Gewissen der Welt.