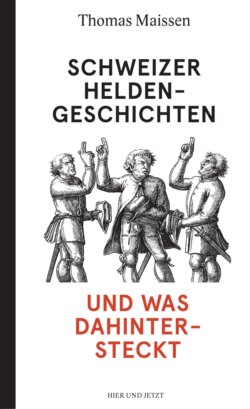Читать книгу Schweizer Heldengeschichten - und was dahintersteckt - Thomas Maissen - Страница 6
Zur Einführung:
Grundlinien der Geschichtsschreibung über die Schweiz
ОглавлениеViele Geschichten der Schweiz fangen mit der Ur- und Frühgeschichte an, mit den ersten Faustkeilen, die auf heutzutage schweizerischem Territorium gefunden wurden. Geschichtsschreibung über die Schweiz ist etwas anderes, und sie setzt auch nicht mit Julius Caesars Bericht über die Helvetier und seinen Sieg bei Bibracte ein. Selbst Urkunden, die uns viel über Machtverhältnisse und Gesellschaften im Mittelalter lehren, sind keine Quellen der Schweizer Geschichte im eigentlichen Sinn. Gewiss erfahren wir in mittelalterlichen Chroniken gelegentlich etwas über eine Stadt wie Zürich, oder Annalen verzeichnen die Begebenheiten in einem Kloster wie St. Gallen. Doch erst wer die Eidgenossenschaft und die Eidgenossen bewusst zu einem Gegenstand seiner Erzählung macht, kann zu den Begründern einer Geschichtsschreibung über die Schweiz zählen.5
Nicht die ältesten Bünde selbst, etwa der vielzitierte von 1291, sind also die ersten Belege für eine schweizerische Geschichte, wohl aber die ersten Berichte, die solche Bündnisse als kollektive Akteure erfassen. Das zu bedenken ist auch deshalb wichtig, weil es im Heiligen Römischen Reich des 13. und 14. Jahrhunderts nicht nur viele Bündnisse und Eidgenossenschaften gab, sondern die späteren schweizerischen Orte auch an vielen von diesen beteiligt waren. So gehörten die Städte des Mittellandes von Freiburg bis St. Gallen mit Basel, Breisach, Villingen und Ensisheim 1333 zu einem Landfriedensbündnis mit den Herzögen von Habsburg. Noch 1424 bezeichnete Bern den Herzog von Savoyen als «unsern genedigen Herren und liebsten eitgenossen», was eben bedeutete, dass sie ein Bündnis mit einem Eid beschworen hatten.6 Das passt nicht in die spätere Erzählung, wonach die Eidgenossenschaft aus einer «Urschweiz» am Vierwaldstättersee und im Kampf gegen die österreichischen Vögte erwachsen sei. Deshalb erinnert sich niemand mehr an solche Bündnisse, die für die damaligen Zeitgenossen im Gebiet der heutigen Schweiz viel wichtiger und präsenter waren als die regionalen von 1291 und 1315. Aber auch sie waren nicht entscheidend für die Autonomie, die Herrschaftsrechte und das entstehende politische Selbstverständnis der künftigen eidgenössischen Orte. Diese lagen nicht in Bündnissen begründet, sondern in der Reichsfreiheit. Die Könige beziehungsweise Kaiser stellten dieses Privileg aus und erneuerten es bei Herrschaftsantritt. Damit wurden die begünstigten Orte reichsunmittelbar, unterstanden also dem Kaiser direkt und übten die von ihm gewährten Hoheitsrechte autonom aus, vor allem die hohe Gerichtsbarkeit über Leben und Tod.
Uri, Schwyz und Unterwalden beanspruchten diese Reichsfreiheit dank den sogenannten Königsbriefen. Das früheste dieser Privilegien, das erhalten ist, wurde 1240 für Schwyz ausgestellt. Die meisten Königsbriefe stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert, wobei etliche auch Fälschungen sein dürften, die nicht zuletzt Aegidius Tschudi (1505– 1572) zuzuschreiben sind, dem wichtigsten Chronisten der Schweiz. Angesichts dieser Ausrichtung auf das Heilige Römische Reich überrascht es nicht, dass Uri, Schwyz und Unterwalden 1309 unter einem Reichsvogt – dem Baselbieter Grafen Werner von Homberg, kein Habsburger! – vereint wurden und dann erstmals den gemeinsamen Namen Waldstätte erhielten. Der Reichsvogt ist nicht lange belegt, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich die Innerschweizer gewaltsam seiner entledigten: Werner von Homberg kämpfte 1315 bei Morgarten möglicherweise sogar auf Schwyzer Seite.7 Allerdings wissen wir über diese Jahre fast nichts. Erst in den 1340er-Jahren fügte der Zisterzienser Johannes von Viktring in seine lateinische Weltchronik die erste Beschreibung der Schlacht bei Morgarten – vier Sätze, die der Kärntner fast dreissig Jahre nach dem Ereignis formulierte. Ausführlicher tat dies etwa zur selben Zeit der Barfüssermönch Johannes von Winterthur, dessen Vater die Schlacht auf Habsburger Seite überlebt hatte. Doch für deren Beschreibung, gerade auch der Örtlichkeiten, folgte Johannes dem alttestamentlichen Bericht über den Kampf der Israeliten gegen Holofernes (Judith, Kap. 4).8 Beide Kleriker sprachen allein von «Swicenses» oder «Switenses», also Einwohnern von Schwyz.9 Ihre Informationen sind so vage, dass bis heute über den Ort der Schlacht gerätselt und – zwischen Zug und Schwyz – gestritten wird. Über dieses später oft geschilderte Ereignis ist kaum mehr bekannt, als dass es stattgefunden hat und dann alttestamentlich stilisiert wurde. Die Chronisten erwähnten auch keine Verbündeten oder gar «Eitgenozen», obwohl die Waldstätte sich im Bund von Brunnen 1315 bereits untereinander so nannten – aber wie erwähnt noch nicht in einem exklusiven Sinn. Eine territoriale Bedeutung, die den Geltungsbereich der versprochenen Hilfeleistungen absteckte, erhielt das Wort «unser eidgnosschaft» erstmals 1351 im Bund von Zürich mit den drei Waldstätten und Luzern.10 Dieses vorübergehende Bündnis wurde geschlossen, als Zürich sich unter Rudolf Brun, seinem Herrscher auf Lebenszeit, gegen eine konkurrierende, von den Habsburgern gestützte Patriziergruppe behaupten musste. Im Rückblick wurde seit dem 15. Jahrhundert daraus der «Beitritt» Zürichs zur Eidgenossenschaft, obwohl die zeitgenössischen Stadtchroniken den Bund von 1351 nicht einmal erwähnten.11
Die älteste Stadtchronik von Zürich stammt frühestens von 1339, wenn man von den lokalgeschichtlichen Einsprengseln in einer lateinischen Chronica universalis Turicensis absieht. Im Unterschied zu dieser beschränkte sich die sogenannte Chronik von den Anfängen der Stadt Zürich allein auf die Stadtgeschichte, die sie auf Deutsch erzählte. In verschiedenen Redaktionen überliefert, wurde sie auch in anderen eidgenössischen Orten rezipiert. Die etwa gleichzeitig, bis 1340 verfasste Chronica de Berno und andere Beispiele aus Deutschland zeigen ebenfalls, dass die Reichsstädte im 14. Jahrhundert dank wirtschaftlicher Prosperität und politischer Autonomie begannen, sich als Gemeinschaften mit einer eigenen Vergangenheit darzustellen, die sich nicht in der Zugehörigkeit zum Heiligen Römischen Reich und seinen Kaisern erschöpfte. In einer vom Adel dominierten Kultur war es besonders wichtig, frühe Anfänge und damit eine vornehme Abkunft zu behaupten: Trier etwa wollte 1250 Jahre vor Rom durch einen Sohn der Semiramis gegründet worden sein, und Solothurn kuppelte seine Anfänge später an diese Sage an.12 Geschichtsschreibung entfaltete sich damit im 15. Jahrhundert auch im eidgenössischen Umfeld zu einer «Staatsangelegenheit», wobei der Staat die jeweilige Stadt war, die ihre Geschichte im offiziellen Auftrag von Stadtschreibern verfassen liess. Nicht zuletzt sollte die Erzählung die kriegerischen und käuflichen Erwerbungen von Gütern und Rechtstiteln legitimieren, die sie schilderte. Entsprechend gehörten Sammlungen und Abschriften von Urkunden zu diesen Geschichtswerken oder standen vielmehr in ihrem Mittelpunkt.13 So sucht man in Luzern und der Innerschweiz vergebens nach einigermassen zeitnahen Beschreibungen der Schlacht von Sempach von 1386. Ein Luzerner Bürgerbuch erwähnte sie kurz, wendete aber viel mehr Raum und Herzblut auf, um ein Jahr davor die Einrichtung einer Turmuhr festzuhalten. Das wenige, was Zeitgenossen über den Waffengang berichteten, stammt aus einer Zürcher und zwei österreichischen Quellen. Das viele, was man sich später darüber erzählte, ersann man sich frühestens ein Jahrhundert nach dem Ereignis.14
Ebenfalls erst im 15. Jahrhundert sind Autoren von amtlichen Stadtgeschichten namentlich fassbar, zumeist der Stadtschreiber, der über seine Chronik den Aufstieg in die Führungsgruppen suchte – zumal wenn er von auswärts kam. Der wohl aus Rottweil stammende Conrad Justinger machte den Anfang, nachdem Bern ihm 1420 den Auftrag erteilt hatte, die Geschichte der Stadt von ihrer Gründung bis in die Gegenwart aufzuzeichnen. Justinger konzentrierte sich vorwiegend auf Berner Ereignisse, für die er neben städtischen Urkunden Geschichtswerke wie die Cronica de Berno auswertete. Umso mehr fällt auf, dass er die Schlacht bei Morgarten beschrieb und damit historiografisch einen Bogen von der Reichsstadt zu den Innerschweizern schlug, die zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nichts zu diesem Thema verfasst hatten. Auch die bereits bestehende Zürcher Chronistik fand Verwendung. Justinger und Bern ging es darum, eine rechtlich umstrittene Tat zu legitimieren, die in seiner Chronik viel Platz einnimmt: die Eroberung des Aargaus, den die Berner mit den Zürchern und den Innerschweizer Verbündeten 1415 den Habsburgern abgenommen hatten. Indem Justinger die Alliierten von Bern vorstellte und über ihre lang anhaltenden Differenzen mit den Habsburgern berichtete, rechtfertigte er die Aggression historisch, die den erst 1412 geschlossenen, fünfzigjährigen Frieden mit Habsburg brach. König Sigismunds Aufforderung, den Aargau zu besetzen, lieferte die rechtliche Legitimation dazu. Auch wenn Justinger diese «guten Fründe» als «Eidgenossen» bezeichnet, bedeutet das noch nicht viel, denn derselbe Titel findet sich auch für andere Alliierte wie Strassburg und weitere Reichsstädte.15
Man kann also festhalten, dass in der Mitte des 15. Jahrhunderts der Zusammenhalt der künftigen Eidgenossen noch locker war. Auf der einen Seite gab es die gemeinsamen Interessen durch die Gemeine Herrschaft und damit gegen die Habsburger, die ihre aargauischen Stammlande zurückerlangen wollten; auf der anderen Seite blieben dieselben Habsburger auch mögliche Partner, denn die Bundesbriefe des 14. Jahrhunderts gewährten den eidgenössischen Orten Bündnisfreiheit. Davon machte die Reichsstadt Zürich 1442 Gebrauch, als sie sich im Alten Zürichkrieg «ze ewiger zit» mit dem habsburgischen König Friedrich III. verband. Ihnen gegenüber stand Schwyz, dem sich die anderen eidgenössischen Orte anschlossen, sodass Zürich 1450 in einen Frieden einwilligen musste. Die alten Bundesbriefe, so derjenige von 1351 zwischen den Waldstätten und Zürich, wurden daraufhin leicht redigiert und neu ausgestellt, um den Eindruck zu erwecken, die Allianzen seien schon im 14. Jahrhundert gegen Habsburg gerichtet gewesen.
Die Mitte des 15. Jahrhunderts wurde auch für die Geschichtsschreibung über die Schweiz insofern eine folgenreiche Zäsur, als sich die Schwyzer Sicht auf den Alten Zürichkrieg durchsetzte, wie sie deren Landschreiber Hans Fründ in einer genauen, mit Dokumenten versehenen Schilderung des Kriegs festhielt. Für ihn war die Eidgenossenschaft aus einem antihabsburgischen Bündnis der Waldstätte erwachsen. Wie die anderen Orte auch, habe sich das bedrohte Zürich den Eidgenossen angeschlossen, um sich dann durch das Bündnis von 1442 mit dem Habsburger König vorübergehend bündniswidrig wieder zu entziehen. Dass dies eine rechtmässige Option war, hatten Zürcher wie Felix Hemmerli für den Alten Zürichkrieg durchaus festgehalten. Wie Bern sich aber politisch hinter Schwyz gestellt hatte, so ging Fründs antihabsburgische und antizürcherische Geschichtsdeutung auch in die Historiografie der Aarestadt ein. Dort setzten die Bilderchroniken eines Benedikt Tschachtlan oder Diebold Schilling des Älteren, mit seiner amtlichen Chronik der Stadt Bern von 1483, Justingers Werk und Tradition fort.16 Diese Modelle wirkten ihrerseits wiederum formal wie inhaltlich auf Chronisten in Luzern (Melchior Russ, 1482; Diebold Schilling der Jüngere, 1513), Freiburg, Bremgarten und sogar Zürich (Gerold Edlibach, 1485/86, bis 1527 fortgesetzt), wo sie die entstehenden gesamteidgenössischen Grundelemente um lokale Fakten erweiterten. Insbesondere schlossen sich Aegidius Tschudi im 16. Jahrhundert und Johannes von Müller im 18. Jahrhundert dieser Version an, die bis in unsere Gegenwart weiterwirkt. Fründ verdrängte mit Hemmerli auch dessen Polemik, welche die vornehme Reichsstadt Zürich klar von den schwyzerischen Bauern schied. Insofern überrascht es nicht, dass der Name «Schwyzer» und dann «Schweizer» auf alle Angehörigen dieses Bündnisses Ausdehnung fand, das sich nach 1450 zusehends als alternativlos verstand; und damit stempelten die Gegner der Eidgenossen bald auch die urbanen Zürcher und Berner als «Bauern» ab.17
Gegen solche Verunglimpfungen richteten sich die Propaganda der eidgenössischen Orte und die damaligen Geschichtserzählungen mit verschiedenen Strategien. Gewisse Autoren beanspruchten für die Innerschweizer eine weit zurückreichende, vornehme Herkunft, wie sie herkömmliche Adlige oder allenfalls Städte ebenfalls reklamierten. So führte das Herkommen der Schwyzer und Oberhasler, vor 1490 von einem Anonymus verfasst, diese Alpenbewohner auf ausgewanderte Schweden zurück. Diese hätten sich um Kaiser und Papst verdient gemacht und deshalb das Privileg der Reichsfreiheit erhalten, seien also dem Kaiser schon seit spätantiken Zeiten unmittelbar unterstellt gewesen.18 Andere akzeptierten die fremde Unterstellung, dass die Eidgenossen Bauern und damit in der Ständegesellschaft nachrangig seien. Sie wendeten das Stigma aber um und sahen in ihren Schlachtensiegen ein Gottesurteil, das den Widerstand der «frumen, edlen Puren» gegen den pflichtvergessenen Adel legitimierte. Diesen Rückhalt verdienten sie sich angeblich, weil sie in Notwehr gehandelt hatten, nachdem die Habsburger sich an ihnen und ihren Freiheitsrechten vergangen hatten.19
Dieses Narrativ lag der Befreiungslegende zugrunde, der folgenreichsten Erfindung dieser Jahre. In sie bettete der Obwaldner Landschreiber Hans Schriber um 1474 eine Abschriftensammlung von kantonalen Urkunden im sogenannten Weissen Buch von Sarnen ein.20 Das erste der dort überlieferten Dokumente war der erwähnte Bund von 1315 in Brunnen. Dieser Vereinigung der «eidgnossen» hätten sich, stets um der habsburgischen Bedrohung zu entgehen, die übrigen eidgenössischen Orte angeschlossen, deren Bundesbriefe sich in diesem Kanzleibuch befanden: Luzern, Zürich, Zug, Glarus, Bern. Die Vorstellung ihres «Beitritts» zu einem mit klaren, antihabsburgischen Zielen gegründeten Bund der Waldstätte ersetzte damit den historischen Prozess einer allmählichen und nicht geradlinigen Verdichtung von verschiedenen Allianznetzwerken. Noch wirkmächtiger als diese Entwicklungsgeschichte um einen Innerschweizer Kern war ihre Legitimation. Denn der Bund von 1315 reagierte angeblich auf das, was im Weissen Buch erstmals überhaupt greifbar war und woraus die Vor- und Rahmengeschichte der dort überlieferten Akten bestand: die Untaten des Landvogts «Gijssler», Rütlischwur, Tellenschuss und Burgenbruch.
Hans Schriber zeichnete hier nicht alte, volkstümliche Überlieferungen auf, sondern komponierte die Befreiungslegende. Damit wehrte er sich als entschiedener Gegner der Habsburger gegen die Versöhnung der Eidgenossen mit diesen ihren Erbfeinden in der «Ewigen Richtung» von 1474. Gelehrte Überlieferungen inspirierten den juristisch beschlagenen Schriber, nicht nur Saxo Grammaticus (um 1210) für die Tellensage, sondern auch Justinger, dessen Chronik er zweimal erwähnte, und das schwedische Herkommen. Damit war klar, dass der legitime Herrscher in der Innerschweiz der Kaiser war – und nicht die Habsburger und ihre Vögte, deren herrschaftliches Auftreten als Usurpation von kaiserlichen Rechten erscheinen sollte. Tyrannen waren die Habsburger also nicht nur, weil sie angeblich brutale Untaten begangen hatten, sondern weil ihre Machtansprüche der Berechtigung entbehrten. Diese Argumentation beruhte auf der Gegenüberstellung von Habsburgern einerseits und dem Königtum als oberstes Amt im Reich andererseits. Sie stand auf wackligen Beinen, seitdem die Habsburger ab 1438 ununterbrochen den König stellten, der zumeist und seit Karl V. (1519/20) automatisch durch seine Wahl auch Kaiser wurde. Aber die Eidgenossen kamen mit dieser Unterscheidung zwischen dem Kaiser als traditioneller und privilegierender Institution einerseits und dem Kaiser als konkreter (habsburgischer) Person andererseits klar, zumal sie den Gegensatz zu Österreich durch die «Erbeinungen» von 1477 und 1511 vertraglich weitgehend beigelegt hatten. So führten sie den Schwabenkrieg 1499 nicht gegen Maximilian I. als den König im Reich, sondern als den Erzherzog von Österreich und Grafen von Tirol.
Obwohl das Weisse Buch im Archiv von Sarnen unzugänglich blieb und erst 1854 wiederentdeckt wurde, fand die Befreiungslegende dank den Luzerner Chronisten Melchior Russ und Petermann Etterlin Eingang in die eidgenössische Frühgeschichte. Entscheidend war, dass Etterlins Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft, Jr harkommen und sust seltzam strittenn und geschichten 1507 in Basel gedruckt wurde – als erste gesamteidgenössische Geschichte überhaupt.21 Sie schlug gleichsam einen historiografischen Bogen von den Waldstätten über Luzern nach Bern, da sich Etterlin auch stark auf Justinger stützte. Wirkmächtig war auch die Bildtradition zur Tellensage, welche die für Etterlins Chronik entworfenen Holzschnitte begründeten. Diese Motive fehlten noch in den stärker auf die einzelnen Städte bezogenen grossen Bilderchroniken des 15. Jahrhunderts, die in ihrer prächtigen Ausführung eine schweizerische Besonderheit darstellen. Sie blieben ebenfalls in den städtischen oder familiären Archiven eingeschlossenes, amtliches Geheimwissen der jeweiligen Ratseliten. Mit dem Buchdruck und mit Petermann Etterlin wurde dagegen die Geschichte der Schweiz ein Thema, das breiteren lesefähigen Kreisen zugänglich war, also insbesondere einem städtischen Laienpublikum.
Der historische Stoff wurde aber damit zugleich Gegenstand von Kritik und Polemik, da auch auswärtige Historiker auf gedruckte Werke zugreifen, sie mit anderen Überlieferungen vergleichen und mit ihrem eigenen Sachverstand hinterfragen konnten. Das war eine Lieblingsbeschäftigung der Humanisten, die sich damit ihren politischen Herrschern als Experten für den publizistischen Kampf anboten, den sie als Wettbewerb zwischen den entstehenden Nationen führten. Das hatte bereits der ebenfalls in Luzern wirkende Niklaus Schradin erleben müssen, der 1500 das erste gedruckte Buch veröffentlichte, das einem schweizergeschichtlichen Ereignis gewidmet war: eine illustrierte Reimchronik des Schwabenkriegs von 1499. Schradin beschrieb ihn als Aggression des Schwäbischen Bundes und Österreichs gegen die Eidgenossen, «die keins herren eigen sind».22 Der habsburgisch gesinnte Elsässer Humanist Jakob Wimpfeling zerfetzte mit seinem Spott die Ursprungssage, wie sie Schradin nach dem Herkommen der Schwyzer und Oberhasler eingebaut hatte: Wie heisst der Papst, der die Schwyzer angeblich privilegiert hat, und wo ist die Bulle? Schradin betreibe nicht Geschichtsschreibung, sondern träume sein Ammenmärchen.23 Ähnliches musste sich Etterlin vom schwäbischen Humanisten Heinrich Bebel anhören: Seine Dichtung sei lügnerisch, widersprüchlich und anachronistisch.24
Die Jahrzehnte um 1500 waren entscheidend für die Ausbildung eines gesamteidgenössischen, schweizerischen Geschichtsbilds. Es musste sich in einer internationalen humanistischen Gelehrtenwelt bewähren und zugleich mit einer Populärkultur verbunden bleiben, die über die Kantonsgrenzen hinausgriff und ebenfalls historische Dimensionen aufwies. Das zeigte sich bei den regelmässigen Neubeschwörungen der Bundesbriefe oder in den Jahrzeitfeiern zum Gedenken an die gemeinsam erkämpften Schlachtensiege, an deren Stätten Kapellen errichtet wurden. Bildliche Darstellungen und Theaterstücke erinnerten nicht nur an Tell, sondern stellten zugleich den tugendhaften alten Eidgenossen dem dekadenten jungen Eidgenossen gegenüber, wie er im Zeitalter der Burgunder- und Italienkriege zum Topos wurde. Das einfache Geld des Soldwesens verführe Letzteren zu adelsähnlichem Hochmut, zu Luxus und unsittlichem Lebenswandel, wo die Vorfahren bescheiden und fromm ihren bäuerlichen Alltagsgeschäften nachgegangen seien.25
Diese populären Formen der gemeinsamen Erinnerung lebten nicht zuletzt von ihrer kollektiven Inszenierung an Feiern und Vorführungen der Verbündeten. Zugleich erfasste eine zusehends professioneller betriebene Geschichtsschreibung die Eidgenossenschaft allmählich nicht mehr als Bündnisgeflecht von Reichsständen, sondern als Volk mit einem zusammenhängenden Territorium. Man kann von einer Ethnisierung und Territorialisierung des Geschichtsbilds reden, wobei auch die entstehende Kartografie eine wichtige Rolle spielte. Der Frühhumanist Albert von Bonstetten erfasste 1479 die «Obertütscheit Eydgnosschaft», da linksrheinisch, in Gallien und mit ihren acht Orten um die Rigi herum gruppiert, die den Mittelpunkt Europas darstelle. Derselbe Bonstetten sprach 1492 vom «lande der Helveczen, das iecz die Aydtnosschaft genemmet [genennet] wirt».26 Damit formulierte er als einer der Ersten eine Kontinuität zu den antiken Helvetiern, die Julius Caesar in De bello gallico, einem zentralen Referenztext der Humanisten, mit Respekt erwähnt hatte. Ein Land «Helvetia» dagegen war weder bei ihm noch sonst in der Antike vorgekommen. Es war eine Erfindung der Humanisten, die erneut darüber stritten, wo diese Gegend mit den ruhmvollen Helvetiern gelegen habe: Wimpfeling sah sie im Elsass, doch die Identifikation mit der Eidgenossenschaft setzte sich durch, auch dank italienischen Gelehrten.
Der Glarner Humanist Glarean veröffentlichte 1514 eine Descriptio Helvetiae, eine lateinische Beschreibung der nunmehr dreizehn Orte. Der Zürcher Heinrich Brennwald verfasste gleichzeitig die erste schweizerische Chronik, die mit dem Bericht Caesars einsetzte und so über viele Jahrhunderte hinweg eine Kontinuität im «land Helveciorum (die Eidgenosschaft genempt)» postulierte. Diesen Gedanken entfaltete namentlich ein Schüler Glareans, der führende Glarner Politiker und Offizier Aegidius Tschudi. Er sammelte während seiner Karriere an verschiedenen Orten im In- und Ausland Urkunden, Chroniken, Inschriften, Münzen und andere Quellen, die er in verschiedenen Redaktionsschritten seines Chronicon Helveticum zu einer Gesamtschau der schweizerischen Geschichte vom Jahr 1001 bis 1470 zusammenfügte. Lücken in der Überlieferung füllte er oft kreativ, indem er zum Beispiel genaue Datierungen erfand, was bei den Lesern den Eindruck von detailliertem Wissen verstärkte. Das tat er auch beim Rütlischwur, den er am 8. November 1307 stattfinden liess: «davon die eidtgnoschafft entsprungen und das land Helvetia (jetz Switzerland genant) wider in sin uralten stand und frijheit gebracht worden».27 Der Nutzen dieser historischen Erfindung lag darin, dass die Vorfahren der Eidgenossen nicht nur in der bewunderten Antike lebten, sondern die Helvetier damals als freies Volk existierten – eine ursprüngliche Freiheit, die von einer Autorität wie Caesar überliefert wurde und nicht von den Privilegien der Kaiser im Heiligen Römischen Reich abhing. Anders als beim Schwedenmythos des Herkommens, den die fremden Humanisten verspotteten, handelte es sich zudem nicht um eine Genealogie mit Wurzeln im Ausland, sondern um den Rückbezug auf ein autochthones, seit jeher in der Schweiz siedelndes Volk.
Zu diesem Volk passte das Territorium, das Tschudi 1538 mit der ersten gedruckten Karte der Schweiz erfasste. Davon ist kein Exemplar erhalten geblieben, und nur eines der zweiten Auflage von 1560. Tschudis Hauptwerke wurden gar erst im 18. Jahrhundert gedruckt. Seinen Ruhm schon zu Lebzeiten und seine Nachwirkung verdankte Tschudi der Zusammenarbeit mit anderen Geschichtskennern, namentlich in Zürich: Johannes Stumpf, Heinrich Bullinger und Josias Simler; dazu Vadian in St. Gallen. Tschudis Überlegungen und sein Material gingen vor allem in Stumpfs Werk ein. Der Zürcher kopierte Tschudis Karte für seine Landtaflen (1548), den ersten Atlas der Schweiz. Erstmalig überhaupt in der Geschichte der Kartografie markierte er die Landesgrenzen mit der noch heute vertrauten gepunkteten Linie. Damit war die Territorialisierung des mittelalterlichen Bündnisnetzwerks bildlich umgesetzt. Das geschah in einem umfassenden Sinn, da die Linie auch die Zugewandten Orte einschloss und selbst die Exklaven (so Rottweil) wie mit einem Lasso an die Schweiz band. Ebenso deutlich wird auf dieser wie auf anderen Karten allerdings, dass es sich nicht um die Vorstellung eines Nationalstaats im Sinn des 19. Jahrhunderts handelte. «Helvetia» fügte sich neu in die Reihe der historischen Regionen wie Burgund, Bayern oder Schwaben, dessen südliche Hälfte seine Kerngebiete ausmachte. Auf dieser unteren Ebene befand es sich nicht in einem Gegensatz zu Frankreich (Gallia) oder Deutschland (Germania), sondern bildete einen Bestandteil des Heiligen Römischen Reichs.
In den zwei Folianten Gemeiner loblicher Eydgnoschaft Stetten, Landen und Völckeren chronickwirdiger thaaten beschreybung, gedruckt in Zürich 1548, erweiterte Stumpf Tschudis Helvetierthese insofern, als er das Kollektiv, das seit jeher seine «althärgebrachten Freyheiten» verteidigte, als ein «Alpenvolck» im «Alpenland» bezeichnete.28 Durch diese Rückbindung an die Landestopografie war die Ethnisierung eines Bündnisses vollzogen, das vor allem Reichsstädte prägten, die mit den Alpen wenig zu tun hatten. Es entsprach aber der Wertschätzung der heimischen Alpen als Ort der göttlichen Offenbarung und seiner Majestät bei den Zürcher Reformatoren Ulrich Zwingli, einem gebürtigen Toggenburger, bei dessen Nachfolger Heinrich Bullinger, zugleich Verfasser einer ungedruckten Eidgenössischen Chronik (1568), oder bei dessen Schwiegersohn Josias Simler, der 1574 ein Werk De Alpibus vorlegte.
Es ist ebenso auffällig wie bezeichnend, dass Bullinger, Simler und Vadian, der Reformator von St. Gallen, in historiografischen Fragen eng mit Aegidius Tschudi zusammenarbeiteten, dem Anführer der Glarner Katholiken und um 1560 Namensgeber des «Tschudikriegs», der seinem Heimatkanton beinahe einen konfessionellen Bürgerkrieg bescherte. Diese erste Generation von humanistisch geprägten Reformatoren und Gegenreformatoren arbeitete ebenso wie die Chronisten um 1500 noch zusammen, um eine solide säkulare Geschichte als verbindende Klammer für die Eidgenossen zu formulieren, wenn schon deren transzendentale Verbindung im gemeinsamen religiösen Eid und Bekenntnis verloren war. Auch deshalb konnten sich die sagenhaften Elemente der Befreiungsgeschichte um Tell als zentrale Bestandteile der schweizerischen Geschichte halten. Denn trotz gelegentlichen Zweifeln waren selbst die Reformierten nicht bereit, solche glorreichen Bezüge zu den eidgenössischen Anfängen preiszugeben. Sogar Bruder Klaus, der 1649 selig gesprochen wurde, blieb im konfessionellen Zeitalter eine vorbildliche Figur, auf die sich beide Glaubensparteien bezogen. Ein weiteres Anliegen verband die Historiker über die Konfessionsgrenzen hinweg. Sie stellten die Kämpfe gegen die Habsburger nicht als illegitime Revolte gegen den Adel dar, sondern als gebotenen Widerstand der ordnungsliebenden Eidgenossen gegen die habsburgischen Usurpatoren. Besonders Tschudi und Simler, dessen Regiment der lobl. Eÿdgenossschaft (1576) oft aufgelegt und übersetzt wurde, betonten, dass die Eidgenossen nicht anarchische Bauern waren, sondern viele Vornehme und auch Adlige zu sich zählten. Das war besonders wichtig in einer Zeit, in welcher Habsburger wie Kaiser Karl V. oder Philipp II., der König von Spanien und Herrscher in Mailand, der Eidgenossenschaft wieder gefährlich werden konnten.
So blieb der kriegerische Gegensatz zu den habsburgischen Tyrannen, wie er nach dem Alten Zürichkrieg formuliert und zuletzt von Tschudi übernommen worden war, ein Grundmotiv des schweizerischen Geschichtsverständnisses. Veränderungen fehlten auch deshalb, weil die Geschichtsschreibung über die Eidgenossenschaft nach den umfassenden und soliden Veröffentlichungen von Stumpf und Simler weitgehend ruhte. Nur zeitlich über sie hinaus führten der Basler Andreas Ryff (Cirkell der Eidtgnoschaft, 1597, ungedruckt) oder der Zürcher Johann Heinrich Rahn (Eidtgnössische Geschicht-Beschreibung, 1690). Sogar die Illustrationen übernahm der Wettinger Abt Christoph Silberysen für seine Schweizerchronik von 1576 aus Stumpfs Werk. Die amtliche Geschichtsschreibung dagegen widmete sich wieder vorwiegend der Geschichte der eigenen Stadt, in der die alles dominierende religiöse Wahrheitsfrage gelöst und nicht, wie in der eidgenössischen Geschichtsschreibung, konfliktträchtig war. Über die lokale Perspektive hinaus blickte man namentlich in Bern, wo Valerius Anshelm mit seiner ungedruckten Chronik (verfasst 1529–1547) und sein Fortsetzer Michael Stettler (Schweitzer Chronic, 1627) in Justingers Fussstapfen traten und eine klare protestantische Position vertraten. Ein habsburgfreundlicher Autor wie der Freiburger François Guillimann wanderte frustriert nach Freiburg i. Br. aus, nachdem sein Werk De rebus Helvetiorum sive Antiquitatum libri V (1598) sich nicht einmal unter Katholiken als Gegenstimme zu den Zürcher Historikern etablieren konnte.
Erst die um 1700 einsetzende Frühaufklärung brachte ein neues Interesse an der gesamteidgenössischen Vergangenheit hervor, das über konfessionelle Differenzen hinwegzuschauen bereit war. Der Zürcher Johann Jacob Scheuchzer erforschte in seiner Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlandes (1706) nicht nur die Topografie der Alpen, sondern formulierte die These eines «Homo alpinus Helveticus»: Der schweizerische Alpenhirt sei dank seiner einfachen Lebensweise nicht nur gesund, kräftig und tapfer, sondern auch tugendhaft und fromm – und politisch frei, was die Schweizer unabhängig von der Religionsfrage grundsätzlich verband.29 Von Albrecht von Haller über Salomon Gessner und Jean-Jacques Rousseau bis zu Friedrich Schiller trugen Dichter zu dieser helvetischen Version des edlen Wilden bei, wie ihn die Aufklärung dem dekadenten Höfling als Gegenbild gegenüberstellte. Da insbesondere Frankreich und seine höfische Kultur diese Figur hervorbrachten, richteten sich der Patriotismus und der Helvetismus des Berners Beat Ludwig von Muralt, des Zürchers Johann Jacob Bodmer, des Luzerners Franz Urs Balthasar und vieler anderer Aufklärer gegen das Fremde, «Unschweizerische». Wenn es, wie beim Solddienst, bei korrupten Amtsleuten oder unduldsamen Klerikern, in der Schweiz selbst zu greifen war, geschah dies umso strenger. In Abgrenzung dazu formulierten die Aufklärer das Ideal sittenreiner republikanischer Selbstbestimmung, die nicht nur die Barrieren der Konfession überwinden sollte, sondern auch diejenigen der Sprache. So zählte die 1762 gegründete Helvetische Gesellschaft, die erste «nationale» Sozietät, neben Reformierten auch einige städtische Katholiken sowie den Waadtländer Pfarrer Philippe-Sirice Bridel zu ihren Mitgliedern. Der frühere «grosse pund obertütscher landen» wurde so allmählich als zweisprachig wahrgenommen in dem Sinn, dass die romanischen Sprachen nicht mehr zwingend ein Zeichen von Untertänigkeit waren.
Dass Bridel zu den Gründern der Geschichtsforschenden Gesellschaft der Westschweiz zählte, war kein Zufall. Die Erforschung der vaterländischen Geschichte war ein Hauptanliegen der Aufklärer, mit dem Ziel, ein neues Nationalgefühl historisch zu begründen. Johann Jacob Bodmer, der auch historische Dramen über Schweizer Helden verfasste und den Volkscharakter in der Alpenlandschaft begründet sah, wirkte mit Lehrbüchern bis hinein in die Realschule. Er gab ab 1735 die erste historische Zeitschrift der Schweiz heraus, die Helvetische Bibliothek, und weitere Sammlungen, die Quellen und ältere Geschichtswerke «zur Historie der Eidgenossen» vereinten. Damit standen Bodmer und sein Mitstreiter Johann Jacob Breitinger nicht allein. Sie gaben postum die Helvetische Geschichte des Berners Jacob Lauffer heraus, eine Kompilation aus ihm zugänglichen Vorgängerwerken. Weitere Werke wie die Historie der Eydgenossen (1758) des Vincenz Bernhard von Tscharner erschienen ebenfalls aus Berner Federn. Viel wichtiger war allerdings Gottlieb Emanuel von Hallers systematische Bibliothek der Schweizer-Geschichte (1788), das erste umfassende Verzeichnis der einschlägigen handschriftlichen und gedruckten Darstellungen und Quellen. Sie beruhte unter anderem auf Bodmers reichhaltigen Notizen und fügte sich ein in eine reiche Editionstätigkeit der Aufklärer. Etterlins Kronika wurde gleich zweimal (1752 und 1764) nachgedruckt. Vor allem aber gab der Basler Johann Rudolf Iselin 1734/36 erstmals Tschudis Hauptwerk als Chronicon Helveticum in den Druck; dessen Vorgeschichte der Schweiz erschien als Gallia comata ebenfalls erstmals gedruckt 1758 in der Edition von Johann Jacob Gallati. Der künftige Zürcher Bürgermeister Johann Jacob Leu gab nicht nur Josias Simlers Regiment der Lobl. Eÿdgenoschaft 1722 und 1734 aktualisiert und kommentiert heraus, sondern stellte auch ein Allgemeines Helvetisches Eydgenössisches … Lexikon (1747–1765) in zwanzig Quartbänden zusammen. Dafür erbat er Informationen aus allen Kantonen, erhielt sie aber nicht aus allen – oft galt historisches Wissen noch als Geheimwissen, zumal bei Leu und anderen Autoren nun zunehmend Gewicht auf der Verfassungsentwicklung lag. Wie im 16. Jahrhundert erfolgte diese gemeineidgenössische Suche nach den historischen Wurzeln konfessionsübergreifend, sodass der Luzerner Joseph Anton Felix Balthasar oder der Zuger Beat Fidel Anton von Zurlauben (Tableaux topographiques, 1780–1788) als wichtige Korrespondenten von Hallers involviert waren. Erstmals beteiligt waren auch Vertreter der französischsprachigen Schweiz wie Abraham Ruchat, dessen Landeskunde Les délices de la Suisse (1714) im Ausland wirkungsmächtiger war als die zahlreichen Veröffentlichungen von Deutschschweizern.
Von diesem Urteil auszunehmen sind jedoch die weit über die Landesgrenzen hinaus wirkungsreichen Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft (1780–1808) des Schaffhauser Aufklärers Johannes (von) Müller. Er zog gleichsam die Summe aus den vielen Texten, die im 18. Jahrhundert neu zugänglich wurden, und ordnete diese in die Fragestellungen zu Landesbeschaffenheit, Volks- und Zeitgeist, Verfassungswandel und Vergänglichkeit ein, die Montesquieu und andere Aufklärer formuliert hatten und die in der Revolutionszeit hochaktuell waren. Müller stand selbst in den Diensten deutscher Fürsten und wurde 1791 vom Kaiser geadelt. Die Geschichte seiner Heimat, die er bei seinem Tod von den Helvetiern bis 1493 erzählt hatte, stilisierte er dagegen als kollektive Verwirklichung der Freiheit, die «unsere Väter durchaus und einmüthig», treu und tapfer, tugendhaft, patriotisch und christlich-fromm zu wahren wussten. Das so gezeichnete Vorbild der Alten sollte im Untergang der Alten Eidgenossenschaft und während der krisenhaften Helvetischen Republik volkspädagogisch Orientierung stiften. Nicht ein Fürst, sondern das schweizerische Volk in der durch die Alpen geprägten «Untilgbarkeit seines Nationalcharakters» war Hauptdarsteller und fand in einer freiheitlichen Verfassung seine wesensgemässe Bestimmung. Das trug im Umfeld von Französischer Revolution und Romantik zum enormen Erfolg des vielbändigen Werks vor allem in Deutschland bei.30 Schillers Wilhelm Tell beruhte auf dem «glaubenswerten Mann» Johannes Müller, wie er augenzwinkernd im Drama genannt wird, und über ihn auf Tschudi.
Dass v. Müller für Jahrzehnte die literarischen und moralischen Standards der Schweizer Geschichte gesetzt hatte, zeigte sich an den zahlreichen Fortsetzungen und Aktualisierungen seines Werks, die Robert Glutz-Blotzheim, Johann Jakob Hottinger, Louis Vulliemin und Charles Monnard in den Jahrzehnten bis 1851 verfassten. Letzterer übersetzte v. Müller auch ins Französische, und 1853 lagen umgekehrt diese Fortsetzungen auch auf Deutsch vor, sodass dem jungen Bundesstaat gleichsam eine zweisprachige Darstellung seiner Vorgeschichte bis ins frühe 19. Jahrhundert zur Verfügung stand. Die Schilderung des Gemeinsinns jenseits der Egoismen und der verbindenden christlichen Religion als dauerhafter sittlicher Basis trat an die Stelle von konfessionspolitischen Untertönen und Polemiken, auch wenn die Nationalgeschichte im 19./20. Jahrhundert eine Domäne von protestantischen Historikern blieb. Freiheit war ihr Leitmotiv, aber die elitären, religiösen und föderalistischen Autoren verstanden darunter keine Freiheit, die auf die nationale Demokratie enggeführt worden wäre. Die populäre Vermittlung v. Müllers und nicht zuletzt der Befreiungslegende war dagegen die Mission des aus Magdeburg eingewanderten liberalen Pädagogen und Politikers Heinrich Zschokke, über seine publizistische Tätigkeit für den Schweizerboten ebenso wie in Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolk (1822). Sein Lob des Volkes, das sich seiner Überlieferung verpflichtet fühlen und von seinen Nachbarn abgrenzen solle, hatte einen grossen Erfolg und inspirierte vaterländische Feiern ebenso wie Volkslieder und Historiengemälde. Über die Sprachgrenze hinweg wirkte Zschokke ab 1849, als der liberale Freiburger Katholik Alexandre Daguet dessen Schweizergeschichte in einer französischen Bearbeitung vorlegte.
Ebenfalls ein Katholik, allerdings ein Konservativer, der Luzerner Joseph Eutych Kopp, verwarf 1835 in Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde nicht nur Tell, sondern auch den Rest der Befreiungslegende, wie sie v. Müller, Zschokke und andere besungen hatten, die der Urschweiz durch Herkunft und Mentalität viel ferner standen als Kopp. Seine Quelle war nicht mehr die ältere Historiografie, sondern das Archiv mit seinen Urkunden. Das entsprach der Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung, wie sie vor allem in Deutschland betrieben wurde und die jede Epoche, mit Leopold von Ranke gesprochen, als «unmittelbar zu Gott» betrachtete. Das galt auch für das Mittelalter, das Kopp nicht nationalgeschichtlich auf eine Gründungsphase der Schweiz reduzieren wollte. Zu den Urkunden, die er edierte oder mit einem neuen Blick würdigte, gehörte auch der Bund von Uri, Schwyz und Unterwalden von 1291, dem er aber wenig Bedeutung beimass. Er zeichnete ein positives Bild von den Habsburgern, und in den mittelalterlichen Urkunden entdeckte er nicht die Vorgeschichte einer liberalen Schweiz, sondern eine offene Situation mit vielen Akteuren und zeitgebundenen, kurzfristigen Zielen.
Kopp begründete 1839 die Eidgenössischen Abschiede, die Sammlung der Beschlussprotokolle, die bei den Treffen der Eidgenossen und später der Tagsatzung angefertigt worden waren. Ein anderer Luzerner, Philipp Anton von Segesser, setzte diese Edition später fort, die als Langzeit-Editionsprojekt des Bundes schliesslich alle Abschiede bis ins Jahr 1848 umfassen sollte. Dieses Datum betrachteten die ersten Bearbeiter der Abschiede mit gemischten Gefühlen, die Alte Eidgenossenschaft dagegen nicht ohne Nostalgie. Segesser war der Anführer der katholisch-konservativen Verlierer des Sonderbundskriegs im schweizerischen Parlament und Verfasser von Werken vor allem zu Luzern, das ihm als Heimat näher stand als der neue Bundesstaat. Der Konfessionalismus und Föderalismus von Segesser und Kopp sowie ihre Bewunderung für imperiale Strukturen verweigerten sich durch den Rekurs auf sperrige Urkunden den zielgerichteten Nationalgeschichten der Liberalen. Letztere suchten in den neu greifbaren Quellen die Bestätigung dessen, was sie im Mythos vorgegeben fanden. Dessen Ursprung fanden die beiden Zürcher Historiker Gerold Meyer von Knonau und Georg von Wyss 1854 praktisch gleichzeitig im Weissen Buch von Sarnen, um sich dann über die Rolle des Entdeckers zu zerstreiten.
Von Wyss verwies zugleich die Gründungslegende der Waldstätte in das Reich der Phantasie, weil sie urkundlich nicht belegt war. Die «kritische Schule» verwirklichte sich nicht zuletzt dank Institutionen: Um die Jahrhundertmitte wurden an den jungen Universitäten historische Seminare gegründet, oft mit eigenen Professuren für die vaterländische Geschichte. Diese verdankten ihre Methode Studienjahren in Deutschland, wo der deutsche Historismus um Ranke die systematische Quellenkritik vorbildlich vermittelte. Neben kantonale traten nun nationale Gesellschaften und Zeitschriften, namentlich die Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz (1841) und ihr Jahrbuch, später die Zeitschrift für schweizerische Geschichte. Archive wurden als Teil der demokratischen Öffentlichkeit und Transparenz für das Publikum geöffnet. 1849 erhielt das 1798 gegründete Bundesarchiv in Bern seinen eindeutigen Auftrag. Manche Editionen von ungedruckten Quellen, nicht zuletzt der mittelalterlichen Chronistik, erblickten das Licht, finanziert von staatlichen Institutionen. Die Impulse waren dieselben wie in den anderen entstehenden Nationalstaaten Europas, die ihre Anfänge möglichst weit zurück ins Mittelalter verlegten. Sie wollten ihr Territorium und gegebenenfalls territoriale Ansprüche gegen aussen rechtfertigen und im Inneren eine Volksgemeinschaft postulieren, die sich nicht durch die wachsenden Klassengegensätze auseinanderdividieren liess. Ebenso wichtig war es für die Schweiz im Zeitalter der deutsch-französischen «Erbfeindschaft», die historischen Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sprachgemeinschaften auf ihrem Territorium zu entdecken und für die «Willensnation» zu betonen.
Gerade wegen der internationalen Konkurrenz auch in den Geisteswissenschaften war Wissenschaftlichkeit gefragt. Die Historiografie wandte sich ab von der literarisch möglichst ansprechenden oder zumindest eingängigen Nacherzählung dessen, was andere Historiker schon überliefert hatten. Wichtig wurde die Erforschung von neuen Themen, die sich möglichst auf Urkunden und andere Realien aus der Untersuchungszeit stützte. Ein Winter mit niedrigem Wasserstand brachte am Zürichsee Reihen von Pfählen und andere Siedlungsreste zum Vorschein. Ferdinand Keller veröffentlichte auf dieser Grundlage 1854 Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen. Wie der Titel besagte, hatte man es bei den Pfahlbauten (die heutige Archäologen nicht mehr als solche ansehen) mit einem Phänomen zu tun, das (nur) für die «Schweiz» charakteristisch war. Zeitlich vor den Helvetiern und wissenschaftlich solider, da nicht nur bei Geschichtsschreibern belegt, trat so im jungen Bundesstaat eine nationale Urbevölkerung auf den Plan, die vor allem in populären Darstellungen ebenfalls als Projektionsfläche für helvetische Tugenden und Freiheitsliebe dienen konnte.
Als «Siegesfest der Wissenschaft» galt unter diesen Umständen, dass das Gründungsdatum 1307 für die Eidgenossenschaft, das Tschudi und nach ihm v. Müller überliefert hatten, dem Jahr 1291 weichen musste, dem frühesten urkundlichen Beleg für den Bund der Waldstätte.31 Dass dieser der – zudem «ewige» – Kern war, aus dem die Eidgenossenschaft durch Anschlüsse entstand, übernahm allerdings die liberale Geschichtsschreibung, die um 1891 neue Synthesen vorlegte. Drei befreundete reformierte Freisinnige aus der östlichen Schweiz akzeptierten die Resultate der «kritischen Schule» um Kopp, wollten aber zugleich in positivem Sinn umfassende Darstellungen der Nationalgeschichte schaffen: Karl Dändliker (Geschichte der Schweiz, 1883-84), Johannes Dierauer (Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1887–1917; auf Französisch übersetzt 1910–1913) und Wilhelm Oechsli (Die Anfänge der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1891). Oechslis Werk wurde begleitet von einer verfassungsgeschichtlichen Studie zu den Bundesverfassungen. Sie stammte aus der Feder von Carl Hilty, der die Schweizergeschichte als «Sittenlehre in nationalhistorischem Gewand» betrachtete, die sich nicht nur über die «bloss legendäre Darstellung», sondern auch über die «unfruchtbare Gelehrsamkeit» erheben müsse, also über die kritische und insofern destruktive Schule, als sie den «längst vergangenen Dingen» kein neues Leben einhauche. Als Moral aus der von Hegel inspirierten Fortschrittsgeschichte, welche den schweizerischen, politischen Volksgeist über die blosse Bluts- und Sprachgemeinschaft der anderen Nationen erhob, postulierte Hilty für Zeitgenossen und Nachfahren: «Die politische Selbständigkeit eines freiheitlich organisierten Volkes ist jedem anderen Gute für immer vorzuziehen».32
In einer Zeit, in der nationale Schlachtenfeiern wie in Sempach (1886) Aufsehen erregten und in Zürich das Schweizerische Landesmuseum mit Ferdinand Hodlers Marignano-Fresken eingeweiht wurde (1898), unterzogen sich die Historiker dem volkspädagogischen Auftrag unterschiedlich stark. Dändliker versuchte, die Wissenschaft mit der volkstümlichen Überlieferung auf der Suche nach dem «Geist der Freiheit und Volksherrschaft» in Übereinstimmung zu bringen. Er weigerte sich, «alles Hergebrachte zu negiren», sondern beliess der Legende ihre Berechtigung, wenn er einen historischen Kern erkennen konnte.33 Den Befreiungssagen am entferntesten stand Dierauer, der auf der Basis der Eidgenössischen Abschiede eine nüchterne und präzise Ereignisgeschichte vorlegte, die sich patriotischen Bedürfnissen verweigerte, wenn diese die «sorglose Überlieferung des Volkes» nachsichtig behandelte.34 Diese Strenge war geboten, denn Dierauers Bände erschienen in einer deutschen Reihe zur Geschichte der europäischen Staaten neben vielen anderen Nationalgeschichten, sodass er sich an internationalen Standards messen lassen musste. Oechsli verwarf die Befreiungslegende ebenfalls, deutete aber die mittelalterlichen Schlachten mit klarem Gegenwartsbezug als Kampf von «Bürgern und Bauern» gegen die Adelsmacht.35 Erneut am stärksten bei Dändliker, aber allen gemeinsam war der kritische Blick auf das Ancien Régime als einer Zeit der konfessionellen Konflikte, der aristokratischen Willkür und politischer Fremdbestimmung. Der Bundesstaat erschien in diesen Fortschrittsnarrativen einerseits als Verwirklichung aufklärerisch-liberaler Postulate, andererseits aber auch als Rückkehr zur Anerkennung und zum Respekt, den die mittelalterlichen Eidgenossen erfahren hatten. Diese Geschichtsvision wirkte nicht zuletzt über Popularisierungen wie jene von Johannes Sutz, Schweizer Geschichte für das Volk erzählt (1899), oder Emil Frey, Die Kriegstaten der Schweizer dem Volk erzählt (1904). Freys Schilderung, «wie die wetterharten Bauern und Hirten des schweizerischen Berglandes um ihrer Freiheit willen zum Schwert greifen», war programmatisch für ein Genre, das in der mehrbändigen Schweizer Kriegsgeschichte (1915–1923) ihren Höhepunkte erlebte: Auf Anregung des Generalstabschefs der Armee stellten führende Historiker die Entwicklung von den Helvetiern bis 1914 aus der militärischen Perspektive dar.36
Das gemässigt freisinnige Geschichtskonzept, insbesondere Oechslis Fixierung von 1291 als Gründungsdatum, integrierten an zentraler, staatsbegründender Stelle die katholisch-konservativen Verlierer des Sonderbundskriegs, also namentlich die «Urschweiz». Die Sieger von 1847/48 erkannten ihnen diesen Ehrentitel zu und orchestrierten damit den 1891 erfolgten Eintritt der Katholisch-Konservativen in den Bundesrat. Ebenfalls im historischen Umfeld zu verstehen ist die Geschichte der schweizerischen Neutralität des Zürcher Staatsarchivars Paul Schweizer. Er reagierte damit 1895 auf die Wohlgemuth-Krise, einen Spionagefall, der Bismarck zu Ausfällen gegen die Schweiz und ihre aussenpolitische Maxime veranlasste. Im Bemühen, sie auch historisch zu legitimieren, deutete Schweizer nach intensiven Archivrecherchen die frühesten Belege etwa für das «Stillesitzen» als eidgenössische Form der Neutralität.
Die liberale Geschichtsvision erlebte Fortsetzungen und Aktualisierungen etwa durch den Zürcher Professor Ernst Gagliardi, wogegen die konkurrierenden politischen Lager sie kaum in Frage stellten. Die katholisch-konservativen Historiker mochten keine alternative Perspektive auf die Nationalgeschichte entwerfen. Autoren der mit Geschichtslehrstühlen gut ausgestatteten Universität Freiburg, namentlich Joseph Hürbin (Handbuch der Schweizer Geschichte, 1900/06) oder Gaston Castella (Histoire de la Suisse, 1928), setzten nur bei konfessionellen Themen andere Duftnoten als ihre reformierten Vorläufer um Dierauer. Die meisten katholischen Historiker blieben wie der Nidwaldner Robert Durrer in ihrem föderalistisch-konfessionellen Lagerdenken auf Figuren wie Bruder Klaus und Carlo Borromeo ausgerichtet. Eine Ausnahme war allein die reaktionär-ständestaatliche Geschichtsvision des Freiburger Patriziers Gonzague de Reynold (La démocratie et la Suisse, 1929). Auf der Linken schrieb der Sozialdemokrat Robert Grimm seine Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkämpfen nicht auf der Grundlage eigener Forschungen, sondern 1920 während seiner Haft nach dem Landesstreik. Er stützte sich vor allem auf Dändliker und Dierauer, doch betonte Grimm gegen die harmonisierende Sicht der Nationalgeschichte die vielen, oft gewaltsamen Konflikte als Motor der emanzipatorischen Entwicklung. Dazu zählte der Kampf der «Bauern» um 1300 gegen den «Adel», worin Grimm die liberale und konservative Narration übernahm. Auf eigenen Forschungen beruhte die Geschichte der Schweiz (1941) von Grimms Parteigenossen, dem Historiker und Nationalrat Valentin Gitermann. Es war ein aussergewöhnlicher Blick «ohne beschönigende Retouchen» auf die Nation, insofern der jüdische Flüchtling erst fünfjährig aus der Ukraine in die Schweiz gelangt war. Sein ausgewogenes Werk erntete neben Anerkennung auch scharfe Kritik, weil es nicht in der schweizerischen Geschichtsforschung wurzle und er die bündische Ausbildung des christlichen Volksstaats im Mittelalter nur eilig behandelt habe.37 Gitermanns materialistischer Ansatz, der grossen Persönlichkeiten sowie der Militär- und Geistesgeschichte wenig Raum widmete, galt als linke Methode. Das erklärt die Randstellung, welche die Wirtschafts- und Sozialgeschichte beibehielt, obwohl durchaus liberale Historiker wie William Rappard, Eduard Fueter oder Hans Nabholz in diesen Bereichen schweizergeschichtliche Beiträge leisteten. Sie verfassten allerdings keine Gesamtdarstellungen, und Erstere beide schrieben mit einem klaren Fokus nicht auf die mittelalterlichen Anfänge, sondern auf den Bundesstaat seit 1848.
Die Westschweizer schauten zwar gelegentlich mit föderalistischem Misstrauen, aber nach den Verwerfungen, die es im Ersten Weltkrieg zwischen den Sprachgruppen gegeben hatte, insgesamt sehr wohlwollend auf die Entwicklung vom Staatenbund zum und im liberalen Bundesstaat, der ihre Autonomie garantierte. Im Unterschied zu den Deutschschweizern beschrieben die Vertreter der Minderheit eher die Ausbildung staatlicher Strukturen in ihrem internationalen Umfeld denn die Entfaltung einer Nation aus sich selbst heraus. Von einem französischen «Joch» nach 1798 sprach aber auch der Journalist William Martin in seiner Histoire de la Suisse: Essai sur la formation d’une confédération d’états, die erstmals 1928 erschien und danach sehr oft neu aufgelegt wurde, für die neuere Zeit mit Ergänzungen von Pierre Béguin. Ähnliches gilt für die vielfach nachgedruckte Histoire de la Suisse (1944) von Charles Gilliard. Der liberal-reformierten, aber auch einer konservativ bernischen Tradition verpflichtet war die «Viermännergeschichte» von Hans Nabholz, Leonhard von Muralt, Richard Feller und Edgar Bonjour, womit erstmals Spezialisten die unterschiedlichen Epochenbeiträge schrieben. Nabholz war von diesen Autoren methodisch am differenziertesten und akzeptierte zwar die sagenhafte Überlieferung als «Verkörperung der Freiheitsidee», doch war ihm klar: «Unsere Darstellung von der Entstehung der Eidgenossenschaft weicht stark von dem Bilde ab, das jeder Schweizer von diesen Vorgängen lebendig vor Augen hat und das sich von Generation zu Generation weitervererbt.»38
Die Formulierungen zeigten bereits die Ausrichtung auch der Historikerzunft auf die Geistige Landesverteidigung der 1930er-Jahre. Die Diskrepanz zwischen dem Forschungsstand und den volkstümlichen Vorstellungen von der Schweizergeschichte war ihr bewusst. Doch der Appell an Freiheit und Opferbereitschaft hatte nichts Theoretisches, wenn ein völkisches Grossdeutschland im Norden drohte, von Süden der faschistische Irredentismus, der alle Italienischsprachigen in einem Staat vereinen wollte. Die Rede vom «Sonderfall» erfüllte nun eine existentielle Aufgabe. Sie legitimierte einen Staat, dessen Gemeinschaft nicht Blut und Sprache definierten, sondern Geschichte und, in Ernest Renans Worten, das alltägliche Plebiszit der Bürger. Die Einheit in der Vielfalt war in der Argumentation des federführenden Bundesrats Philipp Etter das Wichtigste: Viersprachigkeit, kulturelle Mittlerrolle, föderalistische Bundesstruktur, Gemeindeautonomie und Menschenwürde in einem christlichen Sinn. Gegenüber diesem Erbe der Alten Eidgenossenschaft traten die Errungenschaften von 1848 zurück: parlamentarische Demokratie, individuelle Freiheit und Gleichheit, eine liberale Wirtschaftsordnung. Definiert wurde der Sonderfall aussenpolitisch damit nicht nur in Abgrenzung zu den rechten und linken Totalitarismen, sondern auch zu den demokratisch legitimierten Volksfrontregimes in Frankreich und Spanien und den angloamerikanischen Modellen.
In gewisser Hinsicht hatte die schweizerische Historikerzunft Glück. Einer der Ihren, der Luzerner Katholik Karl Meyer, glaubte selbst an das, was er mit der Autorität eines Professors in Zürich verkündete: Die Befreiungserzählung einschliesslich der Tellensage war nicht Legende, sondern wahre Geschichte, und der einstige Widerstand genossenschaftlicher Kommunen gegen den fremden Adel gab das Modell für die Verteidigung des demokratischen Sonderfalls in der gegenwärtigen Bedrohung ab.39 Ähnlich erklärte der erwähnte Robert Durrer 1934 Winkelried gegen die «Pseudokritik des 19. Jahrh.» wieder zur historischen Figur.40 Dieser Rückschritt hinter Kopps hundert Jahre zuvor etablierte Quellenkritik provozierte klaren Widerspruch von fachkundigen Kollegen. Allein, Meyers Darlegungen fügten sich gut in die politische und gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass die Vergangenheit Identität und Kontinuität stiften solle. 1941 beging der Bundesrat in diesem Geist zusammen mit General Guisan den 650. Geburtstag der Schweiz im kurz zuvor eingeweihten Schwyzer Bundesbriefarchiv, um in den ernsten Stunden die Verpflichtung gegenüber den Ahnen und ihr Vorbild zivil und religiös zu unterstreichen.
Die biografische Erfahrung der Kriegsjahre und vor allem des militärischen Aktivdiensts prägte die grosse Zahl von schweizergeschichtlichen Texten, die nach 1945 verfasst wurden und sich oft an ein weiteres Publikum wandten, so die Schriften von Georg Thürer, eines Schülers von Karl Meyer (Bundesspiegel. Werdegang und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1948). Es fällt auf, dass viele der Autoren nach oder neben ihrer historiografischen Tätigkeit politische Ämter übernahmen und sich somit in doppelter Hinsicht vaterländisch-gouvernemental betätigten. Gottfried Guggenbühl (Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, 1947/48) war Zürcher Erziehungsrat; Peter Dürrenmatt (Schweizer Geschichte, 1957)vertrat den Kanton Basel-Stadt im Nationalrat; von den Autoren der wiederholt aufgelegten Illustrierten Geschichte der Schweiz (1958–1961) wirkte Karl Schib kurz als Kantonsrat und Sigmund Widmer als langjähriger Stadtpräsident von Zürich. Sie fügten sich in eine lange Reihe von Parlamentariern und Bundesräten ein, die Werke zur kantonalen oder nationalen Geschichte verfassten, wenn auch nicht unbedingt Gesamtdarstellungen. Bei den Bundesräten führte diese Tradition von Emil Freys erwähnten Kriegstaten der Schweizer (1904) über Markus Feldmann, den Koordinator der genannten Schweizer Kriegsgeschichte (1915–1923), bis Georges-André Chevallaz (Le défi de la neutralité, 1995, deutsch 1997).41 Vom Widerstandsgeist gegen den italienischen Faschismus und Irredentismus geprägt waren Guido Calgari und Mario Agliati, die 1969 eine Storia della Svizzera vorlegten.
Ihre Hauptwirkung verdankte die Nationalgeschichte, welche die Geistige Landesverteidung der 1930er-Jahre in den Kalten Krieg transportierte, allerdings weniger der Geschichtsschreibung, selbst wenn sie volkstümlich präsentiert wurde, als dem Schulunterricht und den pädagogischen Schriften etwa des Schweizerischen Jugendschriftenwerks SJW (so 650 Jahre Eidgenossenschaft, 1941). Der Lehrplan für die Berner Primarschulen, der von 1947 bis 1982 gültig war, hielt fest: «Die nationale Aufgabe erfüllt der Geschichtsunterricht in unserem Vaterlande dann, wenn er zum guten Eidgenossen erziehen hilft. Zum guten Eidgenossen gehört das eidgenössische Bewusstsein. Dieses beruht auf einer gewissen Kenntnis der Wesenszüge unseres Staates und unserer Geschichte, aber auch auf einem Empfinden der Unterschiede zwischen uns und den andern.»42 In einem für den Schulunterricht verfassten Buch, Wir wollen frei sein wie die Väter waren, forderte Franz Meyer 1961, den historischen Vorbildern zu folgen: «Auch wir sind bereit, für unser Vaterland Opfer zu bringen, für das Heimatland auf etwas zu verzichten, dem Lande einen Dienst zu erweisen und für die Heimat zu beten. Nur so verdienen wir es, in einem freien Lande leben zu dürfen.» Meyer rettete die mittelalterlichen Legenden zumindest in ihrem didaktischen Kern: «Wir wissen, dass die mündliche Überlieferung Fehler und Ungenauigkeiten enthalten kann. […] Und trotzdem sind diese Geschichten wahr. Das Volk der Hirten stand auf, starke Landammänner führten es, und mutige Helden setzten ihr Leben ein für die Freiheit dieses Volkes.»43 In der Wissenschaft waren solche Positionen nicht mehr haltbar, nachdem der Zürcher Professor Marcel Beck das Vorgehen Karl Meyers und seiner Schule zerzaust hatte. Der Beck-Schüler und Schriftsteller Otto Marchi popularisierte den Kenntnisstand 1971 mit seiner Schweizer Geschichte für Ketzer.
In der Schule dagegen machte die heroische Verteidigung der Freiheit gegen die Habsburger und andere fremde Bedrohungen lange den Hauptteil des schweizergeschichtlichen Unterrichts aus. Die Moral aus der Masslosigkeit der Söldner und der Niederlage von Marignano war die Neutralität, die als aussenpolitischer Grundzug danach die Narration bestimmte, unterbrochen nur durch Napoleon, der die «Franzosenzeit» um 1800 repräsentierte. Die internen Gegensätze wurden gleichsam von der harmonischen Versöhnung her erzählt und aufgefangen: vom Stanser Verkommnis bis zum «Friedensabkommen» in der Metallindustrie von 1937. Die schweizergeschichtlichen Schulbücher begannen sich erst seit den 1970er-Jahren allmählich zu ändern. Die Schweiz wurde als Teil ihrer europäischen Umwelt vorgestellt, ihre Vergangenheit nicht auf das Militärische reduziert, und bei der Behandlung der Helvetik (1798–1803) kamen nun auch positive Aspekte zur Sprache.44
Diese Veränderungen fügten sich in einen allmählichen Wandel, der greifbar wurde, wenn sich Brüche im nationalen Geschichtsbild auftaten. Ein politischer Reflex bestand dann jeweils darin, dass der Bundesrat in der internationalen Tradition der «Weissbücher» historische Fakten von Fachleuten abklären liess.45 So verfasste der frühere Basler Regierungsrat Carl Ludwig 1957 einen nach ihm benannten Bericht über die schweizerische Flüchtlingspolitik im Krieg, als die offizielle Publikation der Akten zur deutschen auswärtigen Politik in der Bundesrepublik belegte, dass der J-Stempel in Pässen deutscher Juden 1938 auf schweizerische Anregung eingeführt worden war. Als weitere Aktenpublikationen und ein Buch des englischen Journalisten Jon Kimche die Neutralitätspolitik im Krieg in ein fragwürdiges Licht stellten, veranlasste die Landesregierung einen prominenten Zeitzeugen, den Basler Geschichtsprofessor Edgar Bonjour, seine Geschichte der schweizerischen Neutralität zu verfassen. Er erhielt ungehinderten Zugang zu den Archiven, doch der Bundesrat willigte in die Veröffentlichung des Berichts ab 1967 erst ein, nachdem Medien und Parlamentarier dies eindringlich gefordert hatten. Die letzten drei Bände, die für die Kriegszeit relevant waren, erschienen auch auf Französisch. Bonjour zeigte sich durchaus kritisch gegenüber einzelnen Aspekten der bundesrätlichen Politik im Krieg. Ihre Gesamtbeurteilung konzipierte er allerdings als folgerichtige Fortsetzung seiner schon früher verfassten Darstellung der schweizerischen Neutralität, die er – wie Paul Schweizer 1895 – möglichst früh, nämlich mit Niklaus von Flüe beginnen liess. So konnte er das Fazit aus den Kriegsjahren ziehen, dass die Neutralität nicht nur mitentscheidend gewesen sei für die Wahrung der Selbständigkeit, sondern dass die Verpflichtungen, die sich aus ihr ergaben, gegenüber dem Ausland erfüllt worden seien.46
Zu strengeren Urteilen kamen in denselben Jahren um 1968 eine wachsende Zahl von Journalisten und Schriftstellern wie Walter Matthias Diggelmann, Christoph Geiser, Max Frisch und Niklaus Meienberg, die ihre publizistischen Finger in die unheroischen Wunden der Kriegszeit legten.47 Die Historikerzunft griff diese heiklen Themen etwas später auf, in den 1980er-Jahren, nachdem die Sperrfrist im Bundesarchiv auf 35 Jahre reduziert worden war und ab 1979 die zahlreichen Bände der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (von 1848 bis 1945, gegenwärtig fortgesetzt bis 1989) das dort gesichtete Quellenmaterial gedruckt zugänglich machten. Autoren wie Werner Rings oder Jakob Tanner untergruben die Doktrin, dass die wirtschaftliche Kooperation mit dem Dritten Reich nur den Geboten der Not gehorcht hatte. Markus Heiniger behandelte 1989 Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde. Seine Antwort liess sich auf die Formel reduzieren: wirtschaftliche Dienstleistungen und militärische Bedeutungslosigkeit. Georg Kreis und Hans Ulrich Jost sprachen vom «Helvetischen Totalitarismus», um das Vollmachtenregime und den Geist der Kriegsjahre zu charakterisieren.
Aufsehen erregte dies auch deshalb, weil Jost diese Formulierung 1983 im Referenzwerk Geschichte der Schweiz und der Schweizer wählte. Es wollte das solide, aber stark ereignis- und verfassungsgeschichtlich angelegte Handbuch der Schweizer Geschichte (1972/1977) ergänzen, wenn nicht sogar ablösen. Ausländische Einflüsse, vor allem das Modell einer «histoire totale» im Sinn der französischen Annales-Schule, prägten das Konzept der Geschichte der Schweiz und der Schweizer, die auf Deutsch, Französisch und Italienisch erschien. Sie wertete die politische und militärische Geschichte der «grossen Männer» ab zugunsten der langfristigen Entwicklungen, die den Alltag der «normalen Menschen» bestimmten und möglichst mit quantitativen Quellen und statistischen Methoden erfasst wurden: Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft, sozialer Wandel, Mentalitäten. Für viele dieser Phänomene war der Nationalstaat Schweiz nicht der geeignete Darstellungsrahmen, weil es zwischen den Landesteilen sehr viele Unterschiede gab. Die Verschiebung der Erkenntnisinteressen trug dazu bei, dass die Nationalgeschichte im folgenden Vierteljahrhundert erheblich an Bedeutung verlor. Für eine «histoire totale» eigneten sich die Kantone besser, deren Geschichte zum Gegenstand eines eigentlichen Wettbewerbs um die gründlichste Erforschung und höchststehende Präsentation wurden. Sie integrierten weitere neue Ansätze, etwa die Frauen- und Geschlechtergeschichte. Beatrix Mesmer war eine Mitherausgeberin der Geschichte der Schweiz und der Schweizer, doch Beiträge aus weiblicher Hand zu schweizergeschichtlichen Gesamtdarstellungen finden sich erstmals im Handbuch Die Geschichte der Schweiz, das Georg Kreis 2014 herausgegeben hat.
Praktisch alle diese neuen Schweizer- und Kantonsgeschichten umfassten mehrere Bände, in denen Experten die jeweiligen Epochen behandelten. Diese Spezialisierung war wie die neuen inhaltlichen und methodischen Interessen ein Zeichen dafür, dass die schweizerischen Geschichtswissenschaftler Anschluss an internationale Entwicklungen fanden. Schweizergeschichte war nicht mehr ein Geschäft für sich, das als Entfaltung der Nation über die Jahrhunderte hinweg verfolgt wurde, sondern unterteilte sich mit einem vergleichenden Blick auf ausländische Forschungen in eigenständige Epochen. In der universitären Lehre und in ihren Prüfungen waren nicht unbedingt Themen aus der Schweiz stark rückläufig, wohl aber solche der Nationalgeschichte. Der Internationalisierung entsprach es, dass die Zeitschrift für schweizerische Geschichte schon 1951 einen neuen Namen erhielt: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Das Historische Lexikon der Schweiz, welches das Historisch-Biographische Lexikon der Schweiz (1921–1934) ablöste und von 2002 bis 2014 in drei Landessprachen erschien, behandelte nicht nur die vielen Personen und Orte im Land, sondern präsentierte in Sachartikeln Phänomene, die bereits im Ausland Gegenstand der Forschung geworden waren.
Wie stark sich das populäre Geschichtsbild und die universitäre Forschung auseinandergelebt hatten, zeigte sich 1986 beim Jubiläum der Schlacht bei Sempach, dann 1989, im Umfeld des Mauerfalls und der Armeeabschaffungsinitiative, und 1991 bei der Jubiläumsfeier «700 Jahre Eidgenossenschaft», die in ihrer ursprünglich geplanten Form scheiterte. 1995 wurde die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg gar zum Thema internationaler Polemiken. Vor allem Amerikaner formulierten Anschuldigungen über die schweizerische Kollaboration mit Nazideutschland, die zum Teil aus der Luft gegriffen waren und zum Teil auf solider Quellengrundlage beruhten. Dazu gehörte kaum etwas, was den Fachleuten nicht bekannt gewesen wäre. Aber weite Kreise, nicht zuletzt viele Angehörige der Aktivdienstgeneration, die damals Militärdienst geleistet hatten, empfanden die Weltkriegsdebatte als Demütigung der Schweiz und ihrer Leistungen im Weltkrieg. Der Bundesrat setzte erneut eine Kommission zur «historischen Wahrheitsfindung» ein, die von Jean-François Bergier geleitet wurde. Sie legte 2002/03 in zahlreichen Einzeluntersuchungen und einem Schlussbericht ihre Einschätzung vor, wie sich die Schweiz, namentlich ihre Unternehmen und der Finanzplatz, verhalten hatte. Die Konfrontation mit dem Forschungsstand führte zu heftigen öffentlichen Debatten: «Junghistoriker» erschienen den einen als besserwisserische «Nestbeschmutzer» und marxistische «Schweizhasser», während die anderen forderten, endlich mit den Geschichtsmythen aufzuräumen.48
Geschickt nutzten vor allem die Schweizerische Volkspartei (SVP) und ihre Schwesterorganisation, die Aktion für eine neutrale und unabhängige Schweiz (AUNS), das vergangenheitspolitische Thema, das viele als Frage der nationalen Ehre ansahen. Ihr Anführer Christoph Blocher ordnete die Auseinandersetzung um Entschädigungszahlungen und deren Gegenstand in den jahrhundertelangen Widerstand gegen Aggressoren und in diesem Fall «Erpresser» aus dem Ausland ein. Diese Argumentation fügte sich gut in das rhetorische Abwehrdispositiv, das die Nationalkonservativen bereits gegenüber dem Europäischen Wirtschaftsraum (1992) und gegenüber der Europäischen Union pflegten, in der sie eine zentralistische und imperialistische Grossmacht erblickten. Diese Überzeugung ergab sich nicht aus neuen historischen Publikationen oder eigenständigen Forschungen. Im Gegenteil, die Nationalkonservativen wiederholten bloss, aber mit anhaltendem Erfolg die Kernelemente des Geschichtsbilds, wie es im Kalten Krieg für die politischen Parteien bis weit in die Linke hinein und für grosse Teile der Bevölkerung Gültigkeit gehabt hatte. Einleitend zu den hier folgenden Kapiteln wird diese Position jeweils durch ein Zitat der beiden SVP-Bundesräte Christoph Blocher oder Ueli Maurer illustriert. Es bildet den Ausgangspunkt zu den folgenden Überlegungen, ob und wie weit die schweizerischen Heldengeschichten der historischen Überlieferung entsprechen und angemessene Modelle für die Zukunft liefern.