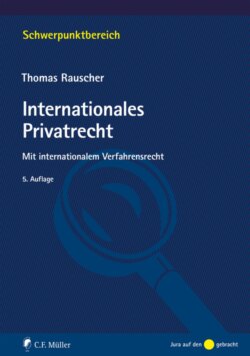Читать книгу Internationales Privatrecht - Thomas Rauscher - Страница 78
1. Bedeutung der Staatsangehörigkeit als Anknüpfungskriterium
Оглавление190
a) Die Staatsangehörigkeit ist seit Mancini in Kontinentaleuropa das wichtigste Anknüpfungskriterium für das Personalstatut. Dieser Begriff meint Rechtsangelegenheiten, die einen – oder mehrere – Beteiligte persönlich angehen. Die Staatsangehörigkeit wird überwiegend als rechtliche Eigenschaft verstanden, die eine Person einem bestimmten Staat zuordnet und diesem Staat gegenüber zum Träger von Rechten und Pflichten macht. Außerdem gewährt die Staatsangehörigkeit Schutzansprüche des Angehörigen gegen seinen Staat. Für die kollisionsrechtliche Anknüpfung hat diese staatsrechtliche Seite der Staatsangehörigkeit nur geringe Bedeutung.
ZB schützte bisher Art. 17 Abs. 1 S. 2 aF einen deutschen Ehegatten vor deutschen Familiengerichten[1] durch die Anwendung deutschen Scheidungsrechts vor der Unscheidbarkeit seiner Ehe; Art. 5 Abs. 1 S. 2 schützt den deutschen Mehrstaater davor, vor deutschen Gerichten kollisionsrechtlich als Ausländer behandelt zu werden.
191
b) Für das IPR steht im Mittelpunkt die Wirkung der Staatsangehörigkeit als Indikator der Zugehörigkeit der Person zu einer Rechtsordnung. Da das Parteiinteresse des Beteiligten in persönlichen Angelegenheiten auf die Anwendung der Rechtsordnung gerichtet ist, in die er sich integriert fühlt, geht es darum, die Verbundenheit eines Menschen mit einer Rechtsordnung zu typisieren. Die Staatsangehörigkeit ist hierzu zwar noch das im deutschen und kontinentaleuropäischen IPR vorwiegende Kriterium, sie ist in dieser Funktion jedoch weder rechtsvergleichend einzigartig noch rechtspolitisch zweifelsfrei.
192
c) Rechtsvergleichend ist feststellbar, dass nahezu alle Staaten des Common Law nicht in der Staatsangehörigkeit, sondern im domicile das maßgebliche Kriterium der Zugehörigkeit zu einer Rechtsordnung sehen. Das domicile (näher Rn 286) ist eine aus körperlicher Anwesenheit und Bleibewillen zusammengesetzte Rechtsfigur, die eine voluntativ-räumliche Beziehung zu einem Staat beschreibt, wenn auch eine erheblich stabilere als der gewöhnliche Aufenthalt oder gar der Wohnsitz. Es scheint daher falsch, das domicile solchen wechselhaften räumlichen Bindungen gleichzustellen; es steht vielmehr der Staatsangehörigkeit im Sinn bewusster Identifikation des Anknüpfungssubjekts mit einem Staat gleich.
193
Andere Staaten (insbesondere in Skandinavien) stellen auch in persönlichen Angelegenheiten teilweise auf das Recht des Vornahmeortes eines Rechtsgeschäfts ab und erlauben daher dem Einzelnen eine flexiblere Anpassung an ein – auch nur kurzfristig gewähltes – Umgebungsrecht, was auch Manipulationen ermöglicht.
194
Berühmtheit erlangten aus unterschiedlichen Gründen bestimmte Ehen, die in den 1960er und 70er Jahren in Schottland und in Dänemark (Tondern) geschlossen wurden. In beiden Rechtsordnungen werden die materiellen Ehevoraussetzungen nach dem Recht des Eheschließungsortes beurteilt, was zB 16-jährigen Deutschen (meist in Gretna Green, Schottland) ohne elterliche Einwilligung die Eheschließung ermöglichte. In Tondern (Dänemark) heirateten zahlreiche Italiener und Spanier, deren aus deutscher Sicht maßgebliches Heimatrecht (Art. 13 Abs. 1 aF) damals die Scheidung nicht anerkannte, geschiedene Partner; der dänische Standesbeamte beurteilte die Frage des Ehehindernisses der Bigamie nach dänischem Recht, das eine – zB in Deutschland ausgesprochene – Scheidung als wirksam anerkennt.
195
d) Die Staatsangehörigkeit als Anknüpfungskriterium ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf dem Rückzug.[2] Zwar hat sich das deutsche IPR auch 1986 nicht von der Staatsangehörigkeit als Grundsatzanknüpfung abgekehrt; der Einbruch anderer Anknüpfungskriterien, insbesondere des gewöhnlichen Aufenthalts, in die Bestimmung des Personalstatuts ist jedoch unübersehbar.
Dies hat verschiedene äußere Gründe:
196
aa) Seit das Haager Unterhaltsstatutübereinkommen 1956 und das Minderjährigenschutzabkommen für Eingriffe in das Sorgerecht und für den Kindesunterhalt vom Staatsangehörigkeits- zum Aufenthaltsprinzip gewechselt sind, ist der gewöhnliche Aufenthalt im Bereich der Haager Übereinkommen zunehmend zum primären Anknüpfungskriterium geworden. Zunächst konnte man die Entscheidung für die Anwendung des Aufenthaltsrechts noch als isolierte Reaktion auf die Schutzbedürftigkeit des betroffenen Kindes und damit auf die Eilbedürftigkeit der Entscheidung – ein höchst anerkennenswerter Grund – verstehen. Das Haager Unterhaltsstatutübereinkommen 1973 und ihm folgend, das Haager Unterhaltsprotokoll 2007, die auch für Unterhaltsansprüche Volljähriger gelten, machen aber deutlich, dass sich eine andere Sicht der Schwerpunktbestimmung durchgesetzt hat; das Staatsangehörigkeitsprinzip ist nur noch von nachrangiger Bedeutung (Art. 5 und – mittelbar – Art. 8 HUntStÜbk 1973), wird aber wohl zunehmend als wählbares Recht eine Rolle spielen (Art. 8 Abs. 1 lit. a HUntStProt 2007). Das Haager Kindesschutzübereinkommen verzichtet nun sogar auf eine Art. 3 MSA entsprechende Norm, da die Mitte des 20. Jahrhunderts noch veranlasste Rücksichtnahme auf das vielen Staaten selbstverständliche Staatsangehörigkeitsprinzip im Kindschaftsrecht heute nicht mehr nötig ist.
197
bb) Ein Einfluss gegen das Staatsangehörigkeitsprinzip ergibt sich aus der verfassungskonformen Gestaltung von Kollisionsnormen mit mehreren Anknüpfungssubjekten. Vor allem die eherechtlichen Verweisungsnormen, aber auch das internationale Kindschaftsrecht hängen von den Interessen verschiedener Beteiligter (Ehegatten, Mutter, Vater, Kind) ab; die vormalige Behandlung der Ehefrau als vom Ehemann kollisionsrechtlich abhängiges Nicht-Anknüpfungssubjekt, aber auch die traditionelle Sicht des Kindes als von den Eltern abhängige Person sind nicht mehr vereinbar mit dem Differenzierungsverbot (Art. 3 Abs. 2 GG), der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und einem modernen Familienverständnis (Art. 6 Abs. 1 GG). Wo aber mehrere Personen zum Anknüpfungssubjekt werden, entstehen Fälle, in denen die Staatsangehörigkeit als Anknüpfungskriterium versagt, weil die Beteiligten verschiedene Staatsangehörigkeiten haben können.
198
Deutlich wird der Einfluss der beiden unterschiedlichen Motive, wenn man Art. 14 Abs. 1 Nr 2 mit Art. 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 aF und Art. 19 Abs. 1 idF des KindRG vergleicht. Art. 14 Abs. 1 gibt das Staatsangehörigkeitsprinzip nicht auf und benutzt den gewöhnlichen Aufenthalt nur als hilfsweises Anknüpfungskriterium zur Lösung dieses Problems. Hingegen macht der Übergang in der Anknüpfung der Abstammung von Art. 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 aF (Ehewirkungsstatut der Mutter bzw Heimatrecht eines ehelichen Elternteils bzw Heimatrecht der nichtehelichen Mutter) zu Art. 19 Abs. 1 nF deutlich, dass hier zwei Motive eine Rolle spielen: einmal die Abkehr von der elternorientierten Anknüpfung, die das Kind – im Sinn der jüngeren subjektivierten Sicht des Kindes – zum Anknüpfungssubjekt macht; zum anderen aber auch eine Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip, die neben der Effizienz des Aufenthaltsprinzips für den schnellen Schutz des Kindes (der Richter braucht kein fremdes Recht zu ermitteln) auch die Vermeidung von Verwicklungen bei der Bestimmung der Staatsangehörigkeit (die oft von der gerade erst festzustellenden Abstammung abhängt) im Auge hat.
199
cc) Attraktiv wirkt das Aufenthaltsprinzip derzeit im Kontext kollisionsrechtlicher Regelungsbestrebungen der EU. Zwischen dem in zwei Dritteln der Mitgliedstaaten geltenden Staatsangehörigkeitsprinzip[3] und dem angelsächsischen domicile-Prinzip[4] erscheint das nur in einer Minderheit von Mitgliedstaaten geltende Wohnsitz- bzw Aufenthaltsprinzip attraktiv, weil es offenbar leichter fällt, allen bedeutenden Rechtsordnungen Europas „gleich weh zu tun“, als einen Kompromiss zu finden, der den tradierten Prinzipien nahekommt.[5] Zudem leistet die beklagenswerte Begeisterung europäischer Politik für vermeintlich integrierende Symbolhandlungen einen massiven Beitrag zur Beseitigung des Staatsangehörigkeitsprinzips, das mit Nationalismus gleichgesetzt wird. Manch „gutem Europäer“ ist anscheinend schon der Begriff der „Nation“ ein Graus und die Verdrängung des Staatsangehörigkeitsprinzips daher ein edles Ziel. Das von Charles de Gaulle stammende Wort vom „Europa der Vaterländer“ verliert sich leider zunehmend in einem diffus-zentralistischen Europa-Begriff. Jüngste Entwicklungen wie „Brexit“ und sich bildende Gräben zu den östlichen EU-Mitgliedern bestätigen, dass diese Entwicklung Europa mehr spalten als einen dürfte. Merkwürdig erscheint auch, dass mit dieser rechtspolitischen Grundeinstellung lois uniformes geschaffen werden, die zwar mit EU-Migranten argumentieren, in Deutschland jedoch überwiegend auf einige Millionen hier wohnende Nicht-EU-Bürger anzuwenden sind, deren Heimatländer überwiegend dem Staatsangehörigkeitsprinzip folgen.
200
Noch in ihrem Grünbuch über das anzuwendende Recht und die gerichtliche Zuständigkeit in Scheidungssachen[6] hatte die Kommission der EU durchaus erkannt, dass Aufenthaltsanknüpfungen gerade in einem Mobilität gewährleistenden Europa stark wandelbar und damit zufällig sind. Selbst das Scheitern des Vorschlags einer Verordnung,[7] die eine Regelung des Scheidungskollisionsrechts mit einer dringenden Mängelbeseitigung in der Brüssel IIa-VO verband, führte nicht zu der Einsicht, dass ein Nachgeben des Staatsangehörigkeitsprinzips nicht zum Konsens führt.[8] Vielmehr wurde das Aufenthaltsprinzip im Wege Verstärkter Zusammenarbeit als rein kollisionsrechtliches Instrument (Rom III-VO[9]) durchgesetzt. Bürger, die ihr Heimatrecht als Scheidungsstatut wünschen, müssen eine Rechtswahl treffen, was angesichts fehlenden Bewusstseins für das IPR und hoher Hemmschwellen („Schatz lass“ uns vor der Hochzeit noch unser Scheidungsstatut wählen“) nicht befriedigt.
201
dd) Als theoretische Basis dieser Tendenzen wird angesichts der kollisionsrechtlichen Wirklichkeit seit den 60er Jahren ein Interessenwandel behauptet, der Zweifel am Staatsangehörigkeitsprinzip nährt.
202
Historisch spielte im 19. Jahrhundert der Gedanke der Personalhoheit des Staates über seine Angehörigen eine entscheidende Rolle, die nicht die Interessen des Anknüpfungssubjekts, sondern die des Staates reflektiert. Für die Epoche der neu entstehenden Nationalstaaten in Europa lässt sich aber auch wenigstens im Grundsatz annehmen, dass die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit als Indikator der Bindung an einen Staat optimal die Interessenlage widerspiegelte.
203
ee) Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich aus höchst unterschiedlichen Gründen Bevölkerungsverschiebungen ergeben. Hierbei sind grundsätzlich drei Phänomene zu unterscheiden: Die Verschiebung von staatlichen Grenzen sowie die Dismembration von Staaten, Flüchtlingsbewegungen sowie Arbeitsmigration.
Nach dem ersten Weltkrieg kam es zu erheblichen Grenzverschiebungen, vor allem im ehemaligen Raum der österreichisch-ungarischen Monarchie, die den Wechsel der Staatsangehörigkeit großer Bevölkerungsgruppen zur Folge hatten; in diesem Zeitraum wurde häufig durch staatsangehörigkeitsrechtliche Optionslösungen die Identifizierung des Einzelnen mit „seinem Staat“ ermöglicht, was kollisionsrechtlich die Staatsangehörigkeit weiter als taugliches Kriterium erhielt. Auch die beiden großen Dismembrationen des endenden 20. Jahrhunderts, die Auflösung der UdSSR und der SFRJ nähren keine Zweifel am Staatsangehörigkeitsprinzip; diese Dismembrationen haben Nationalstaaten (wieder-) entstehen lassen, in denen die Staatsangehörigkeit stärker als vorher identifizierender Faktor ist.
204
ff) Im Zuge des zweiten Weltkriegs kam es zu gewaltigen Vertreibungs- und Flüchtlingsströmen; Vertriebene und Flüchtlinge verloren oder behielten oft eher zufällig ihre bisherige Staatsangehörigkeit, wurden aus Staatsangehörigkeiten entlassen oder umgekehrt an ihnen festgehalten, hatten im Zeitpunkt der Flucht bereits eine andere Staatsangehörigkeit erworben, erwarben sie am Zielort ihrer Flucht oder blieben staatenlos. Diese Vorgänge setzten sich durch die aus dem damaligen Ostblock nach Westeuropa fließenden Flüchtlingsbewegungen der Nachkriegsjahrzehnte fort. Hier entwickelte sich vor allem das Phänomen der zweifelsfreien Loslösung eines Menschen von seinem bisherigen Heimatstaat: Um den vielfältigen Varianten von Staatsangehörigkeitssituationen gerecht zu werden, aber auch zur Vermeidung zeitaufwendiger Ermittlungen von staatsangehörigkeitsrechtlichen Schicksalsläufen haben Normen wie Art. 12 Genfer Flüchtlingskonvention, § 3 AsylG oder auch das Gesetz über den Güterstand von Vertriebenen und Flüchtlingen korrigierend in das Staatsangehörigkeitsprinzip eingegriffen.
Dabei sind die Regelungen im Einzelnen unterschiedlich. Die Bestimmungen zum Personalstatut von Flüchtlingen knüpfen angesichts der staatsangehörigkeitsrechtlichen Desintegration anstelle der Staatsangehörigkeit an den Wohnsitz, später den gewöhnlichen Aufenthalt an; die Regelung zum Güterstand geht hingegen von einer neuen Integration in das deutsche Recht aus und kann diese kollisionsrechtlich durch einen Wandel des Ehegüterstatuts nachvollziehen.
Eine andere Typizität weisen jene Fluchtbewegungen auf, die in zahllosen „lokalen Konflikten“ in Südosteuropa, vor allem im Zusammenhang mit Kriegen und Bürgerkriegen im Umfeld des Zerfalls des früheren Jugoslawien entstanden und denen in jüngster Zeit ähnliche Fluchtbewegungen innerhalb sowie aus dem Nahen Osten folgten. Während das von Flucht und Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg geprägte Modell des Art. 12 GFK eine dauerhafte Lösung vom Herkunftsstaat, in dem sich ein dem Flüchtling feindliches System etabliert hatte, voraussetzte, sind die jüngeren Fluchtbewegungen, insbesondere, soweit sie in Nachbarländern (zB Lager in Türkei und Jordanien) enden, eher vom Gedanken der Rückkehr in das eigene Land nach Beendigung von Krieg und Bürgerkrieg geprägt. Diese Tendenz macht es höchst fraglich, ob Art. 12 GFK für einen Flüchtling, dessen Staatsangehörigkeit im Regelfall nicht zweifelhaft ist und der sich in einem Nachbarland in Wartestellung befindet, wirklich eine interessengerechte Anknüpfung schafft.[10]
205
gg) Die am meisten strittigen kollisionsrechtlichen Interessenfragen werfen jedoch die Arbeitsmigranten- und Gastarbeiterbewegungen[11] seit der Mitte des 20. Jahrhunderts auf, die von anderen kollisionsrechtlichen Interessen geprägt sind als Flüchtlingsbewegungen. Auch die häufig irrig als Flucht bezeichnete interkontinentale wirtschaftlich indizierte Migration gehört in diese Kategorie. Wer hierzu, an das Modell der Einwanderungsstaaten, insbesondere USA, Kanada und Australien anknüpfend, eine Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip hin zum Aufenthaltsprinzip fordert, erschöpft das Problem nicht. Der Umstand, dass sich Ausländer, die zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland gekommen sind, hier niederlassen, dass also Zuwanderung stattfindet, macht Deutschland nicht zu einem Einwanderungsland nach dem Muster der genannten Staaten. Einwanderungsländer sind nicht Länder, in die mehr oder minder geplant Angehörige anderer Staaten zuwandern, sondern Länder, deren Bevölkerungsaufbau konstitutiv auf Einwanderung gründet.
206
Der vermehrte, teils nicht kontrollierte, in sich wandelnden[12] Sektoren des Arbeitsmarktes volkswirtschaftlich erwünschte Zuzug von Ausländern hat zwar faktisch zu einer Vermehrung kollisionsrechtlicher Gestaltungen durch Zuwanderung geführt. Irrig wäre es jedoch, aus dem Schlagwort, Deutschland sei „Einwanderungsland“ im Kollisionsrecht verstärkt auf die Anwendung des deutschen Aufenthaltsrechts abzustellen. Die erwähnten klassischen Einwanderungsländer benötigten in ihrer Gründerphase Einwanderung zur Erschließung gewaltiger Siedlungsräume; die Einwanderung des Einzelnen war fast ausnahmslos der Beginn eines kontinuierlichen Prozesses der – auch staatsangehörigkeitsrechtlichen – naturalization, weshalb eine schnelle Unterstellung des – kollisionsrechtlichen – Personalstatuts unter das neue Aufenthaltsrecht nahe lag: Einwanderung in USA, Kanada oder Australien wurde als konstitutiv für den Aufbau eines neuen Staates verstanden, in dem der Einwanderer unter endgültiger Lösung von seiner – meist europäischen – Herkunft zum originären Teil eines sich neu gründenden Staatsvolkes wurde. Überdies haben Einwanderungsländer die Tendenz, nach einer gewissen Verfestigung der staatlichen Identität, weitere Zuwanderung zu begrenzen; hierauf beruhen der in den USA geführte Streit um illegale Zuwanderung, die höchst selektive Zuwanderungspolitik Kanadas und die geradezu abschottende Haltung Australiens.
Zuwanderung in Deutschland ist vielschichtig. Staatlicherseits wird nicht unbegrenzte, sondern selektive, volkswirtschaftlich benötigte Zuwanderung gesucht, wo das Angebot an qualifizierten deutschen Arbeitskräften den Bedarf nicht deckt und auch eine verbesserte Ausbildungspolitik nicht hilft. Die kollisionsrechtlichen Interessen eines für 10 Jahre in Deutschland arbeitenden IT-Spezialisten sind andere als die eines dauerhaft nach Deutschland kommenden osteuropäischen Krankenpflegers.
Auch will nicht jeder Zuwanderer Deutscher werden. Exemplarisch werden die sich daraus ergebenden kollisionsrechtlichen Fragen an den in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen erkennbar, die, mit Ausnahme des bilateral völkervertraglich geregelten Erbstatuts vom türkischen IPR nach dem Staatsangehörigkeitsprinzip, vom europäischen IPR hingegen weitgehend nach Aufenthaltsrecht behandelt werden.
Hinzu kommt Arbeitsmigration mit Rückkehrabsicht als ein Modell, das zu Unrecht in jüngster Zeit einen höchst schlechten Ruf genießt: Rückkehrer haben insbesondere den südlichen EU-Staaten in den 1960er und 1970er Jahren wirtschaftlich sehr geholfen und sich selbst durch mehrjährige Arbeit in Deutschland bemerkenswerte Existenzen in der Heimat geschaffen, von der man sich aus guten Gründen nicht lossagte.
207
hh) Die Frage, wohin das Integrationsinteresse eines in Deutschland lebenden Ausländers weist, kann also nicht ohne weiteres unter Bezugnahme auf wachsende Ausländerzahlen in Deutschland gegen das Staatsangehörigkeitsprinzip beantwortet werden. Vielmehr gebietet die Unterschiedlichkeit der Flucht- und Migrationstypen eine sehr differenzierte kollisionsrechtliche Sicht. Selbst für jene Gruppen von Zuwanderern, die nach ihrer Lebensplanung ein Integrationsinteresse haben, stellt sich die Frage, wie diese kollisionsrechtlich gefördert werden kann. Dies konzentriert sich sodann auf die Streitfrage, ob Aufenthaltsanknüpfung den hier lebenden Ausländer integriert oder ob Integrationswille sich nicht nach einer Zeit durch den Erwerb der deutschen und die Abkehr von der früheren Staatsangehörigkeit erweisen sollte.
208
ii) Solange ein Ausländer in sein Heimatland zurückkehren will oder nach deutschem Recht soll, ist das Staatsangehörigkeitsprinzip interessengerecht; es erlaubt in den Grenzen des deutschen ordre public Identitätswahrung in persönlichen Rechtsangelegenheiten, es wahrt die Kontinuität der Beurteilung dieser Rechtsangelegenheiten und fördert ihre international einheitliche Beurteilung unabhängig von kurz- oder längerfristigen Aufenthalten in anderen Staaten. Auch die Interessen des Rechtsverkehrs sprechen für das Staatsangehörigkeitsprinzip, weil es wegen der hohen Anforderungen an den Erwerb einer Staatsangehörigkeit weitgehend manipulationsfest und dennoch wegen der formalisierten Dokumentation (Ausweise, Pässe) leicht feststellbar ist. Wo der Verkehrsschutz berührt ist – und dies ist bei Angelegenheiten des Personen-, Familien- und Erbrechts nur bei Berührung von Vermögensinteressen der Fall – kann durch gezielte Schutzbestimmungen (zB Art. 16) diesen Interessen genügt werden.
Aus Sicht von Inner-EU-Migranten, die in einem die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewährleistenden Europa vermehrt für einige Jahre in anderen Mitgliedstaaten arbeiten, bietet das Staatsangehörigkeitsprinzip Vorhersehbarkeit hinsichtlich der Behandlung nach der Rechtsordnung, in der die Betroffenen sozialisiert sind. So dürfte es wohl die deutsche Ehefrau eines Deutschen, der für Airbus in Finkenwerder tätig war und für fünf Jahre nach Toulouse wechselt, einigermaßen erstaunen, dass im Fall der Scheidung nach der ab dem 21.6.2012 geltenden Aufenthaltsanknüpfung (Art. 8 lit. a Rom III-VO) französisches Recht Scheidungsstatut ist, was sich auch auf den Versorgungsausgleich (dazu Rn 871 ff) eingeschränkt auch auf den nachehelichen Unterhalt (dazu Rn 945) auswirken kann. Rechtswahl (Art. 5 Rom III-VO) bietet gegen solche Überraschungen kaum Schutz, weil vorsorgend kaum der Regelungsbedarf erkannt wird und im Zeitpunkt der Ehekrise jeder Ehegatte sich beraten lassen wird, welche Rechtsordnung ihm Vorteile bringt. Der um zahlreiche Fallgruppen (Mallorca-Renter, Arbeitsmigranten, Auslandsstudenten, fremdbestimmte Pflegeheim-Migration) geführte Streit, wie gewöhnlicher Aufenthalt im Erbstatut nach Art. 21 EU-ErbVO zu verstehen ist (dazu Rn 1082 ff) beweist augenfällig, dass Freizügigkeit innerhalb der EU ein geradezu diametral konträres Konzept zur klassischen Auswanderung ist. Wer 10 Jahre in Frankreich arbeitet oder 7 Monate in Spanien überwintert hat, mit dem endgültigen Abschied, den das berühmte Auswanderer-Denkmal in Bremerhaven symbolisiert, keine Spur gemein.
209
jj) Lässt sich der Ausländer (zulässig) auf Dauer nieder, so wird häufig angenommen, sein kollisionsrechtliches Interesse gehe dahin, in persönlichen Rechtsfragen nach dem Recht seines gewöhnlichen Aufenthalts beurteilt zu werden. Das erscheint jedoch zweifelhaft, solange er die ihm gebotene Möglichkeit einer Einbürgerung unter Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit nicht ergreift. Gerade der bewussten Beibehaltung der alten Staatsangehörigkeit bei einem in Deutschland nach eigener Einschätzung auf Dauer niedergelassenen Ausländer kommt für die Beurteilung seiner Integration große Bedeutung zu. Bewahrt er diesen desintegrierenden Faktor – was aus deutscher Sicht zu respektieren ist – so kann andererseits aus kollisionsrechtlicher Sicht eine starke Bindung an dieses Heimatrecht unterstellt werden. Die rechtspolitisch verbreitete Gegenansicht übersieht, dass eine solche kollisionsrechtliche Integration gegenüber einem nicht integrationsbereiten legal in Deutschland lebenden Ausländer ein interessenwidriger Oktroy wäre.
210
Ist zB ein türkischer Staatsangehöriger 1970 nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten, hat 1975 in der Türkei geheiratet und sich 1978 entschlossen, auch seine Frau nach Deutschland zu holen, um hier auf Dauer zu bleiben, so brächte das Aufenthaltsprinzip nicht nur integrierende Vorteile: Die Staatsangehörigkeitsanknüpfung stellt (wegen Art. 4 Abs. 1) sicher, dass die materielle Wirksamkeit der Ehe aus Sicht des deutschen Rechts und des Heimatrechts in gleicher Weise beurteilt wird. Dies gilt auch für ehewirkungsrechtliche Fragen (Art. 14 Abs. 1). Eine „kollisionsrechtliche Integration“ in Deutschland bei Fortbestehen der türkischen Staatsangehörigkeit kann dazu führen, dass eherechtliche Fragen in Deutschland und der Türkei unterschiedlich beantwortet werden bis hin zur Gefahr hinkender Scheidungen in Anwendung deutschen Rechts unter Art. 8 Rom III-VO. Integration im Ehegüterrecht ist ohnehin über Art. 15 Abs. 2 Nr 2 durch Rechtswahl erreichbar, was vorzugswürdig ist, da den wählenden Ehegatten durch Beratung bewusst gemacht werden kann, dass sie mit ihrer Integration in das Aufenthaltsrecht auch das Risiko der Disharmonie zum Heimatstaat eingehen. Vermieden wird in dieser zahlenmäßig großen Gruppe eine hinkende Beurteilung nur im Erbstatut, wo das deutsch-türkische Nachlassabkommen[13] eine einheitliche Beurteilung (Mobilien: Staatsangehörigkeit, Immobilien: Belegenheitsrecht) sichert, sofern der Erblasser nicht deutsch-türkischer Doppelstaater ist.
211
Haben die Ehegatten Kinder, die in Deutschland leben, ggf sogar hier geboren sind, so erscheint auch insoweit der zum 1.7.1998 erfolgte Übergang zum Aufenthaltsprinzip nicht problemfrei. Die im internationalen Kindschaftsrecht gewählte Aufenthaltsanknüpfung erleichtert zwar intern die Abstammungsfeststellung und ist im Fall notwendiger eilbedürftiger Schutzmaßnahmen sogar geboten; sie kann aber zu hinkenden Kindschaftsverhältnissen führen, da die Türkei – wie viele andere Heimatstaaten von hier lebenden Ausländern – auch im Kindschaftsrecht dem Staatsangehörigkeitsgrundsatz folgt. Personen- und familienrechtlich ist auch für hier geborene Ausländer keine weitere kollisionsrechtliche Integration geboten: Solange diese minderjährig sind, hängt ihr Bleibewille stark von dem der Eltern ab; nach Erreichen der Volljährigkeit liegen regelmäßig längst die Voraussetzungen einer Antragseinbürgerung unter Verzicht auf die alte Staatsangehörigkeit vor.
212
kk) Eine benachbarte, mittelbar auf das IPR einwirkende Frage ist, ob man Integration in den Aufenthaltsstaat auf staatsangehörigkeitsrechtlicher Ebene erreichen kann, wie dies durch das Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts v. 15.7.1999[14] mit einer Erleichterung der Einbürgerung, Hinnahme von Doppelstaatigkeit (§ 12 StAG) und der doppelten Staatsangehörigkeit bei Kindern (§ 4 Abs. 3 StAG; mit – jüngst deutlich gelockerter[15] – Erklärungspflicht nach Volljährigkeit § 29 StAG) versucht wurde. Die Tendenz, Einbürgerung zu erleichtern, ist aus kollisionsrechtlichem Blickwinkel an sich zustimmungswürdig. Je stärker die Einbürgerung willensabhängig ist, umso mehr kann sie selbst bei hoher Mobilität ein Maßstab für die Integrationsbereitschaft und die kollisionsrechtlichen Interessen sein. Andererseits ist kollisionsrechtlich eine doppelte Staatsangehörigkeit (Mehrstaatigkeit) unerwünscht; sie provoziert Konflikte in der rechtlichen Beurteilung durch beide Heimatstaaten und damit „hinkende“ Rechtsverhältnisse (zur daraus folgenden Kritik an § 29 StAG Rn 261).
213
Ein in Deutschland geborenes Kind türkischer Eltern, das unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 StAG in Deutschland geboren wird, erwirbt ohne Verlust der türkischen die deutsche Staatsangehörigkeit und ist Doppelstaater; besteht die Optionspflicht nach § 29 StAG, so endet die Doppelstaatigkeit spätestens zwei Jahre nach Zustellung des Hinweise gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 Nr 4 StAG vorbehaltlich einer Genehmigung (§ 29 Abs. 3 S. 2 StAG). Ist das Kind iSd § 29 Abs. 1a StAG im Inland aufgewachsen, so bleibt es lebzeitig Doppelstaater, wenn nicht aktiv eine der Staatsangehörigkeiten abgelegt wird. Aus deutscher kollisionsrechtlicher Sicht ist das Kind Deutscher, aus türkischer Sicht Türke und aus Drittstaatensicht kommt es auf die jeweilige Regel für die Behandlung von Mehrstaatigkeit im IPR an.
214
Zudem wirkt doppelte Staatsangehörigkeit eher desintegrierend; sie deutet auch kollisionsrechtlich nicht auf einen eindeutigen Interessenschwerpunkt zum Inland hin, denn bewusste Doppelstaatigkeit ist Ausdruck des Offenhaltens der Integration in einem Heimatstaat. Wer sich in Deutschland integrieren will, kann nicht auf Dauer anstreben, zugleich in einem früheren Heimatstaat integriert zu bleiben.
215
Zusammenfassend bedeutet also das Staatsangehörigkeitsprinzip auch in Migrationsfällen eine geeignete Typisierung der kollisionsrechtlichen Interessen.
216
e) Die Bestimmung der Staatsangehörigkeit eines Anknüpfungssubjekts erfolgt im IPR immer aus der Sicht des Staates, um dessen Staatsangehörigkeit es geht. Staatsangehörigkeitsrecht ist hoheitlicher Natur; kein Staat kann darüber entscheiden, ob eine Person Angehöriger eines anderen Staates ist.[16] In der Praxis sind also die Staatsangehörigkeitsrechte der Staaten zu prüfen, deren Staatsangehörigkeit das Anknüpfungssubjekt besitzen könnte; dies ist meist ein problemloser Prüfungsschritt, kann aber in Einzelfällen einen interessanten Einblick in die unterschiedlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Prinzipien verschiedener Staaten oder in die historische Entwicklung der europäischen Nationalstaaten geben.
217
So kann ein Erblasser, der 1908 in Slowenien geboren wurde und 1998 in Slowenien verstirbt, während seines Lebens die österreichische, die ungarische, die jugoslawische und die slowenische Staatsangehörigkeit besessen haben und ggf bei freiwilligem Eintritt in die Deutsche Wehrmacht auch Deutscher geworden und unter Umständen sogar geblieben sein.[17] Tritt, was angesichts der bis zur Wende in Osteuropa vorherrschenden Geringschätzung von Vermögen nicht selten ist, in dem Erbscheinsverfahren erstmals zutage, dass der Erblasser selbst Erbe eines 1944 in Rumänien verstorbenen Onkels ist, dessen Staatsangehörigkeit wegen der Wirren der letzten Kriegstage höchst fraglich sein kann, so wird die Nachlassakte schnell zum Geschichtsbuch.
Literatur:
Basedow Das Staatsangehörigkeitsprinzip in der Europäischen Union, IPRax 2011, 109; Benicke Auswirkungen des neuen Staatsangehörigkeitsrechts auf das deutsche IPR, IPRax 2000, 171; Staudinger/Bausback (2013) Anh. I zu Art. 5 EGBGB; eindrucksvoll zu historischen, oft kriegsbedingten Veränderungen im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht Staudinger/Bausback (2013) Anh. II zu Art. 5 EGBGB; zu staatsangehörigkeitsrechtlichen Regelungen zahlreicher Staaten: Staudinger/Bausback (2013) Anh. III zu Art. 5 EGBGB.