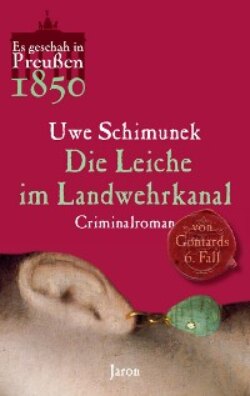Читать книгу Die Leiche im Landwehrkanal - Uwe Schimunek - Страница 6
Zwei
ОглавлениеFreitag, 23. August 1850
Christian Philipp von Gontard schritt durch das Treppenhaus zum Bureau seines Lehrstuhls. Seine Schritte hallten durch das Gemäuer. Er war zeitig in die Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule gegangen, denn noch herrschten draußen Unter den Linden erträgliche Temperaturen. Nicht nur er schien auf diesen Gedanken gekommen zu sein, denn als er am Treppenabsatz kurz stehenblieb, klackten weiterhin Stiefel über die Stufen. Die Geräusche kamen von oben.
Gontard überlegte, ob er umkehren sollte. So früh am Tage fehlte ihm die Lust zur Konversation, und im Labor warteten die Proben vom Landwehrkanal. Aber vielleicht ging der Mann über ihm auch ganz woandershin, zu einem anderen Lehrstuhl oder ins Rektorat. Sicher reichte es, ein wenig zu trödeln, um dem anderen aus dem Weg zu gehen. Gontard schlenderte gemächlich in die nächste Etage. Dort lehnte er sich an das Geländer und hörte die Schritte verhallen.
Jetzt herrschte Stille in der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Gontard eilte, nun da die Gefahr von Zwiegesprächen am Morgen gebannt schien, zu seinem Lehrstuhl. Im zweiten Geschoss bog er in den Gang und traute seinen Augen nicht: Ausgerechnet vor seinem Bureau stand eine Gestalt in derart militärischer Haltung, dass Gontard sie kurz für eine Statue hielt. Nur, wo sollte die herkommen? Nein, es musste sich um den Mann handeln, dessen Schritte er gerade gehört hatte. Das Gesicht konnte er im Zwielicht des Ganges nicht erkennen, genauso wenig den Dienstgrad des Mannes.
Gontard dachte erneut daran umzukehren. Doch wie würde das aussehen? Es gab kein Zurück. Aber immerhin war es sein Lehrstuhl, sein Reich. Er würde mit dem Mann zwei, drei Sätze wechseln und ihn dann abwimmeln. Gontard merkte, wie seine Schritte zackig wurden.
»Guten Morgen, Herr Oberst-Lieutenant!« Die Gestalt trat in die Mitte des Ganges.
Gontard erkannte Lieutenant von Heye. Der junge Offizier belegte seine Ballistik-Vorlesung. Er gehörte zu den Studenten, denen Gontard eine große Karriere in der preußischen Armee vorhersagte. Er verfügte über beste Beziehungen, war eine attraktive Erscheinung und zeigte gute Leistungen. Leider ließ er das seine Kommilitonen und Lehrkräfte regelmäßig wissen.
»Guten Morgen, Lieutenant! Was wünschen Sie zu dieser Morgenstunde?«
»Ich möchte mich freiwillig melden. Ich hörte, Sie suchen Studenten, die den Unfall am Landwehrkanal untersuchen.«
Gontard fixierte seinen Studenten. Der wirkte bei allem Hochmut arglos. Gontard hatte gestern in einem Seminar wirklich von dem Erdrutsch berichtet. Es war nicht ausgeschlossen, dass einer der Studenten das am Abend in der Kneipe weitererzählt hatte. Verwerflich wäre das nicht, Gontard suchte schließlich Freiwillige. Dennoch, etwas machte ihn skeptisch. Er fragte deshalb: »Und das fällt Ihnen mitten in der Nacht ein? Hätte das nicht Zeit bis zum Seminar gehabt?«
»Ich dachte, Sie könnten mich vielleicht über die Aufgaben ins Bild setzten. Und gleich nach den Vorlesungen mache ich mich dann ans Werk.«
Gontards Misstrauen verstärkte sich. Dieser Enthusiasmus war völlig untypisch für einen Studiosus an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Hier lernten die Offiziere Seiner Majestät, und die pflegten nach Erledigung der nötigsten Arbeit zu Bierstuben zu eilen oder nach Schürzen zu jagen. Gontard schwieg.
Heye zögerte ebenfalls einen Augenblick, bevor er hinzufügte: »Ich habe gehört, mit dem Unglück ist auch ein Criminalfall verbunden …«
Daher wehte also der Wind, dachte Gontard. Von der Leiche hatte er am Vortag im Seminar allerdings nichts erwähnt.
»Ich habe den Verstorbenen ein paarmal im Haushalt der Familie von Traunstein gesehen und daher ein gewisses Interesse an der Sache.«
»Sie kannten diesen Puch?«
»Nun ja, kennen ist zuviel gesagt. Mein Vater und Herrmann von Traunstein sind befreundet.« Heye verlor für einen Moment seine Überheblichkeit, so wie ein Ritter, der sein Schild senkt. »Deswegen war auch ich oft ein Gast der Familie.«
»Und was hatten Sie für einen Eindruck von Puch?« Heye guckte, als habe Gontard ihn bei einer Peinlichkeit erwischt, und antwortete: »Ich habe ihn kaum wahrgenommen, es handelte sich bei Puch schließlich nur um einen Secretär.«
»Immerhin ist er Ihnen in Erinnerung geblieben.«
»Ich … ich … interessiere mich nun mal für Menschen …« Gontard sah den Lieutenant scharf an. Da gewährte der junge Offizier einen Blick hinter seine großtuerische Fassade, und schon wurde das große Nichts offenbar. Nur nicht lachen, dachte Gontard. Er wollte den Jungen weiter in die Enge treiben. Vielleicht verriet der doch mehr über Puch.
»Mein Vater hat gemeint, ich solle mich mit solchen Leuten nicht weiter abgeben.«
»Weshalb?«
»Weshalb? Es war ein Hinweis meines Vaters. Und um ehrlich zu sein, galt mein Interesse im Haus von Traunstein nicht den Bediensteten.« Lieutenant von Heye verschanzte sich wieder hinter seinem Panzer aus Hochmut.
»Und wäre der Mann nicht tot, würden Sie auch kein Abenteuer in der Untersuchung des Erdrutsches vermuten.« Gontard zuckte mit den Schultern. »Ich fürchte, besonders spannend wird die Arbeit im Labor nicht werden. Wir müssen den Untergrund analysieren und selbstverständlich auch die verwendeten Baustoffe. Da sind akribische Helfer gefragt und keine Draufgänger.« Im Grunde konnten ihm die Beweggründe Heyes egal sein – und ein unsympathischer Freiwilliger war besser als keiner.
Heye lächelte und sagte: »Wollen Sie nun, dass ich bei den Studien mitarbeite? Dann könnten Sie mir im Labor gleich ein paar Proben aushändigen.«
Das Dienstmädchen öffnete die Tür und bat Gontard hinein. Die Maid zählte vielleicht achtzehn Jahre und hatte ein hübsches Gesicht, eine Frisur nach der neusten Mode sowie einen unglaublich breiten Hintern. Damit passte sie genau in das Foyer der Traunstein’schen Villa. Der Raum sah aus, als wüsste er selbst nicht, in welche Zeit er gehörte. Die spätbarocke Garderobe wirkte so schwer, dass Gontard fürchtete, sie würde durch das zusätzliche Gewicht seiner Pickelhaube durch die Dielen brechen. Gleich daneben hing ein Familienbild nach Biedermeier-Art – Spitzweg hätte es nicht kitschiger hinbekommen.
»Wen wünscht der Herr zu sprechen?«, fragte das Dienstmädchen.
Gontard überreichte ihr seine Karte und sagte: »Ich müsste Herrn von Traunstein in einer sehr dringenden Angelegenheit sprechen. Es wäre mir außerordentlich wichtig, dass er für einen unangemeldeten Gast ein paar Minuten Zeit erübrigen kann.«
Das Mädchen verschwand durch die Flügeltür, und Gontard stand allein im Foyer. Er schaute auf die Uhr. Es war kurz nach zwei. Die Vorlesungen hatte er hinter sich gebracht, und Heye untersuchte die Proben im Labor. Selbst wenn er Herrmann von Traunstein für ein längeres Gespräch gewinnen konnte, blieb genug Zeit, um noch einmal zu Lenné an den Landwehrkanal zu reiten.
»Ein Offizier der Königlichen Armee in meinem bescheidenen Haus! Ich bin Herrmann von Traunstein. Was verschafft mir die Ehre?« In der Flügeltür stand ein Mann in einem dunklen Anzug und mit einem buschigen Backenbart. Dafür hatte sich das Haar von Stirn und Haupt zurückgezogen, graue Locken umringten die Halbglatze wie ein Heiligenschein.
»Es ist eine Angelegenheit, die Sie nur mittelbar betrifft. Dennoch ist sie von einiger Bedeutung, weil es sich vermutlich um ein Kapitalverbrechen handelt.«
»Oh«, Traunstein wies mit der Hand in das Zimmer hinter der Flügeltür, »da bin ich selbstverständlich gern behilflich. Kommen Sie doch herein!«
Gontard betrat einen Salon mit ockerfarbenen Wänden und mehreren Regalen, in denen Bücher mit Prägedruck im Ledereinband aufgereiht standen wie eine Kompagnie zum Appell. Traunstein folgte ihm und hieß ihn in »der Bibliothek« willkommen. Auf einer Chaiselongue saß eine junge Frau, vielleicht die Tochter des alten Traunstein. Gontard hatte das Gefühl, die Dame schon einmal gesehen zu haben.
»Darf ich vorstellen, meine liebe Frau, Martha von Traunstein. Mein Sonnenschein und der Glanz dieses Hauses.«
Die Frau errötete, und Gontard fand, dass sie gerade dadurch die Worte des Alten bestätigte. Er verbeugte sich.
Martha von Traunstein erhob sich, machte einen Knicks, blickte ihn an, als wolle sie ihn von oben bis unten vermessen, und sagte: »Ein Offizier zu Gast. Das ist mir eine Freude. Darf ich Ihnen etwas bringen lassen? Einen Cognac?«
Gontard nickte, noch während er über die Antwort nachdachte. Die Herrin des Hauses rief das Mädchen.
Herrmann von Traunstein wies Gontard einen Platz an einem Tisch zu und sagte: »Was führt Sie zu mir, Herr Oberst-Lieutenant?«
Gontard setzte sich und antwortete: »Es geht um Ihren Secretär.«
»Ach herrjeh! Was hat der Puch denn schon wieder angestellt?«
»Schon wieder? Hat es öfter Ärger gegeben wegen ihm?«
»Nun ja …« Traunstein zögerte. »Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll … Er ist kein einfacher Charakter.«
»Hat er seine Arbeit vernachlässigt?«
»Ach was, Herr Oberst-Lieutenant! Er ist ein sehr fleißiger Mann und sehr zuverlässig. Erst am Montag hat er für mich Anweisungen an den Verwalter eines meiner Güter notiert. Seine Formulierungen sind nicht immer die geradlinigsten, aber stets korrekt. Er hat nur …«, Traunstein suchte anscheinend erneut nach den richtigen Worten, »… diese Flausen in seinem Kopf. Das ist manchmal nicht einfach.«
Martha von Traunstein brachte ein Tablett mit zwei Cognac-Schwenkern und einer Flasche zum Nachschenken. Sie hatte sich ein seidenes Tuch über die Schultern geworfen und verabschiedete sich mit herzlichen Worten zu einem Spaziergang.
»Den haben wir von unserer letzten Reise nach Paris mitgebracht. Ein vorzüglicher Tropfen«, sagte Traunstein und nippte am Glas.
Auch Gontard trank. Der Schnaps schmeckte so weich, dass die Kehle beim Schlucken kaum zu spüren war. Er kehrte zum Thema zurück. »Herr Puch ist kein junger Mann mehr, nicht wahr?«
»Nein.« Traunstein lachte. »Er ist, wie man so schön sagt, im besten Alter. Nur verhält er sich nicht so. Er ist noch immer Junggeselle und wohnt in einem Zimmer zur Untermiete. Eine feste Anstellung hat er auch nicht. Ich glaube, er hält sich für einen Schriftsteller, einen Dichter gar.«
»Ist er denn einer?«
»Da fragen Sie den Falschen. Ich lese zumeist die Abrechnungsbücher unserer Landgüter oder Amtspapiere, wenn ich um einen Rat gefragt werde. Mit der schöngeistigen Literatur bin ich weniger vertraut.«
Gontard wiegte den Cognac-Schwenker und sah Traunstein fest an. »Hatte Herr Puch Feinde?«
»Feinde? Das ist ein starkes Wort. Er macht sich nicht nur Freunde. Auch nicht mit seinen liberalen Reden, die er selbst in aller Öffentlichkeit hält.« Traunstein hielt Gontards Blick stand, während er seinen Kopf wiegte.
»Aber er hat Manieren. Ich jedenfalls habe bislang keinen Grund gesehen, auf seine Dienste zu verzichten. Was ist denn nun mit ihm?«
»Er ist tot. Wir haben seine Leiche im Landwehrkanal gefunden. Vermutlich wurde er erschossen.«
Traunstein saß für einen Augenblick starr wie eine Skulptur. Dann trank er einen großen Schluck Cognac.
Gontard spazierte zwischen den Villen stadteinwärts. Es blieb genug Zeit für ein paar Minuten Erholung, bevor er zum Landwehrkanal ritt – Zeit, noch einmal über das Gespräch mit Traunstein nachzudenken. Der Alte hatte nicht mehr viel gesagt, ihn aber höflich eingeladen, jederzeit weitere Fragen zu stellen. Darauf würde Gontard zurückkommen, da war er sich sicher. Doch zunächst musste er sich darüber klar werden, wonach er suchen sollte. Kam der Mörder aus Puchs Bekanntenkreis? Mit wem hatte der verkannte Dichter zu Lebzeiten Umgang gehabt? Oder war alles ganz anders? Lag Kußmaul richtig, und hinter alldem steckte die Politik?
Er musste mehr über Puch erfahren, so viel stand fest. Noch nicht einmal von Puchs Äußerem hatte Gontard ein eindeutiges Bild, dafür war die Wasserleiche viel zu entstellt gewesen. Ob es ein Bildnis von Puch gab? Und wenn ja, wo?
Puch wohnte zur Untermiete, das hatte Traunstein erwähnt. Also bekam Gontard die Adresse nicht einfach über Adressregister heraus. Lenné kannte das Opfer auch, Gontard konnte ihn in Bälde befragen. Bei dem Gedanken verspürte er kurz den Drang, seine Schritte zu beschleunigen. Aber nein, es blieben nur noch ein paar hundert Meter, dann ließ er die Thiergarten-Siedlung hinter sich und kam in die Stadt, ins Gewimmel. Die letzten Schritte lang wollte er noch die Ruhe der Vorstadt genießen. Kein Mensch war hier auf der Straße.
Zumindest fast keiner, denn Gontard hörte, wie sich Schritte von hinten näherten. Es waren Tippelschrittchen. Er drehte sich herum und sah Martha von Traunstein herbeieilen.
»Gut, dass ich Sie noch antreffe, Herr Offizier!«, rief sie ihm zu.
Gontard blieb stehen und schaute die Dame an. Im Sonnenlicht wirkte sie hell und zart wie ein Engel. Ihm kam es beinahe vor, als könne er durch sie hindurchschauen. Vermutlich kam der Eindruck daher, dass ein heller Hut ihre brünetten Locken verbarg. Erneut war da dieses Gefühl, dass er die Frau schon einmal gesehen hatte.
»Ich habe beim Herausgehen gehört, dass Cornelius der Grund für Ihren Besuch war.«
»Cornelius?«
»Puch, Herrmanns Secretär. Was ist mit ihm?«
Gontard sah, wie Martha von Traunstein sich mit der bloßen Hand Luft zufächelte. War sie nervös, oder setzte ihr nur die Hitze zu? Er sagte: »Er ist tot.«
»O mein Gott! Wie ist das passiert?«
»Vermutlich wurde er erschossen.«
»Nicht möglich!«
»Warum nicht?«
»Nun, Cornelius war …« Die Dame seufzte. Sie zog ihr Tuch vor dem Busen zu, als fröstelte sie, und fragte: »Kann ich Ihnen vertrauen, Herr Offizier?«
Ihre Handbewegung und die Frage kamen Gontard theatralisch vor, so wie eine einstudierte Geste – eine, die schon Tausende von Malen ausgeführt worden war. Er nickte.
Martha von Traunstein schlug die Augen auf. »Er war so ein sensibler Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er in eine Gewalttat verwickelt sein soll. Nicht einmal als Opfer.«
»Sie kannten ihn gut?«
»Ich halte Sie nicht für dumm, Herr Offizier.« Martha von Traunstein lächelte, und da war er wieder, der Engel.
»Wenn Sie herumfragen, wird Ihnen bald jemand davon erzählen. Ich hatte ein Verhältnis mit Cornelius Puch. Aber das ist lange her. Ich habe das beendet. Er hat das akzeptiert. Und wir sind Freunde geworden.«
Gontard runzelte die Stirn. Er glaubte nicht an verlassene Liebhaber, die ihrer Angebeteten täglich begegneten und sich damit zufriedengaben. Martha von Traunstein schaute arglos aus ihren braunen Augen. So guckten Frauen, um von ihren Worten abzulenken, dachte Gontard. Er schwieg.
Martha von Traunstein ließ ihr Tuch los und ergriff Gontards Hand. »Er war bis zuletzt voller Sanftmut. Das können Sie mir glauben.«
Ihre Hand lag so leicht auf der Gontards, dass dieser fürchtete, ein Windstoß könnte die Finger hinfortwehen. Das wäre schade. So einen Moment reiner Poesie erlebte Gontard nicht häufig – mit Henriette schon seit Jahren nicht mehr, und auch sonst nicht, als verheirateter Mann.
Gontard fragte: »Weiß Ihr Gatte davon?«
»Herrmann ist ein älterer Herr. Schon als er mich ehelichte, wusste er, dass ich gewisse Bedürfnisse habe. Ich bin diskret, und er behelligt mich nicht mit Nachstellungen.« Sie zog ihre Hand zurück und begann erneut, an ihrem Tuch herumzuspielen.
Jetzt gab es schon zwei Männer mit Hörnern und Verständnis – und einen von beiden hatte er gestern tot im Landwehrkanal gefunden. Gontard fragte: »Haben Sie in letzter Zeit beobachtet, dass Ihr Mann und Herr Puch Streit hatten?«
Martha von Traunstein schaute so entsetzt, als habe Gontard ihr Prügel angedroht. Sie antwortete: »Herr Oberst-Lieutenant, was denken Sie! Natürlich nicht. Cornelius war stets ein treuer Diener unseres Hauses. Und Herrmann hat seine Arbeit hoch geschätzt. Selbst wenn Herrmann etwas von unserer längst vergangenen Liaison bemerkt hat, würde er sich nie zu einer unbedachten Tat hinreißen lassen.« Martha von Traunstein unterstrich ihre Worte, indem sie mit dem Zeigefinger in der Luft herumwedelte.
Bei dieser theatralischen Geste fiel Gontard ein, woher er die junge Dame kannte. Sie sang an der Oper. Er hatte sie erst letztlich als Agathe im Freischütz gesehen. Wann war das? Im vergangenen Frühjahr? Oder im Winter? Er sollte öfter in die Oper gehen. Am besten mit Henriette.
»Sie werden dieses Gespräch doch vertraulich behandeln, Herr Oberst-Lieutenant? Sie sind doch ein Ehrenmann.«
»Das ist selbstverständlich.« Gontard deutete eine Verbeugung an. »Sie könnten mir indes einen Gefallen tun, indem Sie mir die Adresse des Herrn Puch verraten.«
Martha von Traunstein nickte ernst. »Er wohnt im Scheunenviertel. Ich werde nachschauen, wie seine Vermieterin hieß, und Ihnen die genaue Adresse zukommen lassen.«
Warum hatte er den Jungen nur mitgenommen? Paul Quappe ärgerte sich. Die Papiere hätte er für seinen Herrn auch allein von der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule holen können. Aber nein, er musste Ferdinand von Gontards Bettelei erhören, und nun hatte er seine Quengelei zu ertragen.
»Ich würde nur zu gern mehr über den Mordfall wissen.« Ferdinand rief die Worte durch den Straßenlärm Unter den Linden. Eine Frau mit einem riesigen Bastkorb drehte sich zu ihnen herum und starrte sie mit offenem Mund an. Sie hatte die Figur einer Küchenmamsell, die täglich schwere Töpfe und Tiegel wuchten musste und dabei nicht zu knapp von den herrschaftlichen Speisen kostete.
Quappe klemmte die Rolle mit den Papieren fester unter den Arm. Mit der freien Hand schnappte er Ferdinand bei der Jacke und zog ihn zur Seite. Er lenkte den jungen Herrn vorbei an der Mamsell mit dem Korb, an der Familie mit den zeternden Kindern, am Bettler an der Straßenecke und hinein in die Neustädtische Kirchstraße. Hier ließ der Trubel nach, und auch das Gepolter der Fuhrwerke schallte nur aus dem Hintergrund in die Nebenstraße.
Quappe eilte noch ein paar Schritte weiter weg von den Linden und sagte: »Junga Herr, Sie bring’n mir inne Bredullje. Redn Se bitte von na leidijen Meuchelei nich vor die janzen Leute!«
»Ich werde mich beherrschen, Herr Quappe.« Ferdinand blickte zum Trubel zurück. »Aber Sie müssen doch zugeben, dass der Mordfall aufregend ist!«
Quappe schritt Richtung des Gontard’schen Hauses in der Dorotheenstraße und sagte nichts. Auf diese Diskussion ließ er sich nicht ein. Natürlich wollte auch er brennend gern wissen, wer einen Mann an einem friedlichen Sommertag vor den Thoren der Residenzstadt in die Brust schoss. Nur, wenn er das zugab, würde der Junge keine Ruhe mehr geben.
»Was wird der Täter für ein Mann sein? Hat er eine entstellte Fratze? Oder kann er seine Bosheit verbergen? Ist es gar ein Herr mit ehrenhaftem Antlitz?«
»Am Ende isset noch ’ne Madame jewesen«, sagte Quappe und ärgerte sich im selben Augenblick über seine Worte.
»Tatsächlich. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Halten Sie das für möglich?«
Quappe schwieg.
»Bestimmt hat mein Vater eine entsprechende Andeutung gemacht. Habe ich recht, Herr Quappe?«
»Nich ins Jeringste, junga Herr. Da Herr Oberst-Lieutenant hat nix derjleichen jesagt. Ick hab nur laut jedacht.« Quappe tippte sich an die Stirn. »Ick glob nich, dass ’ne Madamme so ’n Mord bejehen täte. Ditte passt nich mittenander, so ’ne Waffe un ’ne Frau. Ick meene, stelln Se sich ma vor: Ihre Frau Mama mitm Schießjewehr.« Quappe hielt es durchaus für möglich, dass andere Frauen eine Waffe auslösen könnten. Er dachte an den Blick der kräftigen Mamsell Unter den Linden. Er wollte sich lieber nicht ausmalen, was so ein Weib mit einer Flinte anstellen konnte. Aber der junge Herr hielt fürs Erste den Mund. Und das war das Wichtigste.
Sie erreichten die Dorotheenstraße und bogen nach rechts. Nur noch wenige Meter bis zur Friedrichstraße, der Lärm wuchs erneut an. Zeitungsjungen riefen Nachrichten, ein Reiter scheuchte Fußvolk von der Straße, Bälger quäkten. Ferdinand schwieg artig.
Sie passten den rechten Moment ab und eilten über den Fahrweg. Nun waren es nur noch ein paar Meter.
Ferdinand zog Quappe am Ärmel und fragte: »Herr Quappe, würden Sie nicht gern wissen, was in den Papieren steht?«
Nein, das wollte er nicht. Ganz sicher wollte er das nicht. Oder sollten sie doch einen Blick in die Blätter werfen? Aber würden sie überhaupt etwas verstehen?
Quappe sagte: »Da Diensthabende hat mich die Papiere inner Rolle jegeben und nich lose inne Hand jedrückt. Ditte wird schon Jründe ham.«
»Vermutlich ließen sie sich so besser transportieren.« Dem jungen Herrn fiel stets eine Spitzfindigkeit ein.
Quappe öffnete den Dienstboteneingang des Gontardsch’schen Hauses. »Ick werd de Rolle uffbewahrn, bis da Herr Oberst-Lieutenant mit seine wichtijen Erledijungen fertig is.«
»Die Papiere werden doch nicht schlechter, wenn wir sie betrachten.«
Quappe trat ins Haus.
»Wenn das streng geheime Unterlagen wären, hätte mein Vater sie bestimmt versiegeln lassen. Ganz sicher.«
Quappe inspizierte die Rolle. Der junge Herr hatte recht. Die Rolle war verpropft, aber nicht versiegelt.
»Mein Vater würde nicht einmal bemerken, dass wir die Papiere eingesehen haben.«
Es kam Quappe so vor, als würde der Leibhaftige persönlich ihm eine Versuchung ins Ohr flüstern. Er schlich durchs Gontard’sche Haus. Natürlich war er auch neugierig. Und sicher würde keiner bemerken, wenn er mal über die Papiere schaute. Vielleicht konnte er dem Herrn sogar besser zu Diensten sein, wenn er die Unterlagen studierte.
»So ’n janz winzijen Blick könn wa ja uff de Papier wagn.« Quappe betrat die Dienstküche. »Aba erst machen wa den Tisch sauba.«
Als Quappe aufblickte, hielt Ferdinand bereits einen Lappen in der Hand. Der junge Herr wischte den Tisch ab – persönlich. Quappe zog den Propfen aus der Rolle und breitete die Blätter aus.
Die Papiere enthielten Tabellen mit jeder Menge Zahlen. Wollte Oberst-Lieutenant von Gontard den Mörder mit einer mathematischen Formel errechnen?
»Wie stark ist die Strömung an dieser Stelle?« Gontard zeigte in das Bassin, in dem sie am Vortag die Leiche gefunden hatten.
»Hier in dem Bassin steht das Wasser. Auch der Landwehrkanal ist nicht gerade ein reißender Strom.« Peter Joseph Lenné wiegte den Kopf, als fühle er die Fließgeschwindigkeit nach. »Aber er ist natürlich in Bewegung. Ich lasse Ihnen die genauen Messdaten gern zukommen.«
»Das wäre gut. Für die Berechnungen bezüglich des Erdrutsches werde ich die Unterlagen gebrauchen können. In dem Mordfall werden sie mir wohl nicht helfen.«
Der Königliche Gartendirektor und Stadtplaner zuckte mit den Achseln. Er schritt auf das Bassin zu und zeigte auf die Wasseroberfläche, die wie frisch geplättet vor ihnen lag. »Da werden Sie keine weiteren Daten benötigen«, sagte Lenné. »Der Mann wird wohl ungefähr an der Stelle ins Wasser gefallen sein, wo er gestern aufgetaucht ist. Das scheint mir auf der Hand zu liegen.«
Gontard überlegte, trat neben Lenné und fragte: »Wenn der Mann dort auf dem Grund lag, als das Ufer abrutschte … warum ist er dann nicht verschüttet worden?«
»Hm.« Lenné zog seine Stirn in Falten. Er trat auf dem Boden herum, als wolle er ihn befestigen. Oder versuchte er, einen weiteren Erdrutsch auszulösen? Tatsächlich purzelte ein Erdklumpen hinab. Er blieb am Rande des Wassers liegen. Ein paar Wellen zogen gen Bassinmitte.
»Ich vermute, das Erdreich hat den Leichnam in die Mitte des Bassins geschoben und nur teilweise bedeckt. Dann kam er wieder hoch und hing mit einer Extremität fest.«
Gontard schaute den Wellen nach. Das Mordopfer konnte am Rande des Bassins gestanden haben und dort von dem Schuss oder dem Hieb getroffen worden sein. Oder der Mörder hatte ihn erschossen und danach in den Kanal geworfen. Aber warum war das Kanalufer abgerutscht? Doch nicht etwa, weil ein einzelner Mann in das Gewässer gestürzt war?
»Konnten Ihre Offiziere schon an den Bodenproben forschen?«, unterbrach Lenné Gontards Gedanken.
»Ich hoffe, die Herren widmen sich zur Stunde im Labor ihrer Aufgabe.« Gontard musste ein Grinsen unterdrücken. Tatsächlich glaubte er nicht, dass die beiden Freiwilligen noch in der Schule weilten. Aber sicher hatten Heye und sein Kumpan genügend Messungen vorgenommen, um morgen mit ein paar Daten aufwarten zu können.
»Ja, ich weiß, wie langwierig solche Untersuchungen sein können.« Lenné kratzte sich an der Stirn. »Aber um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass Sie in dem Baumaterial Ursachen für mein Problem mit der Böschung finden.« Lenné trat einen Schritt näher.
Gontard schwieg.
»Schauen Sie«, fuhr Lenné fort, »die Backsteine für die Klinkerverkleidung kommen von der Königlichen Ziegelei in Johannisthal. Deren Qualität ist über jeden Zweifel erhaben.« Lenné beugte sich nah zu Gontard, so dass er beinahe flüsterte. »Ich persönlich würde für einen Privatbau die Ziegel aus Rathenow bevorzugen, aber auch das Material aus Johannisthal ist makellos.«
Gontard dachte daran, wie ungehalten Häußler am Vortag auf die Entnahme der Bodenproben reagiert hatte. Und nun verteidigte Lenné das Baumaterial, ohne die Laborergebnisse zu kennen. Verbarg der Königliche Gartendirektor etwas? Gontard wechselte das Thema und fragte: »Warum muss der Kanal eigentlich so eilig fertiggestellt werden? Er ist doch schon seit Jahren im Bau.«
»Seit mehr als fünf Jahren, um genau zu sein.«
»Kommt es da auf ein paar Tage an?«
Lenné lachte. Es klang, als hörte er einen Witz zum dritten Mal und kicherte gegen die Langeweile an. »Herr Oberst-Lieutenant, hier geht es nicht um ein paar Tage. Der Termin ist bereits angekündigt. Wenn der nicht gehalten wird, müssen wir einen neuen suchen. Was glauben Sie, wann alle Honoratioren wieder Zeit haben? Im Herbst? Zur Weihnacht? Im nächsten Frühjahr?« Der Königliche Gartendirektor lächelte bitter. »Wie Sie vielleicht wissen, Herr Oberst-Lieutenant, habe ich eine Vision für die Erweiterung der Residenzstadt. Seit Jahren sind die Pläne fertig. Der König höchstpersönlich hat sie abgezeichnet.« Lenné zeigte mit der rechten Hand über die Wiesen gen Stadt. »Hier, wo wir jetzt stehen, könnte längst alles bebaut sein. Nur bekommen wir die verdammten Baumaterialien nicht heran!«
Wie viele Menschen könnten auf den Wiesen vor den Thoren Berlins wohnen? Gontard wusste, dass in den Jahrzehnten seit der Bauernbefreiung Zigtausende von Bauern nach Berlin gekommen waren, und viele suchten auch jetzt ihr Glück in der Stadt. Hier schossen die Fabriken aus dem Boden wie Pilze nach einem Herbstregen, und die Fabrikherren brauchten billige Arbeitskräfte. Aber schon jetzt wohnten über 430 000 Menschen in Berlin. Wo sollte das hinführen?
»Und jetzt auch noch der!« Lenné zeigte über die Wiesen. Häußler stapfte mit einem Mann durch den Rasen, den Gontard irgendwoher zu kennen meinte.
Der Gartendirektor zeterte: »Bestimmt macht dieser Schmierfink mit seinem Geschreibe unser ehrbares Gewerbe schlecht. Als wenn ich nicht genug zu tun hätte!«
Gontard erkannte den Mann: Es war Grahsen von der Königlich privilegirten Berlinischen Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, im Volksmund bekannt als die Vossische.
Gontard führte sein Pferd an der Hand und grinste. Er hatte sich von Lenné verabschiedet, bevor Grahsen den Kanal erreicht hatte, und hinter der Baumgruppe gewartet. Den Journalisten wollte er lieber unter vier Augen sprechen. Und tatsächlich, das Warten hatte sich gelohnt. Grahsen kam, allein.
Der Reporter schien in Gedanken versunken zu sein. Er guckte auf seine Füße und brabbelte vor sich hin. Hin und wieder schüttelte er den Kopf, so als würde er eine Geschichte erzählen, die er sich selbst nicht glaubte. Im Schatten der Baumgruppe blieb er kurz stehen und hob gestikulierend den Arm – eine Bewegung voller Pathos … und zu hektisch für Gontards Pferd. Der Rappe wieherte, als wollte er davonjagen.
»Ruhig, Großer, ruhig.« Gontard straffte die Zügel und tätschelte dem Rappen den Hals. Das Pferd beruhigte sich schnell. Nicht zuletzt, weil Grahsen plötzlich wie versteinert dastand.
»Wenn Sie nicht zu schnell machen, können Sie die Hand wieder herunternehmen«, spottete Gontard.
Grahsen verzog keine Miene. Es vergingen noch Sekunden, bis er den Arm bewegte. Er zeigte mit dem Finger auf Gontard und sagte: »Sie … Was machen Sie denn hier?«
»Ich vertreibe mir die Zeit an einem schattigen Fleck. Da draußen in der Sonne ist es nicht auszuhalten.«
Grahsen schien nicht so recht zu wissen, was er mit Gontards Sarkasmus anfangen sollte. Immerhin entspannte er sich und ließ den Arm sinken.
Gontard sagte versöhnlicher: »Ich habe hier nur ein wenig herumgestanden und gewartet. Das ist doch nicht verboten.«
»Nein, das hat der Dicke noch nicht wieder verboten«, erwiderte Grahsen.
Der Correspondent erlaubte sich vorlaute Sprüche über den König gegenüber einem preußischen Offizier. Sollte er auf diese Provokation eingehen? Gontard entschied sich dagegen, ein Correspondent der Vossischen lockte ihn nicht aus der Reserve. Er sagte: »Ihrem Blatt sollten Sie solche Reden besser nicht mehr anbieten, oder?«
»Sie sind ein Spaßvogel!«
Tatsache war, dass die Vossische in den letzten Monaten vor der Reaktion kuschte. In ganz Berlin spotteten die Leute über das Vorzeigeblatt der Liberalen während der März-Revolution und seine seltsame Wandlung ins Harmlose. Da musste sich ein Redakteur Häme gefallen lassen, fand Gontard, und grinste den Reporter an.
»Sie mit Ihrer Pickelhaube haben es gerade nötig!« Grahsen stemmte seine Hände in die Seiten. »Sie werfen uns vor, dass wir uns an die Zeiten anpassen? Ich sehe doch genau, wer im Café Stehely herumsitzt und dabei genau aufpasst, welche Ohren welche Worte hören.«
Da hatte Grahsen wohl recht. In der Residenzstadt schauten alle, wie sie ihren Allerwertesten retteten. Zu viele waren geflohen oder vertrieben worden. Außerdem hatte Gontard eine Familie zu versorgen – und er war ein Militär. Er konnte doch nicht einfach bei einer anderen Armee dienen, bei einer gegnerischen am Ende.
Gontard wechselte das Thema und fragte: »Eigentlich möchte ich nur wissen, was Sie hierher führt. Ist es der Erdrutsch oder der Mordfall?«
»Zunächst wollte ich mich über die mögliche Verzögerung bei den Kanalarbeiten informieren. Aber jetzt, da ich von dem Mord erfahren habe …« Grahsen ließ den Satz unvollendet in der Sommerhitze stehen.
»Sie haben mit Herrn Häußler ein angeregtes Gespräch geführt. Ging es um den Toten?«
»So eine Leiche ist schon etwas Außergewöhnliches.« Grahsen guckte, als wartete er, dass ihm weitere Worte zuflögen. Nach einem Moment fuhr er fort: »Das gilt natürlich besonders, wenn der Leichenfund mit einem Unglück an der Baustelle zusammentrifft.«
»Herr Häußler glaubt an einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Erdrutsch?«
»Ach was«, Grahsen winkte ab, »ich finde nur, dass hier zu viele Zufälle zusammenkommen. Die Sache stinkt. Das sage ich Ihnen.«
Was meinte Grahsen? Mit vagen Andeutungen konnte Gontard nichts anfangen. Aber wenn der Reporter so redete, hatte er sicher etwas mitzuteilen. Gontard tätschelte seinem Pferd die Mähne, auf dass es noch etwas Geduld habe.
»Das ist doch geradezu unglaublich.« Grahsen wies mit der Hand hinüber nach Berlin. »Vor den Thoren Berlins arbeiten eine Handvoll Menschen an einem Kanalstück. Dann liegt ein Schreiberling tot im Wasser, und alle hier draußen kannten den Mann. Wer wird da nicht stutzig.«
Tatsächlich erinnerte sich Gontard daran, dass Lenné das Opfer zumindest flüchtig gekannt hatte – aber die anderen? Da war ihm nichts aufgefallen. Er sagte: »Ich war hier mit niemandem bekannt, auch nicht mit dem Opfer.« Grahsen guckte, als wisse er nicht, ob er angelogen oder veralbert wurde.
»Nun gut, dem Herrn Gartendirektor bin ich schon zuvor begegnet«, gab Gontard zu. »Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er zu dem Todesopfer einen besonders engen Kontakt pflegte.«
»Das glaube ich auch nicht. Lenné wird wohl eher mit dem werten Herrn von Traunstein verkehrt sein.« Grahsen blickte um sich und fuhr dann leiser fort: »Und den Häußler kannten Sie nicht?«
»Nein, ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen.«
»Der war einer von den Kellerhalsrednern und hat große Volksreden gehalten, damals vor den Märztagen. Genauso wie Puch. Und dann standen die beiden Seit an Seit auf der Barrikade.« Grahsen lachte. »Und jetzt zieht der eine den anderen aus dem Wasser. Das finden Sie nicht seltsam?«
Tagebucheintrag No. 2, 23. August 1850
Den ganzen Tag habe ich auf diesen Moment gewartet. Darauf, dass ich meinen Stift ergreifen und Worte in dieses Buch schreiben kann. Nun ordne ich meine Gedanken. All das, was mir den ganzen Tag durch den Kopf geistert.
Es ist die Vergangenheit. Ich komme mir vor, als verfolge ich mich selbst. So als würde ich mein eigener Schatten sein. In einem fort suche ich dunkle Ecken. Aber ich entkomme nicht.
Auch Ablenkung will mir nicht gelingen. So wie heute Nachmittag. Ich sitze in der Conditorei und studiere Zeitungen. Noch vor ein paar Tagen hätte ich die Zeilen aufmerksam gelesen. Und heute? Mein Blick schwebt über die Absätze. Die Worte geben keinen Halt. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mich umschaue. Beobachtet einer, was ich lese? Erkennt einer, wonach ich suche? Nach einer Meldung über den Mordfall am Landwehrkanal?
Nein, Gedanken lesen können die nicht. Auch wenn Dr. Wiesenburg und seine Spitzel es gern täten. Die grauen Männer sitzen weiterhin nur herum und gucken dumm. Die machen lange Ohren und sehen aus wie Esel.
Wie schnell ich mich an diesen Unsinn wieder gewöhnt habe … Es ist wie vor dem ganzen Revolutionszauber. Das hätten wir wissen müssen. Nie ändert sich etwas. Vielleicht sieht es für ein paar Augenblicke so aus. Aber das geht schnell vorbei. Am Ende will das Geschmeiß einen vollen Wanst und seine Ruhe. Freiheit, pah! Als würde der Pöbel sich für so etwas interessieren.
Auf meinen Wanderungen durch die Stadt passiere ich die abgerissenen Gestalten. Lange sah man die kaum noch. Ein paar Groschen am Tag mehr gab’s nach den Kämpfen. Und nun? Alles wieder weg. Da stehen sie wieder in den Schlangen und betteln nach den Arbeiten für billigen Tagelohn.
Ich laufe gern durch die Oranienburger Vorstadt mit ihren riesigen Fabriken. Ausgerechnet am Oranienburger Thor reißt mich an diesem Nachmittag ein bekanntes Gesicht aus meinen Gedanken. Da läuft dieser Criminal-Commissarius Werpel herum. Wie ein Schnüffler schaut er an jede einzelne Haustüre. Die ganze Straße entlang. Und dann verschwindet er in einem Hauseingang.
Ich trage meine Verkleidung, den Hut, den Umhang, den Zwicker mit dem Fensterglas und so weiter. Also spreche ich seinen Constabler an. Eine fürchterlich dumme Person. Schwer für seinen Dienstherrn, gut für mich. Der erkennt mich bei einer etwaigen späteren Begegnung niemals. Kein Wunder, dass Commissarius Werpel den draußen vor der Tür stehen lässt.
Ich frage ihn nach dem Grund seiner Untersuchungen. Er fragt, wer das wissen wolle.
Ich behaupte, ich arbeite für eine höchst geheime Revisionscommission Seiner Majestät. Und müsse routinemäßig die Arbeit der Polizeibehörde überprüfen. Das dürfe er aber unter keinen Umständen jemandem verraten.
Na, wenn das so sei, sagt er sichtlich beeindruckt und beginnt zu flüstern. Man sei in einem Mordfall unterwegs. Die Causa habe sich am neuen Landwehrkanal zugetragen. Der Commissarius verhöre gerade einen Gesellen, der da arbeite.
Das habe ich befürchtet. Ich nehme mich zusammen, lasse mir die Sorge nicht anmerken. Ob es denn eine Spur gebe, frage ich.
Er habe keine Ahnung. Da müsse ich schon den Commissarius selbst fragen. Der komme sicher gleich wieder, sagt der Tölpel. Dem Commissarius will ich freilich nicht begegnen. Ich weise den Constabler noch einmal mit Nachdruck auf meine geheime Mission hin. Er werde schwer bestraft, würde er nur ein Wort über unser Gespräch verlieren.
Der Strohkopf schwört hoch und heilig Verschwiegenheit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht lache. Allein, viel schlauer bin ich nach dem Gespräch auch nicht.