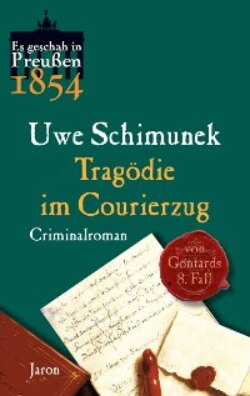Читать книгу Tragödie im Courierzug - Uwe Schimunek - Страница 11
13. Januar, ½ 3 Uhr nachmittags
ОглавлениеHier muss es doch irgendeinen Hinweis geben«, sagte Ferdinand von Gontard.
»Ick kann hier überhaupt nix erkennen.«
Der Leichnam lag nach einer halben Stunde Buddelei weitgehend frei. Doch noch immer ließen sich keine Details ausmachen. Freilich handelte es sich um eine ordentliche Sauerei. Die Maden hatten im vergangenen feuchten Herbst ganze Arbeit geleistet. Von dem Mann, der vor ihnen ruhte, konnten sie sich kaum ein Bild machen. Die Stofffetzen der Hose mochten von einer Uniform stammen, am Oberkörper hatte der Tote vielleicht ein grobes Hemd getragen. Zumindest eines stand fest: Wenn er einen Waffenrock sein Eigen genannt hatte, musste er diesen vor seinem Tod abgelegt haben. Von einer Pickelhaube gab es ebenfalls nach wie vor keine Spur.
»Vielleicht kieken wa mal drum rum«, schlug Quappe vor.
»Das ist keine schlechte Idee.« Ferdinand stapfte los. Mit jedem Schritt versank er tiefer im Schnee. Das Gehölz endete an der flussabgewandten Seite an einem Waldstück. Zwischen den Buchen wucherten im Sommer bestimmt die Farne, jetzt ragten die Bäume kahl aus dem glatten Weiß. Bis zu den ersten Buchen ging es leicht bergan.
»Scheiße!«, brüllte Quappe. Der Bursche war bis zur Hüfte in einer Schneewehe versunken. Er wühlte sich aus dem Loch und jaulte dabei wie ein Köter unter der Knute. »Ick gloob, mein Fuß fällt ab.«
Ferdinand reichte Quappe die Hand, zog ihn hoch und wies mit einem Nicken nach rechts. »Da vorn liegt ein Baumstamm, dort können Sie sich hinsetzen.«
Der Stallbursche legte Ferdinand die Hand über die Schulter. Gemeinsam bewältigten sie so den Weg zum Baumstamm. Ferdinand kam sich vor wie ein Soldat, der einen Verwundeten vom Schlachtfeld schleppte. Hoffentlich hatte Quappe sich nicht das Bein gebrochen.
»Aua! Verdammta Mist!«, jammerte Quappe. Er saß auf dem Stamm und zerrte an seinem Stiefel.
Ferdinand überlegte schon, ob er Quappe aus dem Schuhwerk helfen sollte. Doch der bekam den Fuß glücklicherweise allein frei. Unter den groben Lappen, die Quappe als Fußwickel benutzte, wurde eine ordentliche Schwellung sichtbar. »Legen Sie doch ein bisschen Schnee auf den Knöchel, Quappe! Das kühlt.«
Mit einem Wimmern bückte Quappe sich und pappte Klumpen für Klumpen Schnee auf seinen Fuß, bis dieser nicht mehr zu sehen war. Er drückte die weiße Masse fest und nörgelte: »Ick werd mir bestimmt erkälten.«
»Später, Quappe«, sagte Ferdinand. »Vorerst bleiben Sie hier sitzen! Und ich schaue mich noch mal im Dickicht um.«
»Sein Se vorsichtig!«
Ferdinand lachte und hob die Hand zu einem militärischen Gruß. Für den Weg zurück zum Gestrüpp nutzte er die bereits in den Schnee gedrückten Spuren. Als er den verletzten Quappe zum Stamm geschleppt hatte, war ein richtiger Pfad entstanden. Am Rande der Hecke untersuchte Ferdinand die Wehe näher, in der Quappe versunken war. Mit festen Stiefeltritten stieß er den Schnee beiseite. Darunter verbargen sich eine Kuhle oder ein Graben. Der Boden war braun und hart. Der Schnee stob unter Ferdinands Tritten in alle Richtungen. Jetzt erkannte Ferdinand, dass weder Kuhle noch Graben zu seinen Füßen lagen, sondern eher eine Art Trampelpfad.
Der Pfad führte in das Gestrüpp. Ferdinand kämpfte sich vorwärts. Vorsichtshalber schob er den Schnee vor jedem Schritt beiseite. In seinem Rücken jammerte Quappe schon wieder herum, und zumindest einer sollte gut zu Fuß bleiben. Nach ein paar Schritten gabelte sich der Pfad: Nach rechts führte er in den Wald hinauf, links teilte er die Sträucher. War der Mann an dieser Stelle ins Gebüsch gelangt? Ferdinand folgte dem Pfad ins Innere des Gestrüpps. Nach drei Schritten musste er sich bücken, da die Äste im Wipfel ineinandersteckten und eine Art Dach bildeten.
»Is allet jut bei Ihnen?«
»Ja!«, rief Ferdinand über die Schulter. »Von hier hinten müsste ich an die Leiche herankommen.«
»Sein Se achtsam!« Quappe wimmerte ohne Unterlass.
»Ja, ja.« So kurz vor dem Ziel hatte Ferdinand keine Zeit für die Sorgen des Stallburschen. Er brach ein paar nach unten ragende Äste ab und quetschte sich weiter durch das Gestrüpp. Drei Fuß vor der Fundstelle häufte sich Schnee an einem Strauch. Für ein bisschen Laub darunter war der Batzen zu groß. Ferdinand trat vorsichtig gegen den Schnee. Grobes Gewebe kam zum Vorschein. Ein Kleidungsstück? Ferdinand bückte sich und zog vorsichtig an dem Stoff. Der steckte fest. Als Ferdinand kräftiger zerrte, riss das Gewebe, und er hielt einen Fetzen in der Hand. Der Lappen war lehmbraun und augenscheinlich vermodert, bevor der Frost ihn unter dem Laub eingefroren hatte. Nun zerfiel das Textil bei der geringsten Beanspruchung. Er musste auf anderem Weg an das mutmaßliche Kleidungsstück herankommen. Vorsichtig legte Ferdinand seinen Fund mit den Händen frei. Weiter unten schien der Stoff besser erhalten zu sein. Es handelte sich um einen Waffenrock, das wurde immer deutlicher. Unter einem Ärmel lugte eine Pickelhaube hervor.
Christian Philipp von Gontard genoss die Ruhe in der Lesestube der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Nur ein weiterer Offizier saß am anderen Ende des Raumes und studierte schweigend eine Zeitschrift. Gontard hielt seine Pfeife in der linken und die Illustrirte Zeitung in der rechten Hand. Das Blatt aus dem sächsischen Leipzig schaffte Wundersames: Es wurde von Männern und Frauen gelesen. Gontard fesselten die langen Texte über politische, militärische und technische Themen, während die Abbildungen der neuesten Mode aus ganz Europa Henriette und seine Tochter gleichermaßen begeisterten. Dabei war die Illustrirte Zeitung keines dieser billigen Familienblätter, wie es die Kolporteure feilboten.
Gontard blätterte auf die zweite Seite, die den Nachrichten aus deutschen Landen und Europa vorbehalten war. Über Preußen gab es in dieser Woche nur einen kleinen Absatz. Gontard las: Die Festzeit hat eine politische Stille im Gefolge, die nur durch Gerüchte, Muthmaßungen und Besprechungen unterbrochen wird, welche wir übergehen müssen. In der Folge behandelte der Nachrichtenüberblick den Tod des Generals von Radowitz und ging auf den persönlichen Kondolenzbrief Seiner Majestät ein. Dass der Leichnam des Generals nach Erfurt überführt worden war, wusste Gontard schon. Dort diente Radowitz’ ältester Sohn als Offizier beim 31. Infanterieregiment, und in der Garnisonsstadt konnte der alte Radowitz seine Ruhe neben der bereits zuvor verstorbenen Tochter finden.
Danach berichtete der Absatz zu Preußen über einige Wirtschaftsangelegenheiten. Gontard überflog die Zeilen bis zu diesem Satz: Ein Erlass des einstweiligen Polizeidirektors in Stettin, Assessor Rudolff, wodurch der Ostseezeitung sehr enge Grenzen bei der Besprechung des russisch-türkischen Streits gesetzt worden waren, ist vom Minister des Inneren nicht gebilligt worden. Gontard stutzte. Innenminister Ferdinand von Westphalen galt weiß Gott nicht als Garant für Pressefreiheit. Sein Ministerium unterhielt das berüchtigte preußische Spitzelwesen. Gerüchten zufolge ließ er sogar Prinz Wilhelm wegen dessen kritischer Haltung zum Krimkrieg überwachen. Ausgerechnet dieser Minister sorgte nun dafür, dass die Stettiner ausgewogen informiert wurden – das war kaum zu glauben.
Gontard las in diesen Wochen die Illustrirte Zeitung aus dem Sächsischen intensiver als sonst, weil sie über die Krim berichtete. Er blätterte um, und sogleich begannen die ausführlichen Reports. Unter der Überschrift Vom Kriegsschauplatze fasste das Blatt die letzten Ereignisse zusammen: die Geländegewinne der Russen bei Poschow und unweit von Eriwan, die Hoffnung der Türken auf die Erhebung der Tschetschenen im Kaukasus, die Truppenkonzentration und einzelne Gefechte an der Donau, die Verschiebung von russischen Armee-Einheiten in die Walachei … Allerorten standen sich gigantische Truppen gegenüber, so verzeichnete der Bericht auf türkischer Seite allein längs der Donau und außer den stark besetzten Positionen von Schumla und Varna 123 000 Mann, während die Russen nur 110 000 zählen, bei einem Angriffe aber auf einem Punkte leicht mehr Truppen concentriren können, als ihnen der Feind dort gegenüber zu stellen hat. Welch ein Irrsinn, wie viele dieser Soldaten mit Hilfe der modernen Waffentechnik verheizt wurden!, dachte Gontard. Dafür hatten deutsche Dichter Shakespeares Wendung food for powder mit dem viel treffenderen Begriff Kanonenfutter übersetzt und in die deutsche Sprache aufgenommen.
Nach dem Überblick befasste sich die Illustrirte Zeitung mit der Schlacht von Oltenitza und dem Seekampf vor Sinope en détail. Mehr noch als der Text faszinierte Gontard die halbseitige Abbildung der Flottenverbände auf dem Schwarzen Meer. Das Bildnis war aus einer Perspektive von der offenen See her gefertigt. Im Vordergrund hatten mehrere Dutzend Kriegsschiffe die Segel gesetzt, zwischen den gewaltigen Dreimastern kreuzten kleinere Schiffe und auch eine Handvoll Boote mit Männern an den Rudern. Im Hintergrund, zu Lande, ragte die Festung von Sinope in die Höhe und sah imposanter aus als das Gebirge am Horizont.
Der Krieg war nicht nur durch die Flotte sichtbar, sondern schlich sich auch in Weiß ins Bild: in Form von Qualm. Die weißen Wolken auf dem Bild krochen über die spiegelglatte Wasserfläche wie die pure Unschuld. Die schiere Größe ließ allerdings auf den Schrecken gewaltiger Explosionen schließen. Gontard fuhr ein Schauer über den Rücken. Hinter der erhabenen Darstellung ahnte er den Tod in einer neuen, industriellen Form. Die Wolken auf dem Bild nahmen den armen Seelen das Gesicht und ließen sie im Zahlenwerk der Berichte verschwinden. Auch aus den Schornsteinen der Fabriken und Lokomotiven entwich solcher Qualm. Die neuen Formen von Krieg, Arbeit und Verkehr versteckten Schweiß und Blut zugunsten von Bilanzen …
Der Sergeant des Schuldirektors trat herbei und beugte sich zu ihm hinunter. »Der Herr Generaloberst von Schnöden würde Sie jetzt empfangen.«
»Ick würde jetzt lieber nach Hause jehn«, quengelte Quappe.
»Wir nehmen nur diesen winzigen Umweg und befragen die Männer dort«, bestimmte Ferdinand von Gontard und zeigte zum Oderufer. Gleich neben einem Wellenbrecher saßen zwei Angler und guckten über ihre Ruten auf den Fluss.
»Muss det sein?«
»Nun machen Sie mal halblang, Quappe! Wenn ich Sie erst nach Hause bringe und dann wiederkomme, sind die beiden Männer sonst wo.«
Quappe stützte sich auf einen großen Ast, den Ferdinand ihm vor ihrem Aufbruch aus dem Wald geholt hatte.
Ferdinand sah, wie Quappe das Bündel mit dem Waffenrock und der Pickelhaube schulterte und so langsam loshumpelte, als müsse das verletzte Bein sofort amputiert werden. Am liebsten hätte er den Kerl mit einem kräftigen Tritt in den Hintern geheilt. Aber nein, Ferdinand ließ sich nicht von einem Stallburschen provozieren. Er lief los, überholte den Hinkenden und drehte sich nicht mehr um. Bis zu den Anglern war noch ein Stück Weg zurückzulegen. Er hatte nicht ewig Zeit, schließlich erwartete der Bataillonskommandeur seinen Bericht schon an diesem Nachmittag.
Der Pfad am Ufer war festgetrampelt. Auf dem Marsch flussaufwärts blies Ferdinand der Wind ins Gesicht. Das verhieß nichts Gutes, aus dem Osten kam zumeist Kälte nach Breslau. Von der Aue wehten Schneekristalle herüber und bissen in die Gesichtshaut, als wären sie winzige Insekten. Ferdinand lief schneller, dabei beugte er den Oberkörper gegen die Brise. Eine Rute zum Stützen wäre nicht schlecht gewesen. Er hätte einen zweiten Ast abbrechen sollen, dachte Ferdinand. Doch nun blieben bis zu den beiden Männern nur noch wenige Schritte.
Die Angler starrten auf den Fluss, vermutlich hörten sie die Schritte gegen den Wind nicht.
»Guten Tag, die Herren!«, rief Ferdinand, um die Fischer mit seinem plötzlichen Auftauchen nicht zu erschrecken.
Die beiden drehten ihre Köpfe gleichzeitig zu ihm, besser hätten geübte Tänzer das auch nicht gekonnt. Eine Antwort bekam Ferdinand nicht.
»Ich habe ein paar Fragen an Sie.«
Die beiden glotzten, als wären sie selbst Fische.
»Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nicht über Gebühr beanspruchen. Es dauert wirklich nur einen Augenblick.« Ferdinand sprach gegen den Wind an und rief sich zugleich ins Bewusstsein, dass er ein Offizier Seiner Majestät in Uniform war. Deshalb beschloss er, den freundlichen Ton abzulegen, sollten die Angler nicht bald zuvorkommender reagieren. Zunächst versuchte er, einen respekteinflößenden Gesichtsausdruck zu machen.
»Guten Tag, Herr Offizier!«, sagte der Angler, der näher zu Ferdinand saß, und erhob sich.
Warum nicht gleich so?, dachte Ferdinand und betrachtete den Mann. Der Fischer war in mehrere Lagen schäbiger Kleidung eingepackt. Aus dem Mantel mit den zahllosen Flicken guckten eine Joppe und ein grobes Hemd heraus. Alle Kleidungsstücke mussten ihre Farbe bereits vor Jahren verloren haben. Der Angler trug außerdem eine Mütze aus derber Wolle, aus welcher der graue Zottelbart direkt herauszuwachsen schien. Der Graue zog die Mütze und schaute zu seinem Kumpel. Der sah ebenso ärmlich aus, sein Bart war allerdings von sattem Schwarz. Vermutlich zählte der zweite Mann zehn, fünfzehn Jahre weniger. Er nahm seine Mütze ebenfalls ab, deutete einen militärischen Gruß an und schwieg.
»Beißen die Fische?«, fragte Ferdinand.
»Es könnte besser sein, Herr Offizier«, antwortete der Graue und zeigte auf einen Eimer, der lediglich klares Wasser enthielt.
»Fischen Sie hier des Öfteren, meine Herren?«
Die beiden sahen sich an, als befürchteten sie, etwas Falsches zu sagen. Sie schwiegen erst einmal. Dabei war das Angeln hier nicht verboten, schließlich handelte es sich nicht um ein privates Flussufer.
»Ich ermittle in einer militärischen Angelegenheit und erbitte lediglich ein paar Auskünfte.« Ferdinand dachte daran, wie er bei der Begrüßung der beiden Männer erst nach dem bösen Blick eine vernünftige Reaktion erhalten hatte, und fügte hinzu: »Die Informationen sind mir allerdings sehr wichtig.«
Der Alte zog den Kopf ein, der Jüngere starrte auf den Boden. Die beiden sahen aus, als trauten sie sich nicht einmal, im Erdboden zu versinken.
»Fischen Sie immer an dieser Stelle?«
Der Alte schaute zum Jüngeren, der hob den Kopf. War das ein Nicken? Nach einigem Zögern antwortete der Alte: »Wenn es wärmer ist, gibt es eine Menge Leute, die hier fischen. Gelegentlich sitzen wir daher auch weiter stromaufwärts.«
»Wie viele Angler gibt es denn hier gewöhnlich, sagen wir, im Spätsommer?«
Der Alte seufzte. »Puh … Bei gutem Wetter vielleicht ein paar Dutzend. Auf dieser Seite des Flusses.«
»Kennen Sie die anderen Angler alle?«
»Nicht alle, aber die meisten. Wenngleich wahrlich nicht alle unsere Freunde sind.« Der Alte wiegte den Kopf. »Sehr viel zu reden gibt es beim Fischen auch nicht.«
»Sitzen Sie gelegentlich auch dahinten?« Ferdinand zeigte stromabwärts, zu der Biegung, wo sich das Gestrüpp mit dem Leichnam befand.
»Dort?« Die Frage klang wie: Sind Sie noch bei Sinnen? Der Alte schlug prompt die Hand vor den Mund.
Ferdinand reagierte mit einem scharfen Blick.
»Es ist nur so«, half der Jüngere seinem Kompagnon, »dass dort unten der Fluss schmaler und daher die Strömung stärker wird. An dieser Stelle beißen die Fische nicht. Da treffen sich eher Liebespaare. Oder Ihresgleichen, wenn es einen Disput auszutragen gilt.«
Ferdinand hatte von den Duellen gehört, die zwar illegal, aber zumeist geduldet waren. Dass in unmittelbarer Nähe eines beliebten Ortes für die Zweikämpfe ein toter Offizier lag, ließ den Leichenfund in einem neuen Licht erscheinen.