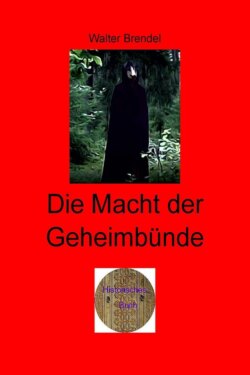Читать книгу Die Macht der Geimbünde - Walter Brendel - Страница 9
ОглавлениеMittelalter
Mittelalter wies dann zahlreiche, mit der Kirche in Widerspruch stehende religiöse Verbrüderung auf, die Tempelherren, die Katharer, Waldenser und andere.
Neuzeit (17. und 18. Jahrhundert)
Der von Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründete Orden der Illuminaten wagte sich mit noch ungeklärten Ideen an die Politik, wo er rasch viele Proselyten machte und sich lange noch nach seiner Aufhebung 1787 insgeheim forterhielt.
Neuzeit bis 1830
Erst als Napoleon I. mit der Anarchie zugleich die Freiheit zu ersticken drohte, entstanden immer häufiger geheime politische Verbindungen, wie die der Philadelphen, die sich ungeachtet aller Gegenmaßnahmen bis zum Sturz des Kaisers hielten.
Ebenso die Charbonniers im östlichen Frankreich, deren Propaganda in Italien die Carbonari ins Leben rief. In Deutschlandhatte sich unter der napoleonischen Herrschaft die Idee desnationalen Widerstands zunächst 1808 in den Tugendbund geflüchtet, dessen Satzungen übrigens der Staatsregierung bekannt waren, und der bereits am 31. Dezember 1809 wiederaufgelöst wurde. Er gab anschließend noch mehrere Jahre den Namen her für alle antifranzösische Agitation in Deutschland. Wirkliche Geheimbünde deutscher Patrioten waren der Friedrich Ludwig Jahn und Karl Friedrich Friesen 1810 gegründete Deutsche Bund, der Eiserne Bund, der Bund der Charlottenburger und andere. Wie in Deutschland und Italien bildeten sich auch anderwärts Geheimbünde mit durchaus nationaler Tendenz, insbesondere als mit dem Sieg über den verhassten Napoleon das Legitimitätsprinzip zu neuer Geltung kam. Einen entschieden nationalen Charakter hatte die 1795 gestiftete und1814 erneuerte Hetärie der Griechen zur Befreiung von der türkischen Herrschaft und die seit 1817 in Polen gestifteten Geheimbünde unter den Namen des Patriotischen Vereins, den Bundes der Sensenträger, der Strahlende, der Philareten und der Templer. Die teilweise Entdeckung der Templer führte zu ihrem Zusammengehen mit dem Patriotischen Verein. Der missglückte Ausbruch der Verschwörung der Dekabristen in St. Petersburg nach dem Tod Alexanders I. hatte dann auch die Auflösung des polnischen Patriotischen Vereins zur Folge, an dessen Stelle 1828 eine geheime Verbindung zunächst der Warschauer Militärschule entstand, die, zu einem Jünglingsbunde erweitert, den Anstoß zur polnischen Erhebung 1830 gab. Auch nach der Unterdrückung dieses Aufstands dauerten die zum Teil von der Emigration in Frankreich geleiteten Versuche zur Gründung revolutionärer Gesellschaften fort und führten zu den Aufständen von Krakau, Posen und zum Januaraufstand.
Im Westen und Süden Europas war das Ziel der Geheimbünde seit der Restauration von 1815 und der damit verbundenen Reaktion neben den erwähnten nationalen Einigungsabsichten auch auf die Einführung wirklich verfassungsmäßiger Zustände gerichtet. So hatten in Italien die Carbonari - weniger die Camorra und die Mafia - in Spanien die Freimaurer und Comuneros eine liberale, zum Teil demokratische Färbung.
In Frankreich bildeten sich solche Verbindungen zunächst im Interesse der napoleonischen Dynastie unter verschiedenen Namen, wie Verein der schwarzen Nadel, der Patrioten von 1816, der Geier Bonapartes, der Sonnenritter, der europäisch-reformistischen Patrioten und der Allgemeinen Regeneration. Diese verschmolzen mit den Carbonari, so dass Paris Hauptsitz der Charbonnerie wurde. Bald nach dem Frieden entstand auch in Deutschland, vor allem am Rhein entlang, eine vom früheren Tugendbund mancher entlehnenden geheimen Verbindung, die aber bald wieder einging. Später bildete sich aus der allgemeinen deutschen Burschenschaft ein Jugendbund (Unbedingte), zum Teil als Opposition gegen die so genannte Adelskette und gegen jesuitische Umtriebe.
Neuzeit 1830
Eine neue Phase in der Geschichte der Geheimbünde beginnt mit der französischen Julirevolution 1830. In Frankreich gingen aus der karlistischen Partei Gesellschaften hervor, wie die der Chevaliers de la legimité. Die republikanische Partei erzeugte eine neue Charbonnerie démocratique, und als Bestandteil der zahlreichen Gesellschaften der Menschenrechte bildete sich eine besondere Section d'action. Nachdem anschließend in Italien erneute revolutionäre Versuche gescheitert waren, stifteten mehrere Emigranten, u.a. Mazzini, in Opposition mit der französischen Charbonnerie, das Junge Italien. Nach dessen Vorbild entstand ein Junges Deutschland, Junges Polen, Junges Frankreich und eine Junge Schweiz, die alle als Junges Europa in gegenseitigen Austausch zu treten suchten.
Nach dem Tod Ferdinands VII. 1833 bildeten sich in Spanienaus den Überresten früherer Vereine, aus der Carbonaria und dem Jungen Europa eine Menge geheimer Gesellschaften, wieder der Isabellinos, der Hohen Templer, der Menschenrechte, der unregelmäßigen Freimaurer und das in Barcelona gegründete Junge Spanien. Diese Vereine bezweckten entweder nur eine Abwehr des karlistischen Despotismus und der Priesterherrschaft oder sie gingen auf die Wiederherstellung der Konstitution von 1812 oder der Republik aus. Ihnen gegenüber traten mehrere karlistische Vereine auf, wie die Sonnenritter, während der gemäßigte Liberalismus der Gesellschaft der Jovellanisten zuneigte. In ähnlicher Weise tauchten in Portugal Verbindungen der Septembristen, Charlisten und Miquelisten auf, die zeitweise verschwanden und unter neuen Namen und Formen wiederauftauchten.
In Deutschland nahm ein Teil der Burschenschaft schon vor dem Frankfurter Attentat als Germania die Gestalt einer geheimen Verbindung an. Nicht lange nach jenem Attentat bildete sich in Frankfurt am Main und Umgebung ein Männerbund mitdemokratischer Tendenz.
In England traten die schon lange gegründeten torystischen Orangelogen immer entschiedener hervor. Ebenso waren in Irland seit dem 18. Jahrhundert geheime politische Organisationen unter abenteuerlichen Namen aktiv:
• seit 1760 die Whiteboys
• die Rightboys
• die Shanvests
• seit 1722 die Hearts of Steel
• die Corders
• die Caravak
• die Oak Boys and Treffers
• seit 1781 die United Irishmen
• 1817 die Bandmänner.
Diese Gruppen hatten eine agrarische Neuorganisation und politische Unabhängigkeit Irlands zum Zweck. Neben den öffentlichen Vereinen (Gewerkschaften) der Arbeiter in Großbritannien und Irland und dem Chartismus bildeten sich auch Geheimbünde, die aber mehr auf Erlangung höherer Lohnsätze als auf politische Ziele ausgingen. Überhaupt konnten in der britischen Gesellschaft politische Geheimbünde schon deshalbweniger tiefe Wurzeln schlagen, weil das Vereins- und Versammlungsrecht bereits gesetzlich anerkannt war.
Frankreich blieb im Weiteren der Hauptherd der Geheimen Gesellschaften. Nachdem dort die Republikanische Partei im Aufstand von 1834 eine schwere Niederlage erlitten hatte, entstanden die zahlreichen Vereine, die eine Verwirklichung des Sozialismus oder des Kommunismus zum Ziel hatten. Auch in einigen deutschen Staaten entdeckte man seit 1840 einige geheime, meist von Handwerkern gestiftete Vereine, die ähnliche Tendenzen aufzuweisen schienen. Diese Bestrebungen warenteilweise über die Schweiz hereingetragen worden, wo man1843 nach einer umfangreichen Untersuchung in Zürich kommunistische Verbände aufdecken konnte.
Einzelne Begriffe zur Herkunft, Gründung und Struktur
Ordensgemeinschaft
Eine Ordensgemeinschaft (auch Orden, von lat. ordo: Ordnung, Stand) ist eine durch eine Ordensregel verfasste Lebensgemeinschaft von Männern oder Frauen, die sich durch Ordensgelübde an ihre Lebensform binden und ein gemeinschaftliches religiöses Leben führen, beispielsweise in einem Kloster.
Francisco de Herrera der Ältere: Der Heilige Bonaventura tritt bei den Franziskanern ein (1628)
Von Ordensleuten zu unterscheiden sind Eremiten, die zwar oft Mönche bzw. Nonnen sind, aber als Einzelne ein Leben in der Einsamkeit führen, und andere traditionelle oder moderne Formen religiösen Lebens (etwa gottgeweihte Jungfrauen oder Witwen, Beginen und Begarden, Säkularinstitute, evangelische Diakonissen und Diakonengemeinschaften), die nicht in der Tradition des Ordenslebens stehen oder andersartig verfasst sind. Der im Deutschen außerhalb des kirchenrechtlichen Sprachgebrauchs allerdings wenig gebräuchliche Oberbegriff für alle, die eine der durch Gelübde oder bindendes Versprechen begründeten Formen eines gottgeweihten Lebens (lat. Vita consecrata) leben, lautet Religiosen bzw. gottgeweihte Personen.
In der römisch-katholischen (lateinischen) Kirche wird zwischen Orden im eigentlichen Sinn (länger als 700 Jahre bestehende Gemeinschaften, darunter Mönchsorden, Nonnenorden, geistliche Ritterorden, Bettelorden und Regularkanoniker), und Ordensgemeinschaften neuzeitlichen oder modernen Ursprungs(etwa seit dem 17. Jahrhundert) unterschieden. Letztere werden meist als Kongregationen bezeichnet. Diese Unterscheidung hatte im früheren Kirchenrecht große Bedeutung, spielt aber im heutigen Kodex kaum noch eine Rolle. Allerdings spiegeln sich die traditionellen Unterschiede zumeist im Eigenrecht der jeweiligen Gemeinschaften (bei Orden meist Regel, bei Kongregationen Konstitutionen genannt) wider.
Ordensgemeinschaften im westlichen Sinn gibt es in den orthodoxen Kirchen und den in derselben kirchlichen Tradition stehenden katholischen Ostkirchen kaum. Das orthodoxe Mönchtum wird vielmehr größtenteils in selbständigen Klöstern und Klosterverbänden (z. B. die Mönchsrepublik vom Berg Athos)praktiziert. In einem allgemeinen, weiteren Verständnis werden allerdings auch orthodoxe Mönche und Nonnen unter den Oberbegriff des Ordenslebens gefasst.
Die aus dem Kirchenrecht stammende Bezeichnung Orden wurde später auch von bestimmten weltlichen Gemeinschaften verwendet. So stifteten europäische Monarchien seit dem 14.Jahrhundert eine Reihe von höfischen Ritterorden, aus denen dann meist wichtige Verdienstorden hervorgingen (z. B. Hosenbandorden). Auch verschiedene nichtchristliche oder religiös ungebundene Gemeinschaften (z. B. Freimaurerbünde, Rosenkreuzer, Druidenorden oder auch Dichtergesellschaften wie der Pegnesische Blumenorden) bezeichneten sich manchmal als Orden, was zum Teil heute noch im Bereich der Esoterik geschieht.
Außer im Christentum gibt es Orden oder ordensähnliche Gemeinschaften auch in anderen Religionen, beispielsweise im Buddhismus, Hinduismus und Islam. Spiritualität und Lebensformen sind jedoch in den verschiedenen Religionen sehr unterschiedlich.
Geschichte der christlichen Ordensgemeinschaften
Ursprünge und Frühzeit Während der Zeit der Christenverfolgung war die große Anziehungskraft des christlichen Glaubens unter anderem darin begründet, dass Menschen mit Unbedingtheit und Unbeirrbarkeit ihren Glauben vertraten (das Neue Testament nennt dies "Zeugnis ablegen"), selbst wenn sie dafür ihr Leben verloren(Märtyrer oder Blutzeugen). Dies beruhte auf der Naherwartung der Wiederkunft Christi. Man glaubte, dass das Jüngste Gerichtinnerhalb der ersten oder zweiten Generation nach Jesu Tod eintreffen werde und man sich dafür nur durch kompromisslose Hingabe an das Gottesreich würdig erweisen konnte.
Durch Kontakt mit der Gnosis und der griechischen Philosophieentwickelte die frühe Christenheit eine von einem Hang zur Askese und einer gewissen Leibfeindlichkeit gekennzeichnete Spiritualität (obgleich sich diese aus den Evangelien selbst nur schwer ableiten lässt), bei der persönliche Hingabe an die Stelle der Naherwartung trat. Die Anhänger dieser Strömung suchten eine tiefere Gottesbegegnung und ihr persönliches Heil durch Enthaltsamkeit, harte Bußübungen, ständiges Gebet und Schweigen zu erlangen. Dabei kam ein sehr radikales Vollkommenheitsideal zum Tragen, das innerhalb einer weltlich orientierten Umgebung nur schwer zu verwirklichen war.
Bald gab das Bedürfnis, eine tiefere Gottverbundenheit und Spiritualität zu verwirklichen, Anstoß zur Entwicklung des christlichen Eremitentums, dessen theologische Basis − wie schonsein Name andeutet („Eremit“ bedeutet wörtlich „Wüstenbewohner“) − die alttestamentliche „Wüstentheologie“ ist. Der Begriff nimmt Bezug auf die innere Einkehr in der Wüste, die als Bild nicht nur für Stille und Zurückgezogenheit, sondern auch für den Gehorsam und die Anerkennung Gottes als Herrn steht, wie sie in der 40jährigen Wanderung der Israeliten in der Wüste nach ihrem Auszug aus Ägypten sowie in den Berufungsgeschichten des Mose und vieler biblischer Propheten zum Ausdruck kommt. Nicht zuletzt berichten die Evangelien in dieser Tradition auch von einem 40tägigen Aufenthalt Jesu in der Wüste als einem einschneidenden Moment der Entscheidung und Begegnung mit Gott. Das christlich-eremitische Leben entwickelte sich etwa zeitgleich in Syrien und Ägypten. Als erster christlicher Eremit in Ägypten gilt Paulus von Theben; sein Schüler Antonius der Große wurde zu einem der großen Wüstenväter.
Im Verlauf des 3. Jahrhunderts führten die Erfahrungen der Eremiten, die sich oft auch zu ganzen Einsiedlerkolonien zusammenschlossen, zu dem Bedürfnis vieler, ein auf Bescheidenheit und Gebet konzentriertes, zurückgezogenes Leben auch in einer Gemeinschaft führen zu können. Mönche und Nonnen - deren Lebensform sich aus Zusammenschlüssen von geweihten Jungfrauen entwickelt hatte -, die sich dem religiösen Leben in Gemeinschaft widmen, werden im Unterschied zu den Eremiten (Anachoreten) als Koinobiten bezeichnet. Um 320 gründete Pachomios (um 292 - 346) in Oberägypten das erste christliche Kloster. Basilius von Caesarea verfasste um 350 in Anlehnung an Pachomios' „Engelsregel“ eine Mönchsregel, die heute noch für die Mehrzahl der Klöster der orthodoxen Kirche gilt und auch Grundlage für die von Benedikt von Nursia um ca. 540 verfasste Benediktsregel war. Die Regeln der frühen Mönchsgemeinschaften zielten in der praktischen Verwirklichung des Evangeliums auf ein Gleichgewicht zwischen Gebet und tätiger Arbeit (ora et labora) ab und schrieben ein anspruchsloses, brüderliches gemeinsames Leben vor.
Schonfrüh wurden die drei Evangelischen Räte (Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam) als Synthese und Richtschnur dieser Lebensweiseangesehen und entwickelten sich zum unterscheidenden Merkmal und „Grundgesetz“ des Mönchtums und des Ordensstandes überhaupt. Sie sollten es den Religiosen ermöglichen, in der Nachahmung der Lebensweise Jesu (Imitatio Christi) zu leben und damit sowohl ihre persönliche Gottesbeziehung zu vertiefen als auch stellvertretend für das Seelenheil der Menschen ihres Umkreises zu beten. Die Benediktiner sind heute noch der größte und bedeutendste Mönchsorden des Abendlandes, der dieses Ideal zu verwirklichen sucht.
Mittelalter
In ihrem Bemühen, ihr religiöses Ideal mit einer nutzbringenden Arbeit zu verbinden und diese Aufgabe mit der geforderten Sorgfalt zu erfüllen, hatten die Orden, vor allem das benediktinische Mönchtum, großen Anteil an der Kultivierung Europas. Das in den Klöstern angesammelte Wissen ermöglichte es, die Kultur in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Medizin, Literatur, Musik, Kunst und Philosophie auf einen annähernd so hohen Stand zu bringen, wie er im römischen Reich vor der Völkerwanderung bestanden hatte.
Schenkungen, Erbschaften und erfolgreiches Wirtschaften führten in den Klöstern wie in der gesamten kirchlichen Organisation zu einem Anwachsen des Vermögens und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichpolitischen Macht. Im Lauf der Zeitkamen immer wieder Reformbewegungen auf, die zu den Ursprüngen des Mönchtums zurückkehren und die Klostergemeinschaft vor allem durch stärkere Askese und Disziplin gegen Verwässerung der religiösen Ideale und Verfall der Sittenschützen wollten. Dadurch kam es häufig zu Abspaltungen und Neugründungen. Im Zuge der Kirchenreformen des 11. Jahrhunderts gewann das so erneuerte Mönchtum (speziell Cluny und seine Tochtergründungen) entscheidenden kirchenpolitischen Einfluss und stellte eine Reihe von Päpsten. Später war es die von dem Cluniazensermönch und Prediger Bernard von Clairvaux inspirierte Reformbewegung der Zisterzienser, die die benediktinische Lebensweise wieder zu ihrer alten Strenge zurückführen wollte. Durch massive Klostergründungen und Rodungen in bis dahin wenig besiedelten oder unzugänglichen Waldgebieten wurden besonders die Zisterzienser im 12. Jahrhundert zu einem Motor der siedlungsgeschichtlichen Dynamik in vielen Gebieten Europas.
Als Reaktion auf die sozialen Spannungen in der hochmittelalterlichen Gesellschaft, die von einer wachsenden Bedeutung der Städte und den Umbrüchen der entstehenden Geldwirtschaft geprägt war, kamen im 13. Jahrhundert die so genannten Bettelorden oder Mendikanten (vor allem Franziskaner und Dominikaner) auf. Ähnlich wie viele außerhalb der Kirche angesiedelte und von dieser als Häretiker bekämpfte Bewegungen, die den offensichtlichen Widerspruch zwischen dem Leben der reichen und mächtigen Kirchenfürsten und der von Jesus vorgelebten evangelischen Armut brandmarkten, stellten diese neuen Gemeinschaften die Armut und Bedürfnislosigkeit Jesu in den Mittelpunkt ihres Lebens, das sich nun nicht mehr in der Abgeschiedenheit der Klöster abspielte, sondern vornehmlich in den Städten und mitten unter der Bevölkerung. Die Predigt war die Hauptaufgabe der Brüder, die so in Konkurrenz zu den Vertretern häretischer Armutsbewegungen traten und diese durchüberzeugendes Auftreten und eine vorbildhafte Lebensweise zu verdrängen suchten. Während sich die Dominikaner besonders der Erneuerung der Priesterausbildung, der theologischen Wissenschaft und der Katechese widmeten, stand bei den Franziskanern die Seelsorge und die konsequente Beachtung des Armutsideals im Vordergrund. Beide Gemeinschaften sind als kirchliche Antworten auf die akuten Gefährdungen der Kirche durch Zeitströmungen zu begreifen. Sie nahmen daher auch in der Ketzerverfolgung und Inquisition wichtige Funktionen ein. Auch die Karmeliten (eigentlich ein Eremitenorden) und die Augustiner-Eremiten (Mitte des 13. Jahrhunderts aus norditalienischen Mendikantengruppen entstanden) gehören zu den Bettelorden.
Frühe Neuzeit
Martin Luther, der zunächst selbst dem Orden der Augustiner-Eremiten angehörte, lehnte in seinen reformatorischen Lehrenden Zölibat der Priester und die Verpflichtung durch Ordensgelübde ab (einer freiwilligen Ehelosigkeit stand er zumindest anfänglich jedoch nicht ablehnend gegenüber). Die Verstrickung mancher Orden in die Ausbeutung der unteren Bevölkerungsschichten (Unfreiheit der Bauern, Fürstäbte) führte dazu, dass in den Bauernkriegen viele Abteien geplündert wurden. Nonnen und Mönche, die sich der Reformation anschlossen, verließen ihre Ordensgemeinschaften. Häufig wurden die Frauenklöster aber auch in weltliche Stifte umgewandelt, in denen die Stiftsdamen keine Gelübde auf Lebenszeit ablegten. Klöster in den evangelischen Fürstentümern und Städten wurden geschlossen. Das Vermögen und die Gebäude der Orden und Klöster wurden dabei manchmal von den Fürsten beschlagnahmt, meist allerdings für die Bezahlung der neuen evangelischen Pfarrer oder die Einrichtung von Schulen und Spitälern reserviert. Im 16. Jahrhundert bildete der neu gegründete Orden der Jesuiten ein wichtiges ausführendes Organ der einsetzenden Gegenreformation. Die Eroberung Amerikas und die Ausbreitung der Europäer über die gesamte Welt brachte eine völlig neue Perspektive auch für das Christentum.
Es wurde klar, dass die Bevölkerung der Erde größtenteils aus ungetauften „Heiden“ bestand. In der Folge vermischten sich redliche Bemühungen, die (aus der Sicht der Europäer) ungebildeten und damit der Hölle ausgelieferten „Eingeborenen“ mit dem christlichen Glauben bekannt zu machen, und die schamlose Ausbeutung der Menschen zu einer aus heutiger Sicht schändlichen Missionierung mit Feuer und Schwert. Die Franziskaner, die Jesuiten und die Dominikaner waren die ersten, die in Amerika missionierten, wobei es viele Priester gab, die Sklaverei und Zwangstaufen als Mittel zur Bekehrung und Zivilisierung der Bevölkerung ansahen. Die Orden gaben sich hier als ausführende Organe der erobernden Fürsten her, so dass politische Unterwerfung und christliche Evangelisierung untrennbar verbunden wurden. Es gab aber auch kritische Stimmen (z. B. Bartolome de Las Casas), die sich dieser Barbarei entgegenstellten. Heute wird Mission von den christlichen Kirchen völlig anders verstanden und ist meistens mit sozialem und auch politischem Engagement für die Menschen verbunden. Diese Sicht hat sich aber erst im 20.Jahrhundert durchgesetzt.
Neuzeit
Im 18. Jahrhundert führte die Aufklärung dazu, dass viele Fürsten, auch Kirchenfürsten, dem Ordensleben kritisch gegenüberstanden, sofern es nicht mit einer humanistischen oder sozialen Komponente verbunden war. So wurden beispielsweise reinkontemplative Gemeinschaften aufgefordert, sich an der Schulbildung der Bevölkerung zu beteiligen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte die Säkularisation zur Enteignung und Aufhebung vieler Klöster. Die Immobilien und das Vermögen der Orden floss den Fürsten zu, die damit für die Verluste durch die napoleonischen Kriege und die Neugestaltung der politischen Landkarte Europas (Wiener Kongress) entschädigt wurden. Viele Ordensgemeinschaften starben in der Folge aus, weil sie keine Novizen mehr aufnehmen durften. Nach der Säkularisation dagegen fand in der katholischen Kirche ein großer Neuaufbruch des Ordenslebens statt. Soziale Missstände wie mangelnde Krankenpflege, Volksbildung und Kinderfürsorge wurden aufgegriffen, in dem Weltpriester an vielen Orten Frauengemeinschaften gründeten, die häufig die Drittordensregel des Hl.Franz von Assisi oder die Regel der Barmherzigen Schwestern annahmen. Die evangelische Kirche griff dieses Anliegen in den mehrheitlich reformierten Gebieten unter anderem durch die Diakonissen und die von Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel auf. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts macht das katholische Ordensleben eine personelle Krise durch, während evangelische Gemeinschaften erst langsam an Bedeutung zunehmen. In der säkularisierten Welt ist die Attraktivität des Ordenslebens gesunken, Neueintritte werden zumindest bei den apostolisch lebenden Gemeinschaften seltener. Das un-ausgewogene Altersverhältnis führt mancherorts zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaften, die noch zu lösen sein werden. Dem gegenüber stehen einige neugegründete Gemeinschaften (mit jeweils eigenem Zweig für Männer und Frauen),wie etwa die Gemeinschaft von Jerusalem oder die Gemeinschaft vom Lamm, die eine hohe Zahl an Neueintritten zu verzeichnen haben und viele Neugründungen vornehmen.
In der westlichen Kirche unterscheidet man heute sechs Grundformen des Ordenslebens:
• Regularkanoniker
• Mönchsorden und kontemplative, streng klausurierte Nonnenorden
• Eremiten-Orden
• Geistliche Ritterorden (im Gegensatz zu den weltlichen Ritterorden)
• Bettelorden, auch Mendikanten genannt
• Regularkleriker
dazu die Kongregationen.
Ferner gab bzw. gibt es eine Reihe weltlicher Ritterorden, die zum Teil ursprünglich als geistliche Ritterorden gegründet wurden:
• Johanniterorden (unabhängige evangelische bzw. anglikanische Zweige des Malterserordens)
• Orden von Calatrava,
• Orden von Alcantara,
• Orden von Santiago,
• Orden von Montesa (heute der spanischen Krone unterstehend)
• Orden von Montjoie (im 13. Jahrhundert mit dem Orden von Calatrava vereinigt)
• Christusorden (als Verdienstorden des Heiligen Stuhles sowie der Republik Portugal)
• Schwertbrüderorden (im 14. Jahrhundert dem Deutschen Orden eingegliedert)
• Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem (im 19.Jahrhundert vom Heiligen Stuhl errichtet)
Es gibt neben den römisch-katholischen Orden auch altkatholische, anglikanische sowie evangelische Gemeinschaften und Kommunitäten, außerdem die relativ neue Lebensform der Säkularinstitute. Siehe auch Liste der Ordensgemeinschaften.
Ordensgemeinschaften in der römisch-katholischen Kirche
Maßgebend sind zurzeit die Bestimmungen über die Institute des geweihten Lebens (religiöse Leben) im Codex des Kanonischen Rechtes in der Fassung von 1983. Ein römisch-katholischer Orden ist eine Gemeinschaft von Mönchen (Ordensbrüder und Ordenspriester) bzw. Nonnen(Ordensschwestern), die sich in einem feierlichen Gelübde zum Leben nach den Evangelischen Räten unter einem Oberen und nach ihrer jeweiligen Ordensregel verpflichtet haben.
Zum Lebensstil der verschiedenen Orden gehört unbedingt die Lebensgemeinschaft in einem Konvent oder Kloster, die Feier des Stundengebets, ggf. eine Ordenstracht, der Gehorsam gegenüber einem Oberen (Abt oder Prior – bei Frauenorden eine Äbtissin, Priorin oder Oberin) – das Leben unter einer Ordensregel und die enge Verbindung von Gebet und Arbeit.
Viele Orden sind schon im frühen bis hohen Mittelalter entstanden, wie beispielsweise die Prämonstratenser, Benediktiner, der Deutsche Orden oder die Augustiner-Chorherren.
Kongregationen sind in der Regel jüngeren Datums. Sie haben sich prinzipiell einer ursprünglichen Ordensregel angeschlossen, jedoch eine eigene Ausprägung mit eigenen Satzungen entwickelt. Dies sind Gemeinschaften wie die Borromäerinnen oder die Spiritaner. Ihre Mitglieder legen keine feierlichen, sondern einfache Gelübde ab, was jedoch nur interne kirchenrechtliche Bedeutung hat. Oft sind diese Gemeinschaften international ausgerichtet wie etwa die Oblaten der makellosen Jungfrau Maria.
Die Gesellschaften apostolischen Lebens unterscheiden sich in ihrer Lebensweise kaum von einer Kongregation. Sie legen jedoch keine Gelübde ab, sondern ein Versprechen, was den Gelübden inhaltlich gleichkommt, kirchenrechtlich aber nicht die gleiche Bindung bewirkt. Die Mitglieder dieser Gemeinschaften legen nach einigen Jahren die endgültigen zeitlichen Versprechen ab. Typische Gesellschaften des Apostolischen Lebenssind die Vinzentinerinnen und die Pallottiner.
Zu den weiteren Formen des gemeinschaftlichen religiösen Lebens in der römisch-katholischen Kirche gehören die Säkularinstitute. In Säkularinstituten lebt jedes Mitglied allein und unerkannt in der Gesellschaft. Entsprechend diesem Grundsatz tragen die Mitglieder der Säkularinstitute auch keine äußeren Erkennungszeichen. Es handelt sich hierbei um eine Form der Vita consecrata, die nach dem zweiten Vatikanum entstand.
Die Mitglieder eines Ordens leben gemeinsam entweder in mehr oder weniger strenger Klausur, das heißt, abgeschieden von der Welt und im beständigen Wechsel von Gebet und Arbeit in der Stille. Man spricht dann von kontemplativen Orden. Oder aber sie nehmen aktiv am sozialen Leben teil, indem die unterschiedlichsten Berufe ausüben. Diese nennt man dann apostolische Orden. Ein Beispiel für eine apostolische Ordensgemeinschaft sind die Salvatorianer.
Streng klausurierte Orden sind zum Beispiel die Trappisten, die Kartäuser, die Klarissen und Karmelitinnen. Die Bezeichnung Nonne (weibliche Form von griechisch und lateinisch nonnus, Mönch) umfasst kirchenrechtlich nur die in sogenannter päpstli-cher Klausur lebenden Ordensfrauen monastischer Orden, die nicht klausurierten sind Ordensschwestern.
Ordensgemeinschaften haben ihre eigenen Bestimmungen für die Mitglieder, die sich nach langer Erfahrung mit dem Leben in Gemeinschaft zum Eremitentum berufen fühlen, sodass sie − mit Genehmigung − diesen Schritt unternehmen können, ohne ihre Zugehörigkeit zur Ordensgemeinschaft aufgeben zu müssen. Manche Nonnen und Ordensschwestern, in deren Orden dies nach altem Brauch üblich ist, empfangen bei der feierlichen Profess auch die Jungfrauenweihe. Für beide Fälle sind Can. 603 beziehungsweise Can. 604 des CIC nicht anwendbar, da diese kirchenrechtlichen Regelungen lediglich solche Eremiten und geweihte Jungfrauen betreffen, die in das geweihte Leben eintreten, ohne Mitglieder einer Ordensgemeinschaft zu sein oder zu werden.
Oblaten und Drittordensmitglieder Männer und Frauen können als sogenannte Oblaten an der Erfüllung der Aufgaben von Ordensgemeinschaften mitwirken und die spirituellen Impulse der Ordensgemeinschaft in die Welt hinaustragen, ohne in die Gemeinschaft einzutreten. Besonders bei den Orden, die nach der Benediktsregel leben, gibt es viele Oblaten, die nach einer Probezeit ihren Profess ablegen können. Andere Orden - etwa die Franziskaner, Karmeliten und Dominikaner haben einen Dritten Orden gegründet. In apostolischen Ordensgemeinschaften nimmt diese Stellung die so genannte Öffentliche Vereinigung von Gläubigen wahr, zum Beispiel im Rahmen der Don-Bosco-Familie die Salesianischen Mitarbeiter Don Boscos.
Ordensgemeinschaften in den Kirchen der Reformation
Die Reformatoren waren dem Ordenswesen gegenüber überwiegend ablehnend eingestellt, so dass es durch die Reformation zum Erliegen des Ordenslebens in den evangelischen Konfessionen kam. In den evangelischen Landeskirchen gibt es heute nur sehr wenige ordensähnliche Gemeinschaften. Nach der Reformation haben verschiedene evangelische Stifte die Tradition ihrer Klöster und Konvente in erneuerter Form fortgeführt.
Ordensgemeinschaften im eigentlichen Sinne waren sie aber nicht. Hier sind beispielsweise die Lüneklöster (Kloster Lüne, Kloster Wennigsen u.a.) zu nennen, die von der Klosterkammer Hannover verwaltet werden. Bis heute leben im 1529 reformierten Kloster Ebstorf evangelische Frauen unter der Leitung einer evangelischen Äbtissin. Eine Sonderstellung nimmt das Kloster Loccum ein, das 1585 evangelisch wurde und seitdem keinen residierenden Konvent, aber nach wie vor einen Abt und Konventualen hat.
Die Diakonissenhäuser boten und bieten Frauen einen Zusammenhalt und eine religiöse Lebensgemeinschaft, wie sie auch aus katholischen Ordensgemeinschaften mit stark karitativer und diakonischer Ausrichtung bekannt ist. Solche Gemeinschaften entstanden vornehmlich im 19. Jahrhundert.
Neugründungen, zumeist im 20. Jahrhundert, wie die Communität Casteller Ring und die Communität Christusbruderschaft Selbitz, führen die christliche Tradition des Ordenslebens heute auch in der Evangelischen Kirche weiter. Andere Gemeinschaften wie etwa die Michaelsbruderschaft haben sich zwar ordensähnliche Regeln gegeben, leben aber im Alltag nicht zusammen.
All diese Entwicklungen sind zumeist in den lutherisch geprägten Kirchen aufgekommen. Die reformierte Kirche kennt hingegen keine Ordensgemeinschaften und lehnt diese Lebensformweiterhin insgesamt ab. Auch pietistische und freikirchliche Gemeinschaften wie die Herrnhuter Brüdergemeine, die mitunter durchaus ein kloster- oder ordensähnliches Gemeinschaftsleben praktizieren, stehen ihrem Selbstbild zufolge grundsätzlich nicht in der Tradition der Ordensgemeinschaften.
Ritual
Ein Ritual (von lateinisch ritualis = „den Ritus betreffend“) ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein (z. B. Gottesdienst, Begrüßung, Hochzeit, Begräbnis, Aufnahmefeier usw.). Ein festgelegtes Zeremoniell (Ordnung) von Ritualen oder rituellen Handlungen bezeichnet man als Ritus.
Rituale sind ein allgemeines Phänomen der Interaktion mit der Umwelt. Sie finden sowohl auf der Ebene des individuellen Verhaltens (persönliche Rituale, autistische Rituale, Zwangshandlungen) als auch im menschlichen Miteinander (Rituale im Familienleben, geregelte Kommunikationsabläufe, Feste und gesellschaftliche Veranstaltungen, Gepflogenheiten und Konventionen, religiöse Riten und Zeremonien) statt.
Ein Ritual ist normalerweise kulturell eingebunden oder bedingt. Es bedient sich strukturierter Mittel, um die Bedeutung einer Handlung sichtbar oder nachvollziehbar zu machen oder über deren profane Alltagsbedeutung hinaus weisende Bedeutungs-oder Sinnzusammenhänge symbolisch darzustellen oder auf sie zu verweisen.
Indem Rituale auf vorgefertigte Handlungsabläufe und altbekannte Symbole zurückgreifen, vermitteln sie Halt und Orientierung. Das Ritual vereinfacht die Bewältigung komplexer lebensweltlicher Situationen, indem es „durch Repetition hochaufgeladene, krisenhafte Ereignisse in routinierte Abläufe überführt“. Auf diese Weise erleichtern Rituale den Umgang mit der Welt, das Treffen von Entscheidungen und die Kommunikation. Durch den gemeinschaftlichen Vollzug besitzen viele Rituale auch einheitsstiftenden und einbindenden Charakter und fördern den Gruppenzusammenhalt und die intersubjektive Verständigung.
Rituale dienen insbesondere auch der Rhythmisierung zeitlicher und sozialer Abläufe. So gibt es
• zyklische Rituale, die dem tageszeitlichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Kalender folgen (z. B. das Weckritual, die Sonnenwendfeier usw.);
• lebenszyklische Rituale, z. B. Initiationsrituale (bei Geburt, Mannbarkeit usw.);
• ereignisbezogene Rituale, die z. B. bei bestimmten Krisen Anwendung finden (z. B. der Tod, eine Hungersnot u. a. m.);
• Interaktionsrituale, die im Rahmen bestimmter Interaktionsmuster zum Tragen kommen, wie z. B. das Grußritual, Rituale des Körperabstandes oder das Ritual des Teetrinkens.
Rituale ermöglichen darüber hinaus die symbolische Auseinandersetzung mit Grundfragen der menschlichen Existenz, etwa dem Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Beziehung, dem Streben nach Sicherheit und Ordnung, dem Wissen um die eigene Sterblichkeit oder dem Glauben an eine transzendente Wirklichkeit (z. B. durch Freundschaftsrituale, Staatsrituale, Begräbnisrituale, Grabbeigaben). Derartige Rituale sind daher Ausdruck der Conditio humana, des menschlichen Selbstbewusstseins, der symbolischen Verfasstheit menschlichen Handelns und nach Auffassung einiger anthropologischer Denkereiner Art „Veranlagung“ (grob vereinfachend ausgedrückt) des Menschen zur Religiosität.
Manchmal verkehren sich ihre Wirkungen aber auch ins Negative, Rituale werden als abgegriffen, überholt, sinnentleert oderkontraproduktiv empfunden und einer Ritualkritik unterzogen.
Rituale, die nur von „Eingeweihten“ verstanden oder praktiziert werden können, können auch der Ausgrenzung oder Beherrschung „Unwissender“ dienen. Von derlei elitären oder geheimnisvollen Ritualen besonders stark geprägt sind magische Riten und Kulte oder Geheimlehren. Auch die in vielen Kulturen praktizierten schamanistischen Rituale, die der Anrufung oder Beschwörung der Geister von Tieren, Pflanzen oder Verstorbenen dienen sollen, sind in der Regel nur ausgewählten Schamanen oder Heilern bekannt.
Medizinisch relevant sind Rituale auch als Zwangshandlungen (Zwangsrituale), die im Zusammenhang mit Zwangsstörungen von den Betroffenen gegen ihren Willen praktiziert werden.
Das Menschenopfer und der Ritualmord sind Formen der rituellen Tötung eines Menschen.
Rituale sind häufig im Bereich der Religion verankert. Derartige Rituale fördern den Zusammenhalt religiöser Gruppen. So ergab die Auswertung von Daten über 83 US-amerikanische Religionsgemeinschaften aus dem 19. Jahrhundert, dass Reli-gionsgemeinschaften desto langlebiger sind, je stärker sie von Ritualen und festen Verhaltensregeln bestimmt sind. Für weltliche Gemeinschaften lässt sich ein solcher Zusammenhang angeblich nicht feststellen.
Katholischer Gottesdienst in Riga: Gottesdienstliche Vollzüge sind generell stark von Ritualen geprägt
Mit Ritualen beschäftigen sich eine Reihe von Sozialwissenschaften, unter anderen die Soziologie, die Psychologie, die Ethnologie, die Pädagogik und die Politikwissenschaften.
Soziologisch lassen sich Rituale in allen Gesellschaften beobachten. Beispielsweise ermöglichen Macht-, Unterwerfungs-oder Kampfrituale die Klärung oder Festigung sozialer Rangordnungen und vermeiden gleichzeitig verlustreiche physische Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe (vgl. Ritualisierung im Tierreich). Rituale sind einem ständigen Wandel unterworfen. Sie erneuern sich und treten in veränderter Gestalt in die gewandelte gesellschaftliche Wirklichkeit. So lassen sich etwa moderne soziale Rituale in gesellschaftlichen Kontexten wie dem Sport, dem Personenkult, der Jugendkultur und der Werbung erkennen.
Ethnologisch sind beobachtbare Rituale vielfach ein Einstieg in die Erforschung von Stammeskulturen.
Auch in der Psychotherapie spielt die Ritualisierung eine wichtige Rolle. Mit ihrer Hilfe sollen Ordnungen wiederhergestellt werden, wo sie nicht mehr als Struktur vorhanden sind. Auch die struktur- und bedeutungsstiftende Kraft von Ritualen für den sozialen Zusammenhalt von Gruppen soll im therapeutischen Raum nutzbar gemacht werden. Auf symbolische Weise wird der Kern der Gesamtproblematik herausgearbeitet. Rituale und symbolische Handlungen (z. B. eine Versöhnungsgeste) unterstützen den Therapieerfolg etwa in der Familientherapie und können einen bindungsverstärkenden Einfluss in der Paarbeziehung ausüben.
Zunehmend wird auch in der neueren Schulpädagogik, insbesondere in der Grundschule, bewusst mit Ritualen gearbeitet, um den Unterricht zu strukturieren und lebendiger zu machen. Auch früher waren Rituale im Schulalltag gang und gäbe (z. B. Aufstehen, wenn der Lehrer den Klassenraum betritt; Morgengebet).
Auch in der Politik spielen Rituale von jeher eine bedeutende Rolle. In jüngerer Zeit sind besonders die inszenierten Rituale der Weltanschauungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts aufgefallen: die Moskauer Paraden zum 1. Mai, der „Römische Gruß“ der italienischen Faschisten, die „Fahnenweihen“ der Nazis am 9. November u. a. m. Der US-amerikanische Politologe Murray Edelman (1919-2001) hat in seinem Werk Politik als Ritual den Standpunkt zur Geltung gebracht, dass auch moderne Demokratien Rituale zu propagandistischen Zwecken einsetzen. Er geht dabei insbesondere auf den „mythisierenden“ Gebrauch von Ritualen ein, d. h. den Ersatz eines eigentlich notwendigen oder verlangten politischen Handelns durch ritualisierte (Schein-)Maßnahmen und Debatten, die nur den Eindruck erwecken, dass etwas geschieht, obwohl die zugrundeliegenden Probleme in Wirklichkeit ungelöst bleiben. So können Wähler durch „bloß symbolische“ Rituale gewonnen oder überzeugt werden, auch wenn die tatsächliche Politik ihren Interessen rein sachlich betrachtet nicht oder zumindest nicht in demangenommenen Maße dient. Die starke Abhängigkeit politischen Handelns in demokratischen Systemen von der Öffentlichkeitswirkung begünstigt diese Entwicklung. Das „Ritual“ in Edelmans Definition wird auf diese Weise zu einer Art „Selbstzweck“ der Politik.
Tempelarbeit
Die Tempelarbeit oder Logenarbeit bezeichnet eine geschlossene rituelle Versammlung der Freimaurer. Der Begriff wurde, ebenso wie manche andere freimaurerische Eigenheiten, auch von den Mormonen für ihre nichtöffentlichen Tempelrituale übernommen.
Den Raum, in dem das im Folgenden skizzierte Ritual zelebriert wird, nennen Freimaurer in ihrer Symbolsprache „Tempel“ in Erinnerung an den Salomonischen Tempel. Hierbei handelt es sich um ein Sinnbild des „Tempels der Humanität“. In der frei-maurerischen Symbolsprache fügt sich der einzelne Bruder als „Stein“ in den Gesamtbau dieses „Tempels“ ein.
Das freimaurerische Ritual der Tempelarbeit verfolgt das Ziel einer freimaurerischen Sozialisation. Es vermittelt dem Einzelnen durch eine mündlich überlieferte Methode die freimaurerischen Werte durch Symbole und Allegorien, wobei Verstand und Gefühl gleichermaßen angesprochen werden. Der Freimaurer wird dabei nicht auf religiöse Inhalte oder metaphysische Glaubenssätze verpflichtet.
Das Ritual bestärkt Logenmitglieder, am einmal eingeschlagenen Weg der Menschlichkeit festzuhalten - analog zur aristotelischen Überlegung, dass der Mensch nicht allein durch intellektuelle Reflexion sich zum Besseren entwickle, sondern hierzu des Einübens bedarf. So wird das Verständnis gemeinsamer ethischer Werte bei jeder freimaurerischen „Tempelarbeit“ in Erinnerung gerufen. Gemeinsame Identität wird dadurch gestiftet, dass jeder, der nach reiflicher Selbstprüfung dem Bund der Freimaurer beitreten möchte, ein für alle gleiches Aufnahmeritual durchläuft.
Initiation eines Suchenden, Stich, 1745 in Frankreich
Die in den Tempelarbeiten vermittelten Werte sind nicht exklusiv. Es sind die allgemeinen Grundsätze der humanitären Tradition des Zeitalters der Aufklärung. Damit verbunden ist der emanzipatorische Anspruch, die Freiheit und Verantwortung des Individuums zu stärken.
„Niemand soll und wird es schauen, was einander wir vertraut, denn auf Schweigen und Vertrauen ist der Tempel aufgebaut.“ Goethe: Verschwiegenheit, „Wenn die Liebste...“,Gedicht einer Freimaurerversammlung 1815 in Weimar.
Das gegenseitige Vertrauen der Logenmitglieder ist ein wichtiger Grundsatz der Freimaurerei. Dieses kann jedoch nur dann wachsen, wenn sich jeder Bruder zur Diskretion verpflichtet. Vertrauliche Informationen der Privatsphäre anderer Mitgliedersollen nicht nach außen getragen werden.
Diese Gewissheit gilt als Grundvoraussetzung für einen freien Ideen- und Meinungsaustausch.
Das vom Freimaurer bei seiner Aufnahme geforderte Versprechen: „Verschwiegenheit zu bewahren über die inneren Angelegenheiten der Maurerei“ dient der Bewusstwerdung des moralischen Wertes, vertrauliche Informationen im Allgemeinen gewissenhaft zu bewahren und eingegangene Versprechen zuhalten.
Traditionellerweise wahren Freimaurer Stillschweigen überfreimaurerische Erkennungszeichen (Zeichen, Passwörter, Handgriffe) und detaillierte Formen und Inhalte der Rituale. Das persönliche Ritualerlebnis selbst wird als freimaurerisches „Geheimnis“ umschrieben. Die individuelle Erfahrung der tieferen Erkenntnis vom Sinn des Lebens, der Freiheit und des Todes, die im freimaurerischen Ritual symbolisiert wird, entzieht sich gewöhnlich der Sprache.
Ein weniger moralischer, aber dennoch unmittelbar einleuchtender Grund, Ritualinhalte nicht nach außen zu tragen, liegt darin, dass die Intensität des emotionalen Erlebens einer Aufnahme wesentlich geringer ausfallen würde, wenn der Ablauf dem Aufzunehmenden im Vornherein bekannt wäre. Trotzdem sind freimaurerische Rituale unzählige Male „verraten“ und veröffentlicht worden.
Getragen wird der Ablauf des Rituals durch ein festgelegtes Wechselgespräch des Meisters vom Stuhl mit dem Ersten und Zweiten Aufseher.
In kontinentaleuropäischen Logen gehört ein Vortrag des Redners über freimaurerische oder andere Themen zur Tempelarbeit (genannt Zeichnung).
Der Feierlichkeit des Ereignisse angemessen, tragen Freimaurer zur Logenarbeit eine bestimmte traditionelle Bekleidung. Diese besteht heute u.a. aus einem dunklen Anzug oder Smoking, dem Schmuckabzeichen der jeweiligen Loge: dem so genannten „Bijou“, dem symbolischen Maurerschurz, weißen Handschuhen und dem in manchen Logen noch üblichen sogenannten „hohen Hut“, einem Zylinder.
Ritualtexte aus den Anfängen der Freimaurerei sind nicht erhalten, eine Rekonstruktion der ursprünglichen Gebräuche ist daher schwierig. Die Rituale waren im Laufe der Zeit häufig Veränderungen unterworfen und sind in der Freimaurerei nicht einheitlich; sie gleichen sich aber grundsätzlich in ihrem Aufbau der drei Johannisgrade.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte sich mit der sogenannten „Strikten Observanz“ ein komplexes System von hierarchischen Abstufungen in der europäischen Freimaurereietabliert. Zu Beginn der 1780er Jahre begann eine Gegenbewegung einzusetzen, die sich wieder auf das alte Ritual der drei Grade (Lehrling – Geselle – Meister) besann.
In diesem Reformprozess forderte Georg Heinrich Sieveking darüber hinaus die Abschaffung der „Hieroglyphen und Symbole“ und bezeichnete diese und die Gebräuche als Farce. Friedrich Ludwig Schröder antwortete darauf mit seiner Rede über „Sittlichkeit und Gefälligkeit als Urstoff der Freundschaft sowie über unsere Bilderzeichen und Geheimnisse“ in seiner Loge Emanuel. Darin setzte er diese Forderung mit der Auflösung der Freimaurerei gleich und zeigte deren Relevanz für die große Bruderkette auf. Dies führte zu Rededuellen zwischen beiden und resultierte schließlich darin, dass Sieveking am 10.April 1790 sein Amt als Meister vom Stuhl niederlegte und sein bisheriges Engagement in der Freimaurerei aufgab.
Unter Berücksichtigung altenglischer Ritualtexte machte man sich im 18. Jh. daran, freimaurerische Rituale in ihrem vermuteten Ursprungssinn zu rekonstruieren. Hierbei kommt Friedrich Ludwig Schröder besonderes Verdienst zu. Als historischer Au-todidakt sammelte er Materialien zur Geschichte der Freimaurerei seit ihrer Entstehung bis 1723, die er im Jahr 1815 veröffentlichte. Aufgrund dieser Studien schuf er in Zusammenarbeit mit Johann Gottfried Herder deutsche Rituale für die drei Grade, die noch heute als Schrödersche Lehrart in Gebrauch sind und sich durch ihre schlichte Klarheit und rituelle Dynamik auszeichnen.
Anm.: Zur Gesellschaft der Freimaurer s. das Hauptkapitel
Arkanprinzip
Das Arkanprinzip (von lateinisch arcanum – „Geheimnis“) ist der Grundsatz, Kultbräuche und Rituale nur einem Kreis von Eingeweihten zugänglich zu machen und sie vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.
Bereits in vorchristlicher Zeit existierte in Mysterienkulten eine Verpflichtung, Kultgebräuche geheim zu halten. Diese Tradition wurde vom Christentum übernommen. So wurden in der Spätantike vor Ungetauften die Taufe und das Taufbekenntnis, der Brauch des Abendmahls und das Vaterunser geheim gehalten. Es gab aber keine allgemein anerkannte Festlegung des Umfangs der Geheimhaltungspflicht, und von Strafbestimmungen für den Fall einer Übertretung ist nichts bekannt.
Unter Arkandisziplin versteht man eine förmliche Verpflichtung des in ein religiöses Geheimnis Eingeweihten, dieses zu wahren. Der Begriff wurde in der Neuzeit geprägt. Er stammt von dem französischen reformierten Theologen Jean Daillé (Dallaeus), der in seiner Schrift De usu patrum ad ea definienda religionis capita, quac sunt hodie controversa (Genf 1656) von einer disciplina arcani schrieb, die im Christentum vor dem 4.Jahrhundert unbekannt gewesen sei. Daillé wandte sich in seiner Abhandlung gegen die katholische Tradition, die den Kirchenvätern in Fragen des Glaubens und des Kultes Autorität zubilligte. In den damaligen Auseinandersetzungen zwischenreformierten und katholischen Theologen spielte die Frage einer geheimen, nur mündlich weitergegebenen Tradition der Kirchenväter eine Rolle; Katholiken rechtfertigten die Geheimhaltung, der reformierte Gelehrte Isaac Casaubon führte sie auf den Einfluss heidnischer Mysterienkulte zurück.
Der bis dahin in der Öffentlichkeit ungebräuchliche Ausdruck „Arkan-Disziplin“ wurde erstmals 1962 von Jürgen Habermas abwertend auf die Geheimhaltungspraktiken der öffentlichen Verwaltung angewandt und ist heute als polemischer Begriff in der politischen Auseinandersetzung um die Schaffung bzw. Erweiterung von Informationsfreiheitsgesetzen in Gebrauch.
Theodizee
Theodizee heißt „Rechtfertigung Gottes“. Das Theodizeeproblem ist ein klassisches philosophisches und theologisches Problem für diejenigen religiösen Traditionen, die von der Existenz eines allmächtigen, allgütigen und allwissenden Gottesausgehen. Es besteht in der Frage, wie die Existenz eines solchen Gottes mit der Existenz des Übels oder des Bösen in der Welt vereinbar sei.
Der Begriff selbst geht auf den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz zurück, der 1710 in seinem Werk Essais de Théodicéesur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal nachzuweisen versuchte, dass diese Welt „die beste aller möglichen Welten“ sei und deshalb die Existenz des Übels in der Welt nicht der Güte Gottes widerspreche. Eine weithin bekannte Antwort auf diese These ist Voltaires satirischer Roman Candide oder der Optimismus.
Angesprochen wird die Thematik schon im Buch Ijob (Hiob) im Alten Testament. Im antiken Griechenland wurde sie von skeptischen Philosophen erörtert. Das Buch Ijob geht dabei von einem aktiven Eingreifen Gottes in das Weltgeschehen aus, während die griechischen Skeptiker als Vertreter des Agnostizismus die Idee einer göttlichen Lenkung und Prädestination bezweifelten.
Das Problem
Eine prägnante, oft zitierte Formulierung des Problems lautet:
• Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht:
• Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft,
• Oder er kann es und will es nicht:
• Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist,
• Oder er will es nicht und kann es nicht:
• Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott,
• Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt:
• Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg?
Diese Argumentation wurde von dem Kirchenschriftsteller Laktanz (ca. 250 bis nach 317) überliefert, der sie dem Philosophen Epikur zuschrieb, allerdings zu Unrecht, denn sie ist nichtepikureisch, sondern stammt von einem unbekannten skeptischen Philosophen. Der Skeptiker Sextus Empiricus hat im 2. Jahrhundert n. Chr. in seinen Pyrrhoneischen Hypotyposen(3.3.9-12) dieselbe Überlegung in einer etwas ausführlicheren Version dargelegt.
Das Theodizeeproblem besteht wegen des Widerspruchs zwischen zwei Aussagen: einerseits diejenige, es gebe einen allmächtigen, allgütigen und allwissenden Gott, andererseits diejenige, das Übel bzw. Böse in der Welt existiere real. Lösungen des Problems werden auf zweierlei Weise gesucht: Der Widerspruch wird aufgelöst, indem die eine oder die andere der beiden Aussagen eingeschränkt oder ganz fallen gelassen wird, oder indem man erklärt, wie an beiden Aussagen festgehaltenwerden kann. Es gibt im Wesentlichen folgende Lösungsansätze:
Bestimmung des Übels
Schon der frühe christliche Kirchenlehrer und Philosoph Augustinus und später mittelalterliche Denker wie Thomas von Aquin begründeten die Auffassung, das Übel habe kein eigenständiges Sein, sondern sei nur Mangel an Sein bzw. Mangel am Guten (privatio boni). Thomas nannte als Beispiel die Blindheit, die Entbehrung des Augenlichtes sei. Diese philosophische Position geht demnach von einem realen Mangel aus – im Gegensatz zu jener, die behauptet, das Leid bzw. das Übel sei für den davon betroffenen nicht real.
Die Privationstheorie hat eine „außerordentliche Erfolgsgeschichte“ hinter sich, schreibt der zeitgenössische Theologe Friedrich Hermanni. Vom 2. bis in das 17. Jahrhundert hinein sei sie in fast allen philosophischen Systemen unumstritten gewesen – zwischen den Kirchenvätern und den spätantiken Philosophen, zwischen Aristotelikern und Platonikern, zwischen Thomisten und Scotisten, zwischen Reformatoren wie Philipp Melanchthon und römisch katholischen Dogmatikern wie Robert Bellarmin sei dies ein Punkt gewesen, in dem man sich einig war.
Im 17. Jahrhundert und bei einigen sogenannten Nominalisten im Universalienstreit bereits im 14. Jahrhundert, wurde das Leiden hingegen als ein Seiendes – eine auf empirischen Feststellungen beruhende Tatsache – betrachtet. Daher komme dem Übel auch eine eigene Realität zu.
Weiterhin wurde vorgebracht, dass auch ein bloßer Mangel an Gutem, der zu Leidführt, nicht mit der Allmacht und Allgüte Gottes zu vereinbaren sei.
Laut jüdisch-mystischer Sohar-Auslegung des Buches Genesis hat Gott vor der Schöpfung unserer Welt andere Welten erschaffen und wegen ihrer Unvollkommenheit wieder zerstört(soweit herrscht Übereinstimmung mit der Interpretation des Midrasch). Die Reste dieser Welten haben sich laut Sohar als „Hülsen“ (heb. qlipot) erhalten, die fortdauern und das Böse in der Welt verursachen (die „andere Seite“, heb. sitra achra). Da aber auch sie ursprünglich von Gott erschaffen wurden, enthalten sie noch „Funken von Heiligkeit“ (heb. nizzozot schelqduschah).