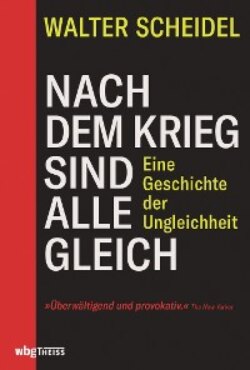Читать книгу Nach dem Krieg sind alle gleich - Walter Scheidel - Страница 12
KAPITEL 2 Imperien der Ungleichheit
ОглавлениеDie Entegalisierung hatte viele Väter. Das Wesen der produktiven Vermögenswerte und die Art ihrer Weitergabe von Generation zu Generation, die Höhe des über das Subsistenzniveau hinausgehenden Überschusses und die relative Bedeutung der wirtschaftlichen Aktivitäten sowie das Arbeitskräfteangebot und die Nachfrage nach Arbeitern hatten komplexe und wechselnde Auswirkungen auf die Verteilung der materiellen Ressourcen. Die Institutionen, die dieses Wechselspiel vermittelten, waren sehr empfänglich für die Ausübung politischer und militärischer Macht, für Druck und für Erschütterungen, die letzten Endes in der Fähigkeit zur Mobilisierung und Anwendung von Gewalt wurzelten. Auf der Landwirtschaft beruhende Großreiche, die über viele Generationen hinweg Bestand hatten, durch stabile und steile Hierarchien gekennzeichnet und (gemessen an vorindustriellen Standards) in Bezug auf wichtige Indikatoren der gesellschaftlichen Entwicklung wie Energiegewinnung, Urbanisierung, Informationsverarbeitung und militärische Leistungsfähigkeit sehr reif waren, liefern die besten Einblicke in die Dynamik der Ungleichheit in Umgebungen, die relativ gut gegen große gewaltsame Störungen abgeschirmt sind. Diesbezüglich sind sie am ehesten mit der westlichen Welt des vergleichsweise friedlichen 19. Jahrhunderts vergleichbar, einer Phase beispielloser wirtschaftlicher und kultureller Umwälzungen. Wie wir sehen werden, entwickelten sich die Einkommens- und Vermögensungleichheit in den alten Großreichen und in den Gesellschaften, die die Industrialisierung durchliefen, sehr ähnlich. Zivilisationen, die durch anderthalb Jahrtausende oder noch längere Zeiträume getrennt waren und, abgesehen von Ordnung, Stabilität und einer gesicherten Entwicklung, wenig gemein hatten, zeichneten sich allesamt durch eine dramatische Ungleichverteilung der materiellen Ressourcen aus. Zu allen Zeiten und in unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstadien ist das Ausbleiben gewaltsamer Umwälzungen eine unverzichtbare Voraussetzung für eine ausgeprägte Ungleichheit gewesen.1
Ich werde diese Hypothese anhand von zwei Fallbeispielen belegen. Dies sind China unter der Han-Dynastie und das Römische Reich, zwei Großreiche, die auf dem Höhepunkt ihrer Macht jeweils ein Viertel der Menschheit beheimateten. Das Römische Reich ist auch als Reich des Eigentums bezeichnet worden, in dem Reichtum vor allem durch den Erwerb von Land geschaffen wurde, während die Vermögen in China unter der Han-Dynastie eher durch Ämter als durch private Investitionen aufgebaut wurden. Dieser Gegensatz scheint überzeichnet: In beiden Umgebungen war politische Macht eine wichtige Quelle für Einkommen und Vermögen: Sie war untrennbar mit den wirtschaftlichen Aktivitäten verknüpft und trug wesentlich zur materiellen Ungleichheit bei.2
Das alte China
Die Han-Dynastie folgte auf die kurzlebige Qin-Dynastie, der es gelungen war, die »Streitenden Reiche« zu einen. Die Herrschaft der Han dauerte mehr als vier Jahrhunderte (von 206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) und gibt umfassenden Aufschluss über die Dynamik der Einkommens- und Vermögenskonzentration in einem weitgehend stabilen Weltreich: über den Kampf zwischen Herrschern und Eliten um Grundbesitz, Kontrolle über die Produktionsüberschüsse und ländliche Arbeitskräfte sowie über die wirtschaftlichen und politischen Kräfte, die große Vermögen schufen und vernichteten. Die Kommerzialisierung der Landwirtschaft war ein Faktor: Aus einem Bericht über die Regierungszeit des fünften Han-Kaisers Wendi (180–157 v. Chr.) geht hervor, dass Kleinbauern, die zur Aufnahme hochverzinster Kredite gezwungen waren, ihr Land an Händler und Wucherer verloren (und manchmal sogar ihre Kinder als Sklaven verkaufen mussten). Die Nutznießer erwarben große Güter, die sie mithilfe von Pächtern, Tagelöhnern oder Sklaven bewirtschafteten.3
Den Herrschern, die bemüht waren, die Kleinbauern als Steuerzahler und Aushebungsreservoir für ihre Armeen zu erhalten, fiel es schwer, dem Druck der Elite standzuhalten. Zwischen 140 v. Chr. und 2 n. Chr. wurde elfmal Staatsland unter der Bauernschaft verteilt. Die Angehörigen der regionalen Eliten wurden angehalten, in die Region der Hauptstadt zu ziehen, und zwar nicht nur, um ihre politische Loyalität zu gewährleisten, sondern auch, um ihre Macht auf lokaler Ebene zu beschränken. Als diese Praxis wieder aufgegeben wurde, fiel es den Reichen und gut Positionierten noch leichter, Vermögen anzuhäufen, indem sie Land kauften oder besetzten und die Armen unterdrückten. Nachdem sich die Elite über Generationen hinweg immer mehr Besitz angeeignet hatte, schlugen die Berater des Kaisers im Jahr 7 v. Chr. schließlich gesetzliche Beschränkungen vor, um der zunehmenden Konzentration des Grundeigentums einen Riegel vorzuschieben. Doch die Versuche, eine Obergrenze für den Grundbesitz und für die Anzahl der Sklaven festzulegen und übermäßige Vermögen zu beschlagnahmen, wurden von mächtigen Interessengruppen unterbunden. Kurze Zeit später fasste der Usurpator Wang Mang (9–23 n. Chr.) energischere Eingriffe ins Auge. Spätere Quellen, die ihm feindlich gesinnt waren, schreiben ihm verschiedene große Vorhaben zu, die von der Verstaatlichung von Land bis zur Beendigung des Sklavenhandels reichten. Die Haushalte sollten ihren gesamten Grund ab einer bestimmten Fläche an Verwandte und Nachbarn abtreten. Gestützt auf mutmaßliche archaische Traditionen der periodischen Umverteilung (die als »Brunnenfeldsystem« bezeichnet werden), wurde der Grundbesitz immer wieder angepasst, um gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Der Verkauf von Grundstücken, Häusern und Sklaven wurde unter Androhung der Todesstrafe verboten. Es überrascht nicht, dass diese Regelungen – soweit sie tatsächlich angewandt und nicht nur von der späteren Han-Propaganda erfunden oder ausgeschmückt wurden – nicht durchzusetzen waren und bald wieder aufgegeben wurden. Das neue Regime brach nach kurzer Zeit zusammen und die Han kehrten mit Unterstützung der Grundherren an die Macht zurück.4
Die Quellen aus der Han-Zeit schreiben den Vermögenserwerb durch Marktaktivitäten Kaufleuten zu, einer Klasse, die bei den politisch gut vernetzten Literaten, von denen die erhaltenen Texte stammen, nur Verachtung weckte. Der Historiker Sima Qian beschrieb die reichen Kaufleute als eine Klasse, die »die Dienste der Armen in Anspruch nimmt«, und die größten Vermögen, die den Händlern zugeschrieben wurden, konnten sich mit denen der hochrangigen kaiserlichen Beamten messen. Die kaiserlichen Behörden reagierten und nahmen die durch Handel erworbenen Privatvermögen ins Visier: Kaufleute mussten höhere Steuern entrichten als Angehörige anderer Berufsgruppen. Unter Kaiser Wudi, der in den Jahren 140 bis 130 v. Chr. mit kostspieligen militärischen Mobilisierungsprogrammen versuchte, die Expansion des Reichs der Xiongnu in der nördlichen Steppe zu bremsen, wurden die Steuern sehr viel aggressiver eingetrieben. Wudi führte Staatsmonopole auf Salz und Eisen ein. Auf diese Art sicherte er sich nicht nur Gewinne, die bis dahin von Privatunternehmern eingestrichen worden waren, sondern schützte auch die Kleinbauern, die der Staat als Soldaten und Steuerzahler brauchte, vor der Verdrängung durch Besitzer von Handelskapital, die in Grundbesitz investieren wollten. Seine Regierung erhob Steuern auf gewerbliche Liegenschaften und angeblich wurden zahlreiche große Vermögen ausgelöscht. Es bestätigt die zentrale These dieses Buches, dass diese nivellierenden Maßnahmen eng mit der Massenmobilisierung für kriegerische Unternehmungen verbunden waren, aber wieder aufgegeben wurden, als die Konflikte abebbten.5
Die Maßnahmen gegen die Konzentration des gewerblichen Kapitals und seine entegalisierenden sozialen Konsequenzen waren letzten Endes nicht von Erfolg gekrönt, was nicht nur an der intermittierenden Durchsetzung dieser Politik, sondern vor allem daran lag, dass die Händler ihre Gewinne in Grundbesitz investierten, um sie gegen staatliche Forderungen abzusichern. Aus Sima Qians historischem Werk Shiji geht hervor, dass ihre Strategie darin bestand,
durch zweitrangige Tätigkeiten [z.B. Handel] Reichtümer anzuhäufen und diese durch eine grundlegende Tätigkeit [d.h. die Landwirtschaft] zu bewahren.
Verbote konnten das nicht verhindern: Es war nicht möglich, Händler am Kauf von Land zu hindern, und es gelang ihnen, Verbote zum Eintritt in die Verwaltung zu umgehen. Einige reiche Unternehmer oder ihre Verwandten stiegen sogar in den Adelsrang auf.6
Neben wirtschaftlichen Aktivitäten waren der Staatsdienst und allgemein die Nähe zum politischen Machtzentrum die wichtigsten Quellen großen Reichtums. Hochrangige Amtsträger profitierten von kaiserlichen Geschenken und Lehen. Lehnsnehmer durften einen Teil der Kopfsteuern behalten, die die ihnen zugeteilten Haushalte zu entrichten hatten. Durch Günstlingswirtschaft und Korruption entstanden große Vermögen: Von einigen Kanzlern und anderen sehr hochrangigen Amtsträgern heißt es, sie hätten Vermögen angehäuft, die zu den größten in der Geschichte zählten. In der Spätphase der Östlichen Han-Dynastie schlug sich die Einträglichkeit hoher Ämter in den Preisen nieder, zu denen man sie erwerben konnte. Großzügige rechtliche Privilegien schützten korrupte Beamte. Ab einer bestimmten Gehaltsstufe durften Beamte nur noch mit Einwilligung des Kaisers verhaftet werden und sie waren vor Gerichtsurteilen und Strafen geschützt.7
Abgesehen davon, dass sie ihren neuen Reichtum in rechtmäßige wirtschaftliche Aktivitäten investieren konnten, fiel es den gut Vernetzten auch leicht, das einfache Volk zu bedrängen und auszubeuten. Beamte missbrauchten ihre Befugnisse, um öffentliches Land zu besetzen oder anderen wegzunehmen. Die Quellen deuten auf die allgemeine Einschätzung hin, dass politische Macht gleichbedeutend mit bleibendem materiellem Reichtum in Form von Grundbesitz war, der vom Staat gewährt oder durch Einflussnahme und Zwang erlangt wurde. Im Lauf der Zeit schufen diese Prozesse eine Elite von Adligen, Beamten und Günstlingen, die Koalitionen schmiedeten und untereinander heirateten. Die Reichen übten entweder selbst Ämter aus oder waren mit Amtsträgern verbunden und der Staatsdienst sowie Verbindungen zu Staatsdienern ermöglichten den Aufbau eines persönlichen Vermögens.8
Dies begünstigte die Erhaltung familiären Reichtums und beschränkte sie zugleich. Auf der einen Seite war die Wahrscheinlichkeit groß, dass Söhne hochrangiger Amtsträger in die Fußstapfen ihrer Väter traten. Sie und andere jüngere Verwandte hatten einen automatischen Anspruch auf Aufnahme in den Staatsdienst und profitierten unverhältnismäßig von einem System, in dem staatliche Ämter aufgrund von Empfehlungen vergeben wurden. Es gab Beamte, die sechs oder sieben Brüder und Söhne – in einem Fall nicht weniger als dreizehn Söhne – in der kaiserlichen Verwaltung unterbrachten. Auf der anderen Seite untergrub dieselbe räuberische und willkürliche Ausübung politischer Macht, die aus Staatsdienern Plutokraten machte, auch deren Erfolg. Guan Fu, ein hochrangiger Regierungsbeamter, hatte ein großes Vermögen angehäuft und besaß in seiner Heimatregion derart viel Land, dass er wegen seiner herausragenden Stellung allgemeinem Hass ausgesetzt war und sogar Thema eines Kinderliedes wurde:
Solange der Fluss Ying klar ist, wird die Familie Guan sicher sein; wenn der Ying schlammig wird, wird die Familie Guan ausgerottet werden!
Dieses Liedchen verrät uns einiges darüber, wie unsicher die Position der politisch Begünstigten war: Familien, die einen besonders steilen Aufstieg hinter sich hatten, stürzten in der Mehrheit der Fälle besonders tief. Diese Gefahr bestand sogar an der Spitze der Statuspyramide: Auch die Familien der Gemahlinnen der Han-Kaiser waren bedroht.9
Auf allen Ebenen der Elite kam es zu systematischen Säuberungen. Der Gründer der Han-Dynastie hatte 165 Gefolgsleute in den Adelsstand erhoben und mit Einkommen aus Lehen belohnt. Die Familien dieser Glücklichen sicherten sich ein Monopol auf hohe Staatsämter und häuften beträchtliches Grundeigentum an. Unter Wudi wurden die meisten dieser Familien ihrer Titel wie Ländereien beraubt und dabei wurde so gründlich vorgegangen, dass zu der Zeit, als sein Urenkel Xuandi an die Macht kam,
die Abkömmlinge der ruhmreichsten und verdienstvollsten Generäle als Tagelöhner arbeiteten und andere untergeordnete Tätigkeiten ausübten.
Die oberste Schicht der Elite der frühen Han-Zeit konnte ihren Status also nur ein gutes Jahrhundert verteidigen und wurde gemeinsam mit den Überbleibseln der Herrscherhäuser der Streitenden Reiche beseitigt. Neue Günstlinge nahmen ihren Platz ein. Ein Jahrhundert später tat der Usurpator Wang Mang alles, um ihre Nachkommen zu entmachten und ihres Eigentums zu berauben – seine Anhänger wurden wiederum von den Gefolgsleuten der Östlichen Han-Dynastie verdrängt. Das Ergebnis der zahlreichen Umwälzungen war, dass im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nur noch einige wenige adlige Familien aus der Zeit der Westlichen Han-Dynastie übrig waren.10
Gewaltsame Tode und Enteignung von Staatsdienern waren an der Tagesordnung. Zahlreiche hohe Amtsträger wurden hingerichtet oder in den Selbstmord getrieben. Die Biografien in den historischen Darstellungen Shij und Hanshu enthalten gesonderte Abschnitte über »strenge Beamte«, die im Auftrag ihrer Kaiser Angehörige der herrschenden Elite verfolgten. Viele von denen, die in ihr Visier gerieten, verloren das Leben und manchmal wurden ganze Familien ausgerottet. Auch Fehden zwischen verschiedenen Segmenten der Klasse der Staatsdiener führten zu großen Fluktuationen und zu einem Vermögenstransfer. Innerhalb der Elite verwandelte die ständige Umwälzung das Streben nach Macht und Reichtum in ein Nullsummenspiel: Damit einer gewinnen konnte, musste ein anderer verlieren. Die Dynamik von gewaltsamer Vermögensaneignung und -neuverteilung setzte der Konzentration des Reichtums Grenzen: Jedes Mal, wenn sich eine bestimmte Familie oder Gruppe zu deutlich von den übrigen abhob, wurde sie zurechtgestutzt und durch Rivalen ersetzt.11
Aber obwohl diese Mechanismen die Entstehung einiger weniger superreicher Familien verhinderten, die ihre Stellung in den staatlichen Strukturen hätten verteidigen und ihr Vermögen langfristig hätten erhöhen können, konnte die Vermögens-und-Macht-Elite in ihrer Gesamtheit offenbar ihre Position auf Kosten der breiten Masse der Bevölkerung verbessern. Die invasiven staatlichen Eingriffe ließen im Lauf der Zeit nach und der Aufstieg der Östlichen Han-Dynastie bereitete den Boden für eine Zunahme der Ungleichheit. Die Anzahl der Haushalte, die Lehnsnehmer der zwanzig Unterkönige der Han waren (diese waren enge Verwandte der Herrscher), wuchs zwischen dem Jahr 2 und dem Jahr 140 von 1,35 Millionen auf 1,9 Millionen, was elf beziehungsweise 20 Prozent aller im kaiserlichen Zensus registrierten Haushalte entsprach. Obwohl gewaltsam ausgetragene Fraktionskonflikte weiterhin Menschenleben und Familienvermögen zerstörten und obwohl ganze Clans ermordet oder ins Exil gezwungen wurden, kam die neue Ordnung der Klasse der Vermögenden als solcher zugute. Die Großgrundbesitzerfamilien, die entscheidend zur Rückkehr der Han an die Macht beigetragen hatten, brachten mehr und mehr Land unter ihre Kontrolle und ordneten sich die Bauern mittels Schulden unter. In Quellen aus dieser Zeit wird die Praxis der Elite beschrieben, die Zensuszahlen zu fälschen, um steuerpflichtiges Vermögen zu verbergen. Die Verringerung der registrierten Haushalte von mehr als zwölf Millionen auf weniger als zehn Millionen zwischen dem Jahr 2 und dem Jahr 140 (das heißt zu einer Zeit, in der die Besiedlungsdichte in den südlichen Randgebieten des Reichs zunahm) ist zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass die Grundherren ihren Verpflichtungen immer weniger nachkamen, freie Bauern in landlose Pächter umwandelten und sie gegen die staatlichen Beauftragten abschirmten.12
Die Tatsache, dass der Aufstieg in hohe Positionen als etwas Außergewöhnliches galt, deutet darauf hin, dass unter der Östlichen Han-Dynastie eine stabilere Elite entstand. Diese Abschottung der herrschenden Klasse kommt in einer wachsenden Anzahl von Fällen zum Ausdruck, in denen Familien über nicht weniger als sechs oder sieben Generationen hinweg hochrangige Staatsdiener hervorbrachten, was zur Folge hatte, dass einige wenige Familien langfristig im Staatsdienst überrepräsentiert waren. Trotz anhaltender interner Auseinandersetzungen und einer stetigen Zirkulation in der Elite war ein Trend hin zu einer dauerhafteren Macht- und Vermögenskonzentration zu beobachten. Dieser Prozess ging mit der Entstehung einer Elite einher, die dank ihres wachsenden Zusammenhalts weniger abhängig von Ämtern war. Die Privatisierung des Reichtums hatte ein Ausmaß erreicht, das größeren Schutz gegen räuberische Eingriffe bot, während die schwindende Macht des Staates die Bedeutung des Zugangs zu Positionen in der staatlichen Hierarchie verringerte. Gleichzeitig traten die Gegensätze zwischen Grundherren und Pächtern in den Vordergrund, als sich diese gezwungen sahen, sich den Grundbesitzern über ihre bloßen vertraglichen Verpflichtungen hinaus unterzuordnen. Als sich der Staat des Kaiserreichs auflöste, verwandelten sich die Pächter in Bedienstete der mächtigen lokalen Grundherren. Die Abhängigkeit der Bauern führte zu Klientelismus, der den Aufbau von Privatarmeen ermöglichte. Im 3. Jahrhundert waren die Magnaten weitgehend unangreifbar.13
Im Han-Reich entstand eine Elite von Regierungsbeamten, Grundherren und gewerblichen Investoren, Gruppen, deren Mitgliedschaft sich vielfach überschnitt und die untereinander und mit anderen um die Ressourcen kämpften. Langfristig bestand die wesentliche Entwicklung in einer zunehmenden Konzentration des Grundbesitzes, während der Staat die Kontrolle über die Subsistenzproduzenten verlor und die wirtschaftlichen Renten die Steuereinnahmen verdrängten. Prominente Familien wurden im Lauf der Zeit mächtiger. Die Beziehung zwischen Herrschern und Eliten änderte sich: Die zentralisierte militärische Führung unter der Quin-Dynastie wich einer Politik des Ausgleichs unter der Han-Dynastie, die von sporadischen aggressiven Interventionen des Herrscherhauses unterbrochen wurde. Die Restauration unter den Han verschob das Machtgleichgewicht weiter zugunsten der vermögenden Elite. Und die Entwicklung der Ungleichheit wurde von zwei Faktoren geprägt: von einer ausgedehnten Friedenszeit, die die Vermögenskonzentration auf Kosten der Kleinbauern und schließlich sogar der Zentralgewalt ermöglichte, und von einer räuberischen Zirkulation der Gewinne der Mitglieder der Elite. Der erste Faktor erhöhte die Ungleichheit, während der zweite ihre Zunahme verlangsamte. Doch in der zweiten Hälfte der Östlichen Han-Periode und in den anschließenden Königreichen des 3. Jahrhunderts setzte sich die Vermögenskonzentration fest.
Die Entwicklungen in der Han-Zeit waren lediglich die erste Manifestation dessen, was zum entscheidenden Merkmal in der Geschichte der Ungleichheit in China werden sollte. Die gewaltsamen Verwerfungen, die die Hauptdynastien trennten, verringerten die wirtschaftliche Ungleichheit. Die neuen Regime ergriffen Maßnahmen zur Umverteilung des Landes, doch auf die Nivellierung folgte im Allgemeinen eine erneute Konzentration des Grundbesitzes, beispielsweise unter den Dynastien der Sui (ab 581), der Tang (ab 618), der Song (ab 960) und der Ming (ab 1368). Jede neue Dynastie schuf neue Eliten von Gefolgsleuten, die politischen Einfluss zur persönlichen Bereicherung nutzten. Am Ende der Tang-Zeit wurde eine tief verwurzelte Aristokratie zerschlagen (mit dieser Entwicklung befasse ich mich in Kapitel 9). Einer kleinen Anzahl herausragender Familien gelang es, sich zwei oder drei Jahrhunderte an der Macht zu halten, einen privilegierten Zugang zu hohen Ämtern zu verteidigen und gewaltige Vermögen anzuhäufen. Adlige, Beamte und Inhaber offizieller Dienstgrade waren normalerweise von Steuern und Arbeitsdiensten befreit, was die Ressourcenkonzentration in ihren Händen zusätzlich beschleunigte. Einmal mehr wuchs der private Grundbesitz auf Kosten des Staatslandes; einmal mehr ließen die Grundherren die von ihnen kontrollierten Bauern aus den Steuerregistern verschwinden.
Nach der drastischen Zerstörung dieser Klasse begann unter den Song der Aufstieg einer vollkommen neuen Elite. Durch Schenkungen der Herrscher entstanden große Ländereien und spätere Versuche, die Kleinbauern mit billigen Staatskrediten auszustatten, verliefen rasch im Sand. Unter der Südlichen Song-Dynastie breiteten sich die Konzentration des Grundbesitzes sowie der Klientelismus aus und ein verspäteter Versuch zur Beschränkung der Größe von Landgütern stieß auf erheblichen Widerstand der Elite. Auch die mongolischen Invasoren belohnten ihre Anführer mit großen Landschenkungen und führten ein Pachtsystem für ihre Soldaten ein. Nachdem die Ming die mongolischen Grundherren und Beamten vertrieben hatten, verteilte der Gründer der neuen Dynastie, der Hongwu-Kaiser, große Ländereien unter seinen Gefolgsleuten, die sodann den neuen Adel bildeten; spätere Versuche des Kaisers und seiner Nachfolger, die Schenkungen einzugrenzen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil: Der Grundbesitz der Elite wuchs dank der Nachgiebigkeit des Kaiserhauses, dank Käufen, erzwungener Aneignung und Kommendation (mit der Bauern ihr Land an reiche Grundherren abtraten, um der Besteuerung zu entgehen). In einer Quelle aus dem 16. Jahrhundert wird die Entwicklung kurz und bündig zusammengefasst:
Südlich des Jangtse sind Arme und Reiche aufeinander angewiesen und die Schwachen übergeben alle ihr Land.
Fälschungen des Zensus verbargen den wahren Umfang der Besitztümer der Elite. Einmal mehr ebneten Ämter den Weg zum Reichtum. Im Kommentar zum Ming-Kodex heißt es unverblümt:
Es ist zu befürchten, dass viele verdienstvolle Amtsträger ihre Macht nutzen werden, um sich Felder und Herrenhäuser in großem Umfang anzueignen und von der Bevölkerung Besitz zu ergreifen.
Die Vorgänge waren in mancher Hinsicht eine Wiederholung von Entwicklungen, die bis in die Zeit der Östlichen Han-Dynastie zurückverfolgt werden können, die 1500 Jahre früher herrschte:
Am Ende der Ming-Periode hatte sich der Landadel zahlreiche Knechte angeeignet, die er als erbliche Untertanen hielt. Es gab fast keine freien Bauern mehr. Aber wann immer die Macht des Grundherrn schwand, befreiten sich die Bauern und gingen fort. Manchmal wurden sie sogar rebellisch und nahmen die Felder ihres Herrn in Besitz, beschlagnahmten sein Eigentum und stellten sich in den Dienst einer anderen Person, die in das Machtvakuum vorgestoßen war. Die ursprünglich mächtige Familie zog vor Gericht, aber die Behörden richteten sich ausschließlich danach, wer der Stärkere war.14
Die letzte Dynastie des chinesischen Kaiserreichs, jene der Qing (Mandschu-Dynastie), die weitläufige Ming-Ländereien beschlagnahmt und an den kaiserlichen Clan und seine Verbündeten verteilt hatte, musste vielfältige Formen des Steuerbetrugs bekämpfen: Beamte vertuschten Unterschlagung, indem sie Nachzahlungsforderungen fälschten; sie übertrieben das Ausmaß von Naturkatastrophen, auf die der Staat mit Steuerbefreiungen reagierte; sie deklarierten ihr Land fälschlich als unfruchtbar; sie liehen sich Steuervorschüsse von den Reichen, stahlen das Geld und luden die Schulden anschließend als Nachzahlungsforderungen den einfachen Bauern auf; sie widmeten Land um, trieben jedoch den üblichen Steuersatz ein und steckten den Differenzbetrag ein; sie hielten Quittungen zurück oder fälschten sie. Der Landadel und Amtsträger im Ruhestand bezahlten oft überhaupt keine Steuern, während aktive Amtsträger und Staatsbedienstete die Lasten als Gegenleistung für einen Anteil am Gewinn auf die Bauern abwälzten. Schließlich wurde Land unter manchmal Hunderten falschen Namen registriert, denn es war praktisch unmöglich, den zahlreichen geringfügigen Steuerforderungen nachzuspüren. Korruption unter hochrangigen Beamten war Standard bei der Vermögensakkumulation und wurde umso häufiger angewandt, je höher der Rang war. Nach einer Schätzung überstieg das Durchschnittseinkommen der Staatsdiener ihre offiziellen, rechtmäßigen Einkünfte, die sie mit Gehältern, Belohnungen und Vergütungen erzielten, um das Dutzendfache; bei einem Generalgouverneur stieg dieser Faktor auf das Hundertfache und im Fall von He Shen, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Großsekretär am Qing-Hof war, auf das 400.000-Fache. Zu den gleichermaßen zeitlosen Gegenmaßnahmen zählten Hinrichtungen und die Beschlagnahme von Vermögen.15
In der Gegenwart sehen wir, wie hartnäckig sich derartige Praktiken in China halten. Als Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros schaffte es Zhou Yongkang, sich 326 über ganz China verteilte Immobilien im Wert von 1,76 Milliarden Dollar anzueignen. Dazu kamen sechs Milliarden Dollar auf Hunderten Bankkonten, die ihm und Mitgliedern seiner Familie gehörten, sowie Wertpapiere im Wert von 8,24 Milliarden Dollar. Als er im Dezember 2014 verhaftet wurde, fanden die Ermittler in verschiedenen Residenzen des KPFunktionärs heimische und ausländische Banknoten im Wert von 300 Millionen Dollar sowie große Mengen an Barrengold. Dank seiner herausragenden Position in der Partei stellte er die entsprechenden Leistungen seiner Rivalen in den Schatten – mit seinem Gesamtvermögen hätte er im Jahr 2015 den 55. Rang in der Forbes-Liste der reichsten Personen der Welt eingenommen –, obwohl sich auch andere hochrangige Funktionäre nach Kräften bemühten: In der Villa eines Generals wurde eine Tonne gefunden, die mit sorgfältig gestapelten Geldscheinen gefüllt war, und sogar ein Funktionär der mittleren Ebene beim Wasserwerk eines bei Parteiführern beliebten Ferienorts schaffte es, Immobilien und Bargeld im Wert von mehr als 180 Millionen Dollar anzuhäufen.16
Das Römische Reich
Doch kehren wir zum ursprünglichen »einen Prozent« der Antike zurück. Im alten Rom entwickelte sich die Ungleichheit in mehrerlei Hinsicht ähnlich wie in China, aber Umfang und Detailreichtum der Belege (von Dokumenten bis zu archäologischen Überresten) erlauben es uns, die Konzentration von Einkommen und Vermögen in diesem Fall genauer zu untersuchen und direkter mit dem Aufstieg und der Konsolidierung der imperialen Macht zu verknüpfen. Quantitative Informationen liegen ab dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert vor, als Rom seinen Machtbereich weit über die italienische Halbinsel hinaus ausdehnte und Zugang zu den Ressourcen der hellenistischen Königreiche im östlichen Mittelmeer fand. Als das Reich wuchs, schwollen die Vermögen der Aristokratie an (Tabelle 2.1).17
Tabelle 2.1 Entwicklung der größten dokumentierten Vermögen in der römischen Gesellschaft (a) und der von Rom beherrschten Bevölkerung (b) zwischen dem 2. Jh. v. Chr. und dem 5. Jh. n. Chr.
Diese Zahlen zeigen, dass die größten Privatvermögen im Lauf von etwa fünf Generationen um das 40-Fache stiegen. Ausgehend von sehr konservativen Annahmen, wuchs das Gesamtvermögen der Senatorenklasse, die den Staat führte, vom zweiten bis zum ersten vorchristlichen Jahrhundert um dieselbe Größenordnung. Die Inflation war gering und alles deutet darauf hin, dass die durchschnittliche Pro-Kopf-Produktion und der persönliche Wohlstand der gewöhnlichen Bürger lediglich um einen Bruchteil der Vermögen der Oberschicht wuchsen. Die römische Machtelite war also sehr viel reicher geworden, und zwar nicht nur in absoluten, sondern auch in relativen Zahlen: Die Vermögen von Senatoren wuchsen deutlich schneller als die Bevölkerung, die im Mittelmeerraum und seinem Hinterland unter römischer Herrschaft lebte. Und die Bereicherung der Elite schloss weitere Bestandteile der römischen Gesellschaft ein. Im 1. Jahrhundert v. Chr. besaßen mindestens 10.000, möglicherweise aber auch doppelt so viele Bürger, die überwiegend auf der italienischen Halbinsel lebten, ein Vermögen von mehr als 400.000 Sesterzen und insofern Zugang zum Ritterstand, dem zweithöchsten Stand nach dem der Senatoren. In Anbetracht der Tatsache, dass ein persönliches Vermögen von einigen Millionen Sesterzen noch wenige Generationen früher außergewöhnlich gewesen war, zeigt dies, dass die niedrigeren Ränge der herrschenden Klasse ihren Wohlstand ebenfalls deutlich erhöhen konnten. Zur Entwicklung der Vermögen gewöhnlicher Bürger liegen keine Daten vor, aber sie dürfte von zwei entegalisierenden Kräften geprägt worden sein: Eine dynamische Verstädterung, die im Allgemeinen die Ungleichheit verschärft, und die Entstehung einer Sklavenpopulation von vermutlich mehr als einer Million Menschen allein in Italien, denen Privateigentum gesetzlich verboten war und die oft (wenn auch nicht immer) von einem Einkommen auf Subsistenzniveau leben mussten, vergrößerten wahrscheinlich die wirtschaftliche Ungleichheit in der Gesellschaft insgesamt.18
Woher kamen nun aber all diese zusätzlichen Ressourcen? Die auf Marktbeziehungen beruhende wirtschaftliche Entwicklung beschleunigte sich zweifellos in der Spätphase der Republik. Der Einsatz von Sklaven in landwirtschaftlicher Produktion und Manufaktur sowie der durch zahlreiche archäologische Funde belegte Export von Wein und Olivenöl deuten auf den Erfolg der römischen Kapitaleigentümer hin. Aber das war nur ein Teil der Geschichte. Einfache Schätzungen des wahrscheinlichen Umfangs von Angebot und Nachfrage deuten darauf hin, dass der Grundbesitz und die damit verbundenen gewerblichen Aktivitäten nicht annähernd genug Einkommen hätten abwerfen können, um die römische Elite so reich zu machen, wie sie war. Tatsächlich finden wir in den Quellen Belege dafür, dass die Ausübung von Zwang eine unverzichtbare Voraussetzung für höchste Einkommen und Vermögen war. Die staatliche Verwaltung außerhalb Italiens war eine Quelle großen Reichtums und die Staatsführung nach römischer Art begünstigte die Ausbeutung. Die Provinzverwaltung war sehr einträglich, die Rentenökonomie wurde kaum durch Gesetze eingeschränkt und die Gerichte gingen selten gegen Erpressung vor; Bündnisse und eine Aufteilung der politischen Renten unter den Mächtigen gewährten Schutz gegen Strafverfolgung. Zu einer Zeit, als in Rom selbst jährliche Zinsraten von sechs Prozent üblich waren, verlangten reiche Römer von den Städten in den römischen Provinzen, die Geld brauchten, um die Forderungen ihrer Gouverneure erfüllen zu können, Zinsen von bis zu 48 Prozent. Mitglieder des Ritterstands profitierten von der verbreiteten Praxis der Steuerpacht und traten das Recht zur Eintreibung bestimmter Abgaben in einer Provinz an Konsortien ab, die dann alles unternahmen, um möglichst viel Geld aus der Bevölkerung herauszuholen. Eine ähnlich wichtige, wenn nicht sogar wichtigere Einkommensquelle für die Elite war die Kriegführung. Die römischen Befehlshaber konnten frei über die Kriegsbeute verfügen und sie nach ihrem Gutdünken zwischen ihren Soldaten, Offizieren und Beratern, der Staatskasse und sich selbst aufteilen. Anhand von Daten zu mehreren militärischen Einsatzgebieten und Kriegen wurde geschätzt, dass in den Jahren zwischen 200 und 30 v. Chr. mindestens ein Drittel der etwa 3000 Senatoren, die in diesem Zeitraum lebten, Gelegenheit erhielten, sich auf diese Art zu bereichern.19
Als das republikanische System um das Jahr 80 v. Chr. in ein halbes Jahrhundert der Instabilität eintrat und schließlich zusammenbrach, schufen gewaltsame innere Konflikte neue Vermögen, indem sie den vorhandenen Reichtum der Elite neu verteilten. Mehr als 1600 Angehörige der herrschenden Klasse – Senatoren und Ritter – fielen der Proskription zum Opfer, einer Form von politisch motivierter Ächtung, durch die sie ihr Vermögen und oft auch ihr Leben verloren. Die Anhänger der siegreichen Fraktion eigneten sich die abgewerteten beschlagnahmten Vermögenswerte der Geächteten in Versteigerungen an. Die gewaltsame Umverteilung beschleunigte sich in den langen Bürgerkriegen der Vierziger- und Dreißigerjahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Im Jahr 42 v. Chr. löschte eine Welle von Proskriptionen mehr als 2000 Elitehaushalte aus. Infolge dieser Verwerfungen und des Aufstiegs einer neuen herrschenden Klasse im Fahrwasser der Kriegsherren machte die römische Oberschicht die erste große Umwälzung seit Beginn der Republik durch: Familien, die die Republik jahrhundertelang beherrscht hatten, kamen zu Fall und wurden durch andere ersetzt. Die Republik löste sich auf und die politische Ordnung entwickelte für Monarchien typische Merkmale wie jene, die wir zuvor am Beispiel von Han-China untersucht haben, darunter Gewinne und Verluste der Elite aufgrund blutiger innerer Machtkämpfe und eine politisch begründete Diskontinuität der Vermögen der Elite.20
Die Republik wurde von einer permanenten Militärdiktatur abgelöst, die lediglich die Fassade der republikanischen Institutionen aufrechterhielt. Voraussetzung für großen Reichtum war nun eine enge Beziehung zu den neuen Herrschern – den Kaisern – und ihrem Hof. Im 1. Jahrhundert sind sechs Vermögen zwischen 300 und 400 Millionen Sesterzen dokumentiert, Vermögen, die alles in den Schatten stellten, was aus der Zeit der Republik bekannt war: Den Großteil dieser von hochrangigen Höflingen angehäuften Reichtümer absorbierte schließlich die Staatskasse. Die Umwälzung des Reichtums der Elite nahm verschiedene Formen an. Von aristokratischen Verbündeten und Günstlingen wurde oft erwartet, dass sie den Herrscher in ihrem Testament berücksichtigten. Der erste Kaiser Augustus erklärte, von seinen Freunden im Lauf von zwei Jahrzehnten Hinterlassenschaften im Wert von 1,4 Milliarden Sesterzen erhalten zu haben. Unter seinen Nachfolgern gingen zahlreiche Hinrichtungen wegen tatsächlichen oder eingebildeten Hochverrats oder Umsturzplänen und reihenweise Beschlagnahmen von Vermögen reicher Römer in die Annalen ein. Das dokumentierte oder implizierte Ausmaß der Enteignungen an der Spitze der Gesellschaft, die unter einigen Kaisern mehrere Prozent des Gesamtvermögens der Elite betrafen, gibt Aufschluss über die Brutalität der Umverteilung unter den sehr reichen Römern. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Freizügigkeit und Wiederaneignung einfach zwei Facetten desselben Verfahrens waren, das es den Herrschern erlaubte, Vermögen abhängig von den politischen Erfordernissen zu schaffen und zu vernichten.21
Unter der Autokratie hielten sich herkömmliche Methoden der Bereicherung mithilfe politischer Ämter. Die Provinzgouverneure erhielten nun bis zu eine Million Sesterzen pro Jahr für ihre guten Dienste, sicherten sich nebenher jedoch noch weitere Reichtümer: Ein Gouverneur kam als pauper (Armer) nach Syrien, verließ die Provinz jedoch nach nur zwei Jahren als dives (Reicher). Ein Jahrhundert später war ein Gouverneur in Südspanien so unklug, sich damit zu brüsten, den Einwohnern seiner Provinz vier Millionen Sesterzen abgepresst und obendrein einige von ihnen in die Sklaverei verkauft zu haben. Ein sehr viel schwächeres Glied in der Nahrungskette, ein kaiserlicher Sklave, der den Staatsschatz in Gallien beaufsichtigen sollte, ließ sechzehn andere Sklaven für sich arbeiten, von denen sich zwei um seinen anscheinend sehr umfangreichen Besitz an Tafelsilber kümmerten.22
Die Einigung des Reiches und der Ausbau der Verbindungen zwischen den Reichsteilen erleichterten Wachstum und Konzentration der persönlichen Vermögen. Unter Nero besaßen angeblich sechs Männer »die Hälfte« der Provinz Afrika (deren Kerngebiet das heutige Tunesien bildete); allerdings beschlagnahmte Nero schließlich ihren Besitz. Obwohl diese Behauptung zweifellos übertrieben ist, muss sie in einer Region, in der große Latifundien als rivalisierende Stadtterritorien beschrieben werden konnten, nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt gewesen sein. Die reichsten Familien aus den Provinzen fanden Aufnahme in die herrschende Klasse des Reichs und versuchten, sich hohe Ränge und Privilegien zu sichern, um die damit verbundenen Chancen auf noch größere Reichtümer zu nutzen. Eine Auswertung römischer Literatur hat ergeben, dass fast nur Senatoren im Rang von Konsuln, die besondere Gunst genossen und den besten Zugang zu zusätzlichen Reichtümern hatten, Beinamen erhielten, die Reichtum signalisierten. Die formale Statusordnung beruhte auf der finanziellen Leistungsfähigkeit und die Zugehörigkeit zu den drei Ständen der herrschenden Klasse – Senatoren, Ritter und Dekurionen – war an abgestufte Zensusschwellen gekoppelt.23
Dieselbe enge Verflechtung von persönlichem Vermögen und politischer Macht war auch auf lokaler Ebene zu beobachten. Das ausgereifte Römische Reich bestand aus rund 2000 weitgehend eigenständigen städtischen oder andersartig organisierten Gemeinden, die von wechselnden Gouverneuren und kleinen Kadern von Beamten sowie freien und unfreien Bediensteten des Reiches, die sich in erster Linie um finanzielle Fragen kümmerten, beaufsichtigt – und nach Möglichkeit geschröpft – wurden. Eine Stadt wurde normalerweise von einem Rat regiert, in dem die heimischen Reichen vertreten waren. Die Stadträte, in denen sich die Dekurionen versammelten, waren nicht nur für die lokalen Abgaben und die Ausgaben der Gemeinde zuständig, sondern bewerteten auch den Wohlstand der Gemeinde zur Festlegung der an den römischen Staat abzuführenden Steuern und trieben die Abgaben ein, die den Steuereintreibern und Steuerpächtern zu übergeben waren. Wenn die zahlreichen archäologischen und epigrafischen Belege für die Ausgabenfreude in dieser Zeit aussagekräftig sind, können wir feststellen, dass diese lokalen Eliten wussten, wie sie ihr Vermögen vor der fernen Zentralregierung schützen und einen großen Teil der wirtschaftlichen Überschüsse in der Heimat halten konnten, sei es, um sie in die eigenen Taschen zu stecken oder öffentliche Einrichtungen damit zu finanzieren.24
Über die graduelle Konzentration des lokalen Reichtums geben die Überreste der bekanntesten aller römischen Städte Aufschluss, die im Jahr 79 unter der vom Vesuv ausgespuckten Asche begraben wurde. Neben zahlreichen Inschriften, in denen Amtsträger und Eigentümer produktiver Vermögenswerte genannt werden, hat in Pompeji ein Großteil der zum Zeitpunkt der Katastrophe vorhandenen Haushaltseinrichtung überdauert und in einzelnen Fällen konnten sogar die Bewohner bestimmter Häuser identifiziert werden. Die städtische Elite bestand aus einem inneren Kern reicher Bürger, die privilegierten Zugang zu den öffentlichen Ämtern hatten. Auch die urbane Struktur verrät uns einiges über die Stratifizierung. In Pompeji gab es rund fünfzig große Herrenhäuser mit einem geräumigen Atrium, einem Hof mit Säulengängen und mehreren Speisezimmern. Dazu kamen mindestens hundert weniger üppige Residenzen bis hinab zum kleinsten bekannten Haus eines Stadtratsmitglieds, das die Schwelle zum Wohlstand markierte. Diese Stadtgliederung entspricht den Angaben in den erhaltenen Dokumenten, in denen etwa hundert Familien genannt sind, die der Elite angehörten. Möglicherweise war immer nur ein Teil von ihnen im Stadtrat vertreten. In einer Gemeinde mit 30.000 bis 40.000 Einwohnern (einschließlich des umliegenden Stadtgebiets) stellten zwischen 100 und 150 Oberschichtfamilien, die schöne Stadthäuser bewohnten, die obersten ein bis zwei Prozent der lokalen Gesellschaft. Diese Familien verbanden die Bewirtschaftung von Landgütern im Umland mit der Fertigung und dem Handel in städtischen Betrieben; zu den Herrenhäusern gehörten normalerweise Werkstätten und andere gewerbliche Einrichtungen.
Besonders auffällig ist die fortschreitende Konzentration der städtischen Immobilien in den Händen von immer weniger Familien. Die archäologische Forschung hat gezeigt, dass alle großen Herrenhäuser und viele Wohnhäuser wohlhabender Einwohner durch Absorption kleinerer Wohnquartiere entstanden. Im Lauf der Zeit wich eine einigermaßen egalitäre Verteilung des Wohnraums (und vielleicht auch des Wohlstands), die vermutlich mit der Zwangsansiedlung römischer Veteranen im Jahr 80 v. Chr. einherging, einer wachsenden Ungleichheit, die in erster Linie auf Kosten der mittelständischen Haushalte ging, die aus der urbanen Struktur verdrängt wurden. Als eine Kultur der militärischen Massenmobilisierung und Umverteilung von oben nach unten durch eine stabile Autokratie ersetzt wurde, kam es zu einer sozialen Polarisierung. Die hohe Sterblichkeit und die Erbteilung genügten nicht, um die Vermögen aufzusplittern und die Gesellschaftspyramide abzuflachen, sondern dienten lediglich dazu, den Reichtum innerhalb der Elite in Umlauf zu halten.25
Die archäologischen Funde deuten darauf hin, dass sich die Stratifizierung des Wohnraums unter römischer Herrschaft verstärkte. Wie ich in Kapitel 9 genauer erklären werde, war der Wohnraum in Britannien und Nordafrika in römischer Zeit ungleicher verteilt als vorher und abhängig davon, welchen Datensatz wir heranziehen, könnte dasselbe auch für Italien gelten. Das kann nicht überraschen: Obwohl das Wachstum des Reichs der Machtelite und denen, die dieser Elite nahestanden, unverhältnismäßig große Gewinne sicherte, förderte es auch die Akkumulation und Konzentration des Reichtums in den Kreisen der Elite. In den ersten anderthalb Jahrhunderten der Monarchie kam es, gemessen an historischen Maßstäben, zu sehr wenigen zerstörerischen Kriegen und anderen Konflikten. Der Frieden im Römischen Reich gab Sicherheit für Kapitalinvestitionen. Sieht man von denen an der Spitze der Pyramide ab, so waren Besitz und Vererbung von Vermögen kaum gefährdet.26
So entstand eine klar geschichtete Gesellschaft, in der sich die reichsten ein bis zwei Prozent einen großen Teil des über das Subsistenzniveau hinausgehenden wirtschaftlichen Überschusses aneigneten. Wir können die Ungleichheit im Römischen Reich zumindest in groben Zügen quantifizieren. Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung im 2. Jahrhundert erwirtschafteten seine rund 70 Millionen Einwohner ein jährliches Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Wert von 50 Millionen Tonnen Weizen, was etwa 20 Milliarden Sesterzen entsprach. Das mittlere Pro-Kopf-BIP von 800 Dollar in internationalen Dollar von 1990 scheint gemessen an der Wirtschaftsleistung anderer vormoderner Volkswirtschaften plausibel. Nach meiner eigenen Rekonstruktion erzielte eine Viertelmillion Haushalte – in dieser Zahl sind die Haushalte von rund 600 Senatoren, mindestens 20.000 Rittern, 130.000 Dekurionen und weiteren 65.000 bis 130.000 reichen Familien ohne Rang enthalten – ein Gesamteinkommen von drei bis fünf Milliarden Sesterzen. In diesem Szenario entfiel zwischen einem Sechstel und einem knappen Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung auf etwa 1,5 Prozent der Haushalte. Aber dieser Anteil könnte durchaus zu niedrig angesetzt sein, da das Einkommen hier von den mutmaßlichen Erträgen des geschätzten Vermögens abgeleitet wird; unter Berücksichtigung der politischen Renten müsste man das Einkommen der Elite noch höher ansetzen.
Obwohl die Einkommensverteilung unterhalb der Ebene der Elite noch schwieriger zu beurteilen ist, lag der Gini-Koeffizient für die Einkommen im gesamten Reich bei Zugrundelegung konservativer Annahmen vermutlich bei knapp über 0,4. Aber dieser Wert ist sehr viel höher, als man meinen könnte. Da das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP das Existenzminimum nach Steuern und Investitionen nur um das Doppelte überstieg, war das Niveau der Einkommensungleichheit nicht deutlich niedriger als auf diesem Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung möglich, ein Charakteristikum, das die römische Volkswirtschaft mit der vieler anderer vormoderner Gesellschaften teilte. Gemessen am Anteil des BIP, der den Primärproduzenten entzogen werden konnte, war die Ungleichheit im Römischen Reich daher extrem ausgeprägt. Höchstens ein Zehntel der Bevölkerung unterhalb der reichen Elite erzielte ein Einkommen, das deutlich über dem Subsistenzniveau lag.27
Die Spitzeneinkommen waren so hoch, dass sie zwangsläufig teilweise reinvestiert wurden, was die Vermögenskonzentration zusätzlich erhöhte. Machtasymmetrien dürften Provinzbewohner dazu bewegt haben, einen Teil ihres Landes zu verkaufen, um die Steuern zahlen zu können, eine Praxis, die wir nicht quantifizieren können, die jedoch eine Erklärung für die Entstehung des transregionalen aristokratischen Grundbesitzes in späteren Jahren sein könnte. Dies wirft die Frage auf, ob und wann die Ungleichheit im Römischen Reich ihren Höhepunkt erreichte. Die Frage ist, welche Relevanz wir einer offenkundig übertriebenen Darstellung des Historikers Olympiodorus aus den Zwanzigerjahren des 5. Jahrhunderts beimessen wollen, der den führenden aristokratischen Familien Roms einen fantastischen Reichtum zusprach und erklärte, »viele« von ihnen hätten jedes Jahr 4000 Pfund Gold mit ihren Landgütern sowie den Gegenwert eines Drittels dieser Edelmetallmenge in Naturalien eingenommen, während sich die Angehörigen der zweiten Schicht mit 1000 bis 1500 Pfund Gold pro Jahr hätten begnügen müssen. Umgerechnet in die Währung der früheren monarchischen Periode entspricht das Spitzeneinkommen von 5333 Pfund Gold etwa 350 Millionen Sesterzen im 1. Jahrhundert, was sich mit den größten Vermögen jener Zeit messen konnte. Anscheinend stießen die Vermögen der reichsten römischen Familien mit der Errichtung der Monarchie zu Beginn unserer Zeitrechnung an eine Grenze, die – sieht man von einigen Schwankungen ab – bis zum Zusammenbruch der römischen Macht im Lauf des 5. Jahrhunderts Bestand hatte.28
Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass die Ungleichheit auf lokaler und regionaler Ebene weiter zunahm, da die traditionellen städtischen Eliten unter wachsenden Druck gerieten. Innerhalb der lokalen Eliten kam es zu einer Spaltung zwischen einer Minderheit, die von der Zugehörigkeit zu suprakommunalen Einrichtungen profitierte, und der großen Mehrheit, für die das nicht galt. Sehr gut belegt ist dies für das spätrömische Ägypten. Erhaltene Papyrusdokumente zeigen, wie die Position der bestehenden herrschenden Klasse, die sich bis ins 4. Jahrhundert halten konnte, untergraben wurde, als sich einige ihrer Mitglieder einen Vorteil verschafften, indem sie staatliche Ämter erlangten, die mit der Befreiung von lokalen Steuern verbunden waren und neue Chancen zur persönlichen Bereicherung eröffneten. Diese Aufwärtsmobilität ermöglichte bis zum 6. Jahrhundert die Entstehung einer neuen Provinzaristokratie in Ägypten, die große Teile des fruchtbaren Ackerlands kontrollierte und Schlüsselpositionen in der regionalen Verwaltung bekleidete. Ein klassisches Beispiel dafür liefern die Apionen, eine ursprünglich dem Dekurionenstand angehörende Familie, die einige ihrer Mitglieder in hohe Staatsämter schleuste und sich im Lauf der Zeit mehr als 6000 Hektar gutes Ackerland aneignete, das überwiegend in einem einzigen Bezirk Ägyptens lag. Und dies dürfte kein Einzelfall gewesen sein: Im Jahr 323 besaß ein einziger Mann in einer italienischen Ortschaft offenbar 9000 Hektar Land. Die Streuung des Grundbesitzes der Superreichen über das ganze Reichsgebiet wurde also durch eine zunehmende Konzentration des Grundeigentums auf kommunaler und regionaler Ebene ergänzt.29
Es gab noch eine weitere Parallele zu China, die zur Zunahme der Ungleichheit beitrug. In verschiedenen Teilen des späteren Römischen Reichs stellten sich Bauern unter den Schutz mächtiger Grundherren (und Beamter), die für sie die Beziehungen zur Außenwelt regelten und vor allem die Eintreibung der Reichssteuern übernahmen. In der Praxis verringerte dies die Staatseinnahmen und gab den Grundherren besseren Zugriff auf die Überschüsse der landwirtschaftlichen Produktion. Dies wiederum schwächte nicht nur die Zentralverwaltung, sondern lud den Gruppen, die weniger Macht besaßen, zusätzliche steuerliche Lasten auf, was die Position der Grundbesitzer der mittleren Ebene sehr schwächte. Das fast unvermeidliche Ergebnis war einmal mehr eine Polarisierung zwischen Reich und Arm. Wie im späten Han-China entstanden Privatarmeen und Kriegsherren begannen, lokale Herrschaftsansprüche anzumelden. Im Lauf der Zeit nahmen Stratifizierung und materielle Ungleichheit anscheinend noch extremere Formen an. Der Wohlstand der mittleren Grundeigentümerschicht, über deren Umfang wenig bekannt ist, wurde durch die Einkommens- und Vermögenskonzentration in den Händen einer politisch einflussreichen Elite zermahlen. Nachdem Rom und die westliche Hälfte des Reiches von germanischen Führern übernommen worden waren, nahm die Ungleichheit anscheinend im verbliebenen Teil des Reichs im östlichen Mittelmeerraum noch weiter zu und stieg bis zum Jahr 1000 auf das außergewöhnliche Maß, das für Byzanz geschätzt worden ist. Im Lauf der Zeit verwandelte sich dieses auf Tributleistungen beruhende Reich mit seiner charakteristischen Verflechtung von politischer und wirtschaftlicher Macht und der damit einhergehenden Polarisierung in eine Entegalisierungsmaschine.30
Imperiale Muster
Unter der Oberfläche ihrer institutionellen und kulturellen Unterschiede wiesen das chinesische und das römische Großreich eine grundlegende Gemeinsamkeit auf: ein Muster der Überschussaneignung und -konzentration, das ein hohes Maß an Ungleichheit hervorbrachte. Die imperiale Herrschaft führte zu Ressourcenströmen, die der Elite an den Schalthebeln der Macht ein Ausmaß an Reichtum ermöglichten, das in kleineren Staatsgebilden undenkbar gewesen wäre. Das Ausmaß der Ungleichheit war also zumindest teilweise ein Ergebnis der Größe des imperialen Staates. Diese Reiche, die sich auf Tausende Jahre früher entwickelten Mechanismen der Kapitalinvestition und Ausbeutung stützten, erhöhten unablässig den Einsatz. Staatliche Ämter versprachen größere Profite und geringere Transaktionskosten für Handel und Investitionen über große Entfernungen hinweg kamen denen zugute, die verfügbares Einkommen hatten. Am Ende konnten Einkommensungleichheit und Vermögenspolarisierung nur durch gewaltsame Umwälzungen rückgängig gemacht werden: durch eine Eroberung und Zerschlagung des Reichs, durch eine Auflösung der staatlichen Strukturen oder durch einen umfassenden Systemkollaps. Die vormodernen historischen Aufzeichnungen enthalten keine Hinweise auf friedliche Eingriffe zur Eindämmung der Ungleichheit in den Großreichen und in einem solchen politischen Umfeld waren solche Eingriffe auch kaum möglich. Aber selbst der Zusammenbruch eines Reiches unterbrach zumeist nur für kurze Zeit die Entwicklung und ebnete einfach den Weg für eine neue Phase wachsender Ungleichheit und Polarisierung.
Wenn es in einem intakten imperialen System gelang, die Ungleichheit einzudämmen, so durch eine gewaltsame Vermögensumverteilung innerhalb der Elite. Ich habe bereits den Fall des ägyptischen Mamlukensultanats (1250–1571) erwähnt, wo dieser Prozess möglicherweise seine klarste historische Ausprägung fand. Der Sultan, seine Emire und ihre Sklavensoldaten teilten sich die Kriegsbeute: Sie bildeten eine ethnisch und räumlich von der unterworfenen indigenen Bevölkerung getrennte herrschende Klasse, die Renten aus den Untertanen herauspresste, die brutal bestraft wurden, wenn die Ertragsströme den Erwartungen der Herrscher nicht entsprachen. Die individuellen Einkommen der Angehörigen der Elite hingen von den Resultaten unablässiger Machtkämpfe innerhalb der herrschenden Klasse ab und gewaltsame Konflikte veränderten häufig die Verteilung des Reichtums. Lokale Grundbesitzer suchten Schutz bei auf Erpressung spezialisierten Banden, die sie zwangen, die Verantwortung für ihr Vermögen örtlichen Machthabern aus der Mamlukenkaste zu übertragen und als Gegenleistung für Schutz vor Besteuerung Tribut zu leisten, eine Praxis, die von den Eliten gedeckt wurde, die einen Anteil an den Einnahmen erhielten. Die Reaktion der Zentralmacht bestand darin, Vermögen von Angehörigen der Elite zu konfiszieren.31
Das ausgereifte Osmanische Reich perfektionierte anspruchsvollere Strategien der erzwungenen Umverteilung. Vier Jahrhunderte lang ließen die Sultane Tausende Staatsbeamte und Bevollmächtigte ohne jegliches Gerichtsverfahren enteignen und hinrichten. Zu Beginn der osmanischen Expansion im 14. und 15. Jahrhundert hatte sich ein Adel von Kriegerfamilien gebildet, die sich mit dem Haus Osman verbündeten. Diese Aristokratie wurde später um Kriegereliten aus anderen Gebieten erweitert. Ab dem 15. Jahrhundert entwickelte sich ein absolutistisches Herrschaftssystem und das Sultanat schränkte die Macht der Aristokratie ein. Geerbtes Personal niederer Geburt aus der Sklavenschaft ersetzte die Nachkommen adliger Familien in staatlichen Ämtern. Obwohl diese Familien weiter um Ämter und Macht kämpften, wurden schließlich alle Staatsbeamten, ungeachtet ihres sozialen Hintergrunds, in ihrer Beziehung zum Herrscher als persönlich rechtlos betrachtet. Die staatlichen Ämter waren nicht vererbbar und das Vermögen von Beamten galt als präbendal und wurde de facto nicht als Privateigentum, sondern als zum Amt gehörig eingestuft. Wenn ein Staatsdiener starb, wurden alle im Amt erzielten Gewinne von seinem Vermögen abgezogen und wieder in die Staatskasse zurückgeführt. In der Praxis konnten sämtliche Besitztümer der Beamten aus dem einfachen Grund beschlagnahmt werden, dass nicht zwischen der Bekleidung eines Amts und dem Vermögen unterschieden wurde. Die Beschlagnahmung nach dem Tod von Amtsträgern wurde durch die Tötung und Enteignung amtierender Beamter ergänzt, die die Aufmerksamkeit des Sultans geweckt hatten. Die Angehörigen der Elite versuchten sich dem Zugriff des Machthabers so weit wie möglich zu entziehen und im 17. Jahrhundert gab es bereits einige Familien, die ihr Vermögen seit Generationen bewahrten. Im 18. Jahrhundert wuchs die Macht der lokalen Eliten, da Ämter und Funktionen zusehends verpachtet wurden, was eine umfassende Privatisierung der staatlichen Verwaltung zur Folge hatte und den Beamten die Möglichkeit gab, ihr Vermögen und ihren Status zu festigen. Der Zentralstaat konnte Vermögen nicht mehr im selben Umfang wie in der Vergangenheit beschlagnahmen und die Eigentumsrechte stabilisierten sich bis zu einem gewissen Grad. Gegen Ende des 18. und im frühen 19. Jahrhundert wurde die Praxis der Beschlagnahme zur Finanzierung von Kriegen wieder aufgegriffen, stieß jedoch auf Widerstand und wurde mit Vermeidungsstrategien beantwortet. Im Jahr 1839 entschied die osmanische Elite die Auseinandersetzung schließlich für sich: Der Sultan garantierte die Unantastbarkeit von Leben und Eigentum. Wie in anderen Großreichen, darunter dem Römischen Reich und Han-China, hatte der Zentralstaat im Lauf der Zeit Schritt für Schritt die Fähigkeit eingebüßt, den Reichtum der herrschenden Klasse umzuverteilen.32
In anderen Fällen war die Zentralgewalt zu schwach oder zu weit entfernt, um die Vermögenskonzentration in den Händen der Elite zu behindern. Die spanische Eroberung der etablierten Großreiche in Mesoamerika und den Anden liefert ein besonders gutes Anschauungsbeispiel. Im Verlauf der spanischen Reconquista wurden Adligen und Rittern Ländereien übertragen, in denen sie die Rechtshoheit über die Bevölkerung genossen. Die spanischen Eroberer weiteten dieses System auf ihre Territorien in der Neuen Welt aus, wo bereits ähnliche Praktiken angewandt wurden: Wie wir gesehen haben, hatten die Azteken auf Zwang beruhende extraktive Institutionen entwickelt, die Landschenkungen an die Eliten, Knechtschaft und Sklaverei beinhalteten. In Mexiko eigneten sich die Konquistadoren und späteren Adligen rasch weitläufige Ländereien an, die ihnen von der spanischen Krone in vielen Fällen erst nachträglich übertragen wurden. Der Grundbesitz von Hernán Cortés in Oaxaca wurde im Jahr 1535 in Fideikomiss gestellt und blieb dreihundert Jahre in seiner Familie; der Besitz der Cortés umfasste schließlich 15 Städte, 157 Dörfer, 89 haciendas (Landgüter), 119 ranchos, 5 estancias (Landgüter für extensive Viehzucht) und 150.000 Einwohner. Obwohl die Krone versuchte, die Dauer dieser als encomiendas bezeichneten treuhänderischen Übertragungen per Dekret zu begrenzen, erwiesen sich diese Lehen in der Praxis als permanente, ja sogar erbliche Besitztümer einer kleinen Klasse superreicher Grundherren. Die encomenderos umgingen das Verbot der Zwangsarbeit, indem sie die Einheimischen in die Schuldknechtschaft zwangen, um sich die Kontrolle über ihre Arbeitskraft zu sichern. So konnten sie die ursprünglich verstreuten und vielgestaltigen encomiendas im Lauf der Zeit in dauerhaftere haciendas umwandeln, zusammenhängende Landgüter, die von Landarbeitern bestellt wurden (die ihre Arbeitszeit zwischen den Feldern ihrer Familien und dem herrschaftlichen Gut aufteilten) und de facto kleine Staaten unter der despotischen Herrschaft der Grundherren waren. Spätere staatliche Korrekturmaßnahmen waren auf die größten Grundbesitzer beschränkt, vor allem, als die spanischen hacendados in Mexiko nach der Unabhängigkeit im Jahr 1821 vertrieben und durch heimische Eliten ersetzt wurden, die im Wesentlichen an den bestehenden Institutionen festhielten. Im 19. Jahrhundert nahm die Konzentration des Grundbesitzes noch zu, was zu der in Kapitel 8 beschriebenen Revolution führte.33
Etwas ganz Ähnliches geschah in Peru, wo es im Inkareich ebenfalls übliche Praxis gewesen war, Familien aus der Elite und hochrangigen Amtsträgern Land und Einkünfte zu übertragen. Francisco Pizarro und seine Offiziere erhielten die ersten encomiendas und Pizarro nahm für sich das Recht in Anspruch, Ländereien und die Kontrolle über die Bauern zu vergeben. Unter Missachtung königlicher Unterlassungsaufforderungen wurden peremptorisch große Ländereien vergeben und die einheimische Bevölkerung wurde zur Arbeit in den Bergwerken gezwungen. Zu einer Umverteilung kam es erst, als der Widerstand gegen die Auferlegung von Obergrenzen für die Landübertragungen Pizarros Bruder Gonzalo dazu verleitete, eine erfolglose Rebellion anzuzetteln. Dennoch nahm die Konzentration von Grundbesitz und Vermögen in Peru noch extremere Formen als in Mexiko an: Rund fünfhundert encomiendas erstreckten sich über fast das gesamte fruchtbare Land. Auch einige der ergiebigen Silberminen in Potosí wurden Günstlingen übertragen, die dort tributpflichtige Indianer als Zwangsarbeiter einsetzten. Die einheimischen Stammesoberhäupter kooperierten mit den neuen Herren und stellten die Einwohner ihrer Dörfer für den Arbeitsdienst ab; im Gegenzug wurden sie zu Verwaltern ernannt und erhielten manchmal sogar eigene Landgüter. In der für Großreiche typischen Art war die Kollusion zwischen ausländischen und einheimischen Eliten eine Gewähr für wirtschaftliche Polarisierung und Ausbeutung der großen Bevölkerungsmehrheit. Wie in Mexiko wurde die an sich illegale Bereicherung im Lauf der Zeit legalisiert. Die bolivarische Landverteilung nach der Unabhängigkeit von Spanien scheiterte und im 19. Jahrhundert ging sogar das Allmendeland der indigenen Bevölkerung in den großen Landgütern auf.34
Nicht nur in den Kolonialreichen gelang es den Machteliten, die durch politische Ämter oder dank persönlicher Verbindungen erworbenen Vermögen zu verteidigen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Im Frankreich der frühen Neuzeit konnten jene Familien, die dem Thron besonders nahestanden, ihren Einfluss in großen persönlichen Reichtum ummünzen, den sie auch nach dem Tod oder der Entlassung des Amtsträgers bewahrten. Maximilien de Béthune, der Herzog von Sully, der elf Jahre der leitende Minister in der Regierung von Heinrich IV. und als Surintendant für die Staatsfinanzen zuständig war, überlebte seine Entlassung nach dem Tod des Königs im Jahr 1611 um dreißig Jahre und hinterließ ein Vermögen von mehr als fünf Millionen Livre, einen Betrag, der dem Jahreseinkommen von 27.000 Tagelöhnern in Paris entsprach. Kardinal Richelieu, der von 1624 bis 1642 einen vergleichbaren Posten bekleidete, häufte sogar das Vierfache dieses Vermögens an. Beide wurden jedoch von Richelieus Nachfolger, dem Kardinal Mazarin, in den Schatten gestellt, der von 1642 bis 1661 im Amt war, ein zweijähriges Exil während der Fronde-Aufstände (1648–1653) überstand und 37 Millionen Livres (das Jahreseinkommen von 164.000 Tagelöhnern) hinterließ. Das war eine Amtsführung nach dem Geschmack des Genossen Zhou Yonkang aus dem Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas. Auch weniger einflussreiche Minister bewiesen, dass sie als Banditen hätten Karriere machen können: Richelieus Verbündeter Claude de Bullion verdiente in seiner achtjährigen Amtszeit als Finanzminister 7,8 Millionen Livre und das Vermögen von Nicolas Fouquet, der dasselbe Amt genauso lange bekleidete, wurde bei seiner Verhaftung im Jahr 1661 auf 15,4 Millionen Livre geschätzt (obwohl er ebenso hohe Schulden angehäuft hatte). Diese Zahlen entsprachen den größten aristokratischen Vermögen: In dieser Zeit besaßen die Princes de Conti, ein Zweig der herrschenden Bourbonen, zwischen acht und zwölf Millionen Livre. Selbst dem aggressiven Sonnenkönig Ludwig XIV. gelang es nur teilweise, seine Minister in Schach zu halten; dennoch brauchte Jean-Baptiste Colbert 18 Jahre an der Spitze der Finanzverwaltung, um ein vergleichsweise bescheidenes Vermögen von fünf Millionen aufzubauen, und François Michel Le Tellier, der Marquis de Louvois, musste dem Staat 24 Jahre lang als Kriegsminister dienen, um acht Millionen auf die Seite schaffen zu können. Anscheinend konnte der König bestenfalls darauf hoffen, die Einnahmen seiner Minister von ein bis zwei Millionen auf einige Hunderttausend Livre im Jahr zu drücken.35
Es gibt zahlreiche weitere Beispiele aus aller Welt, aber die genannten müssen genügen, um den grundlegenden Sachverhalt zu veranschaulichen. In vormodernen Gesellschaften trug politische Macht sehr viel mehr als geschäftliche Kompetenz zur Entstehung großer Vermögen bei. Diese Vermögen unterschieden sich in erster Linie in Bezug auf ihre Dauerhaftigkeit, die von der Fähigkeit und Bereitschaft der Herrscher zu despotischen Eingriffen abhing. Eine hohe Ressourcenkonzentration an der Spitze sowie eine ausgeprägte Ungleichheit waren typisch und die unterschiedliche Vermögensmobilität hatte keinerlei Auswirkungen auf die Situation der großen Bevölkerungsmehrheit außerhalb der plutokratischen Kreise. Wie im ersten Kapitel erläutert, begünstigten die Strukturen fast aller vormodernen Staaten einen mit Zwang einhergehenden Einkommensmodus und eine Vermögenskonzentration, die die Ungleichheit im Lauf der Zeit stetig erhöhten. Das Ergebnis war, dass diese Gesellschaften oft das höchste mögliche Maß an Ungleichheit erreichten. Wie ich im Anhang am Ende dieses Buchs genauer erklären werde, ergeben grobe Schätzungen für 28 vorindustrielle Gesellschaften zwischen der Zeit des Römischen Reichs und den Vierzigerjahren des 20. Jahrhunderts eine durchschnittliche Extraktionsrate von 77 Prozent. Diese Rate gibt Aufschluss über den aktualisierten Anteil des maximalen Ausmaßes der bei einem gegebenen Pro-Kopf-Einkommen theoretisch möglichen Einkommensungleichheit. Es gab nur wenige Ausnahmen: Der einzige einigermaßen gut dokumentierte Fall ist der des klassischen Athen im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., wo es die direkte Demokratie und eine Kultur der militärischen Massenmobilisierung ermöglichten, die Einkommensungleichheit einzudämmen (vgl. die Beschreibung in Kapitel 6). Wenn wir den auf kargen antiken Belegen beruhenden Schätzungen glauben können, war das Pro-Kopf-BIP Athens um das Jahr 330 v. Chr. relativ hoch für eine vormoderne Gesellschaft – es lag etwa beim Vier- bis Fünffachen des Existenzminimums, das heißt auf einem ähnlichen Niveau wie in den Niederlanden im 15. Jahrhundert und in England im 16. Jahrhundert – und der Gini-Koeffizient der Markteinkommen betrug etwa 0,38. Gemessen an vormodernen Staaten war die daraus abzuleitende Extraktionsrate von 49 Prozent außergewöhnlich niedrig.36
Aber die athenische Anomalie war nicht von Dauer. Als das Römische Reich den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte, war der reichste Bürger Athens ein Mann mit dem passend expansiven Namen Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes, der behauptete, nicht nur von berühmten Politikern des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, sondern auch vom Göttervater Zeus selbst abzustammen. In jüngerer Zeit hatten seine Ahnen der athenischen Aristokratie angehört und waren nach Erlangung der römischen Bürgerschaft in hohe öffentliche Ämter aufgestiegen, was es der Familie ermöglicht hatte, ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen, das sich möglicherweise sogar mit dem der reichsten Römer messen konnte. Der Name deutet auf eine Verbindung zum römischen Patrizierclan der Claudier hin, der mehrere Kaiser hervorgebracht hatte. Die Familie von Herodes Atticus hatte sogar eine für die römische Oberschicht typische Erfahrung gemacht, als das Vermögen seines Großvaters Hipparchus – das einst beiläufig auf 100 Millionen Sesterzen geschätzt worden war – von Kaiser Domitian beschlagnahmt, der Familie jedoch später (unter geheimnisvollen Umständen) zurückerstattet worden war. Herodes überhäufte griechische Städte mit Spenden und finanzierte öffentliche Bauwerke, darunter insbesondere das Odeon in Athen. Wenn er tatsächlich 100 Millionen besaß – ein Betrag, der das größte aus klassischer Zeit bekannte Privatvermögen um das 24-Fache überstieg –, hätte sein Jahreseinkommen um das Jahr 330 v. Chr. genügt, um ein Drittel der Staatsausgaben Athens (für Kriegsschiffe, Verwaltung, Festlichkeiten, Wohlfahrt, öffentliche Bauten usw.) zu bestreiten, aber es ist durchaus möglich, dass er sogar noch reicher war. Herodes stand dem Kaiser Antoninus Pius nahe, dessen Adoptivsöhnen und Nachfolgern er als Tutor zur Seite stand, und hatte als erster Grieche nachweislich das höchste traditionelle Staatsamt in Rom inne. Im Jahr 143 wurde er ordentlicher Konsul. Die für Großreiche charakteristische Patronage und Ungleichheit hatten sich durchgesetzt.