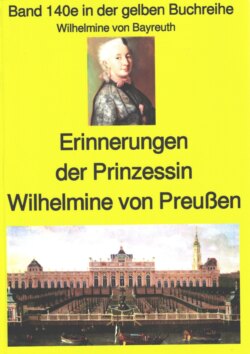Читать книгу Wilhelmine von Bayreuth: Erinnerungen der Prinzessin Wilhelmine von Preußen - Wilhelmine von Bayreuth - Страница 6
Teil eins – Die Prinzessin von Preußen 1709 – 1732
ОглавлениеTeil eins – Die Prinzessin von Preußen 1709 – 1732
(Siehe auch die Bände in dieser gelben Buchreihe)
Friedrich Wilhelm als Kronprinz
Friedrich Wilhelm, König von Preußen, vermählte sich als Kronprinz im Jahre 1706 mit Sophie Dorothea von Hannover.
Sophie Dorothea
König Friedrich I.
Sein Vater, König Friedrich I., hatte ihm die Wahl zwischen drei Prinzessinnen gelassen: der Prinzessin von Schweden, Schwester Karls XII., der Prinzessin von Sachsen-Zeitz und der Prinzessin von Oranien, Nichte des Fürsten von Anhalt. Dieser Fürst, der sich stets der innigsten Zuneigung des Kronprinzen erfreut hatte, glaubte nicht anders, als dass seine Nichte die Erkorene sein würde. Allein das Herz des Kronprinzen war für die Reize der Prinzessin von Hannover entflammt; er schlug jene drei Partien aus und wusste durch seine Bitten und Intrigen die Einwilligung seines königlichen Vaters zu dieser Ehe zu erlangen.
Ich muss einiges über den Charakter der Hauptpersonen am damaligen Hofe zu Berlin vorausschicken, und besonders über den des Kronprinzen.
Graf Dohna
Dieser Prinz, dessen Erziehung dem Grafen Dohna anvertraut worden war, besitzt alle Eigenschaften, die einen großen Menschen kennzeichnen. Sein Geist ist edel und befähigt ihn zu den größten Taten; er hat eine leichte Auffassungsgabe, viel Urteilskraft und Fleiß und natürliche Güte; von seiner frühesten Jugend an bezeigte er stets eine entschiedene Vorliebe für das Militär; es war seine größte Leidenschaft, und er hat sie vollauf gerechtfertigt, indem er seine Armee in so vortrefflichen Stand setzte. Sein Temperament ist lebhaft und aufbrausend und hat ihn oft zu Gewalttätigkeiten hingerissen, die ihm später die heftigste Reue verursachten. Er neigte mehr zur Gerechtigkeit als zur Milde. Sein Hängen am Gelde war derart, dass man ihn einen Geizhals gescholten hat. Doch kann ihm dies Laster nur betreffs seiner selbst und seiner Familie vorgeworfen werden. Denn seine Günstlinge und die, welche ihm treu gedient hatten, überschüttete er mit Wohltaten.
Die wohltätigen Stiftungen und die Kirchen, die er errichtete, zeugten für seine Frömmigkeit; sie grenzte an Bigotterie. Er liebte weder Pomp noch Luxus. Er war misstrauisch, eifersüchtig und oft falsch. Sein Erzieher hatte sich‘s angelegen sein lassen, ihn zur Verachtung des weiblichen Geschlechts anzuhalten. Er hatte eine so schlechte Meinung von allen Frauen, dass seine Vorurteile der Kronprinzessin, auf die er maßlos eifersüchtig war, viele Kümmernisse bereiteten.
Der Fürst von Anhalt darf als einer der größten Feldherren dieses Jahrhunderts gelten. In allen kriegerischen Dingen sehr erfahren, zeigt er sich auch in anderen Angelegenheiten außerordentlich gewandt. Sein brutales Aussehen ist furchterweckend, und seine Physiognomie entspricht seinem Charakter. In seinem maßlosen Ehrgeiz ist er aller Gewalttaten fähig, um zum Ziele zu gelangen. Er ist seinen Freunden treu, aber ein unversöhnlicher Feind und rachsüchtig bis aufs äußerste jenen gegenüber, die so unglücklich waren, sich seinen Zorn zuzuziehen. Er ist falsch und grausam, jedoch gebildet und angenehm im Verkehr, wenn es ihm beliebt.
Joachim Ernst von Grumbkow
Herr von Grumbkow gehört wohl zu den befähigtsten Ministern, die es seit langem gegeben hat; er ist sehr höflich, geistreich und redegewandt; er ist gebildet und schmiegsam und gefällt vor allem durch seine unerbittliche Spottlust, die ja in unserem Jahrhundert besonders geschätzt wird. Er weiß sich zugleich ernst und angenehm zu zeigen. All diese schönen Außenseiten verbergen ein tückisches, eigennütziges und verräterisches Herz. Sein Privatleben ist ein denkbar ungeregeltes, sein ganzer Charakter nur ein Gewebe von Lastern, die ihn zum Abscheu aller anständigen Leute gemacht haben.
Derart waren die zwei Günstlinge des Kronprinzen. Da beide intelligent und dabei eng befreundet waren, lässt sich leicht denken, dass sie sehr wohl einen verderblichen Einfluss auf das Herz eines jungen Prinzen ausüben, ja einen ganzen Staat umwälzen konnten. Ihren Plan, selbst zu regieren, sahen sie durch die Heirat des Kronprinzen vereitelt.
Leopold von Anhalt Dessau
Der Fürst von Anhalt konnte es der Kronprinzessin nicht verzeihen, dass sie den Sieg über seine Nichte davongetragen hatte. Er fürchtete, dass sie auf das Herz ihres Gemahls allen Einfluss gewinne; und um es zu verhindern, suchte er Zwietracht zwischen ihnen zu säen und machte sich den Hang des Kronprinzen zur Eifersucht zunutze, indem er sie auf seine Gemahlin zu lenken wusste. Die arme Fürstin litt unsäglich unter den Ausbrüchen des Kronprinzen; und ob sie noch so viele Beweise ihrer Tugend an den Tag legte, so vermochte sie doch durch Geduld allein ihn endlich von den Argwohn abzubringen, den man ihm eingeflößt hatte.
Die Prinzessin wurde inzwischen schwanger und genas im Jahre 1707 eines Sohnes. Der Jubel über dies Ereignis wandelte sich bald in Trauer, denn der Prinz starb ein Jahr darauf. Eine zweite Schwangerschaft rief wieder die Hoffnungen des ganzen Landes wach. Die Kronprinzessin gebar am 3. Juli 1709 eine Prinzessin, die sehr ungnädig empfangen wurde, da alles leidenschaftlich einen Prinzen wünschte. Diese Tochter ist meine Wenigkeit. Ich erblickte das Licht zu der Zeit, als die Könige von Dänemark und Polen in Potsdam waren, um den Bundesvertrag wider Karl XII. von Schweden zu unterzeichnen und die Wirren in Polen beizulegen. Diese beiden Monarchen und der König, mein Großvater, waren meine Paten und bei meiner Taufe zugegen, die mit großem Pomp und viel Pracht und Zeremoniell vor sich ging. Man nannte mich Friederike Sophie Wilhelmine.
Der König, mein Großvater, gewann mich bald sehr lieb. Mit eineinhalb Jahren war ich den andern Kindern weit voraus, sprach verständlich deutlich, und mit zwei Jahren ging ich ganz allein. Die Possen, die ich trieb, machten diesem guten Fürsten Spaß, und er unterhielt sich ganze Tage lang mit mir.
Im folgenden Jahre gebar die Kronprinzessin wieder einen Prinzen, der ihr auch wieder entrissen wurde. Eine vierte Schwangerschaft führte im Januar des Jahres 1712 zur Geburt eines dritten Prinzen, der Friedrich genannt wurde. Man übergab uns, meinen Bruder und mich, der Pflege der Frau von Kamecke, Gemahlin des Oberhofmeisters des Königs, seines großen Günstlings. Als aber kurz darauf die Kronprinzessin zum Besuch ihres kurfürstlichen Vaters nach Hannover reiste, wurde ihr von Frau von Kielmannsegge, späteren Lady Arlington, deren Gesellschaftsdame als meine Erzieherin empfohlen. Diese hieß Leti und war die Tochter eines italienischen Mönches, der aus seinem Kloster entflohen war und sich in Holland niedergelassen hatte, wo er den katholischen Glauben abgeschworen; seine Feder verhalf ihm zu einem Unterhalt. Er verfasste die Geschichte von Brandenburg, die vielfach kritisiert wurde, und schrieb das Leben Karls V. und Philipps II.
Seine Tochter hatte sich durch Zeitungskorrekturen ihr Brot verdient. Ihr Geist wie ihr Herz waren italienisch, das heißt sehr lebhaft, sehr schmiegsam und sehr schwarz. Sie war eigennützig, hochfahrend und heftig. Ihre Sitten verleugneten ihre Herkunft nicht, ihre Koketterie zog viele Liebhaber an, die sie nicht vergebens schmachten ließ. Ihre Manieren waren holländisch, das heißt sehr grob; aber sie wusste diese Fehler hinter so schönen Außenseiten zu verbergen, dass sie alle bezauberte, die sie sahen. Die Kronprinzessin ließ sich wie die anderen von ihr blenden und beschloss, sie bei mir als Fräulein anzustellen, jedoch mit der Vergünstigung, mich überallhin begleiten und an meinem Tische essen zu dürfen.
Der Kronprinz hatte seine Gemahlin nach Hannover begleitet. Die Kurprinzessin hatte dort im Jahre 1707 einen Prinzen geboren. Da unsere Jahre sich entsprachen, wollten unsere Eltern die Bande ihrer eigenen Freundschaft befestigen, indem sie uns füreinander bestimmten. Mein kleiner Liebhaber fing sogar damals schon an, mir Geschenke zu schicken, und es verging keine Post, wo sich die beiden Fürstinnen nicht über die zukünftige Vereinigung ihrer Kinder unterhielten. Schon seit einiger Zeit hatte mein Großvater, der König, zu kränkeln angefangen; man hoffte von einer Zeit zur andern, dass seine Gesundheit sich wiederherstellen würde, allein sein äußerst schwacher Organismus vermochte der Schwindsucht nicht lange standzuhalten. Er starb im Februar der Jahres 1713. Als man ihm seinen Tod ankündigte, fügte er sich mit männlicher Resignation in den Ratschluss der Vorsehung. Und als er sein Ende nahen fühlte, nahm er Abschied vom Kronprinzen und von der Kronprinzessin und legte ihnen das Wohl des Landes und seiner Untertanen ans Herz. Er ließ sodann meinen Bruder und mich zu sich rufen und erteilte uns seinen Segen um acht Uhr abends. Sein Tod erfolgte sehr bald nach dieser traurigen Zeremonie. Er verschied am 25., vom ganzen Königreich beklagt und betrauert.
Noch an demselben Tage ließ sich König Friedrich Wilhelm, sein Sohn, über den Bestand der Hofhaltung berichten und reformierte sie von Grund auf, mit der Einschränkung, dass vor der Beisetzung des Königs sich niemand entferne. Über die Pracht jener Trauerfeierlichkeiten will ich schweigen. Sie fanden erst nach einigen Monaten statt. Alles in Berlin nahm jetzt ein anderes Aussehen an. Die, welche bei dem neuen König in Gunst bleiben wollten, nahmen Säbel und Helm: alles wurde militärisch, und es verblieb keine Spur des früheren Hofes. Herr von Grumbkow übernahm die Staatsangelegenheiten und der Fürst von Anhalt die Verwaltung des Heeres. Diese beiden Persönlichkeiten eroberten sich das Vertrauen des jungen Monarchen und halfen ihm die Last der Geschäfte tragen. Das ganze erste Jahr wurde nur damit zugebracht, sie zu ordnen und die Finanzen zu regeln, die durch die beispiellose Verschwendung des verewigten Königs etwas zerrüttet waren.
Wilhelmine und Kronprinz Friedrich
Das folgende Jahr brachte ein neues Ereignis, das für den König und die Königin von großem Interesse war: den Tod der Königin Anna von England. Der Kurfürst von Hannover, durch die Enterbung des Prätendenten oder besser des Sohnes Jakobs II. ihr Nachfolger geworden, begab sich nach England, um den Thron zu besteigen. Der Kurprinz, sein Sohn, begleitete ihn und nahm den Titel Prinz von Wales an. Dieser ließ seinen Sohn, nunmehr Herzog von Gloucester, in Hannover zurück, da er ihn bei seinem zarten Alter nicht der Meerfahrt aussetzen wollte. Die Königin, meine Mutter, gebar um dieselbe Zeit eine Prinzessin, die den Namen Friederike Luise erhielt.
Mein Bruder zeigte sich indessen von sehr zarter Konstitution. Seine Schweigsamkeit wie sein Mangel an Lebhaftigkeit gaben zu berechtigten Besorgnissen für sein Leben Anlass. Seine häufigen Erkrankungen begannen die Hoffnungen des Fürsten von Anhalt aufs Neue zu beleben. Um seinen Einfluss zu befestigen und ihn zu vermehren, überredete er den König, mich seinem Neffen zur Frau zu geben. Dieser Prinz war ein rechter Vetter des Königs.
Kurfürst Friedrich Wilhelm – 1620 – 1688
Kurfürst Friedrich Wilhelm, beider Ahne, hatte zwei Frauen gehabt. Die Prinzessin von Oranien, seine erste Frau, schenkte ihm Friedrich I. und zwei Prinzen, die bald nach ihrer Geburt starben.
Die zweite Gemahlin, Herzogin von Holstein-Glücksburg, Witwe des Herzogs Karl Ludwig von Lüneburg, schenkte ihm fünf Prinzen und drei Prinzessinnen, nämlich Karl, der in Italien auf Befehl seines Bruders, des Königs, vergiftet wurde, Kasimir, der ebenfalls durch eine Prinzessin von Holstein vergiftet wurde, die er zu heiraten sich geweigert hatte, und die Prinzen Philipp, Albert und Ludwig. Der erste dieser drei Prinzen vermählte sich mit einer Prinzessin von Anhalt, Schwester des von mir geschilderten Fürsten. Sie schenkte ihm zwei Söhne und eine Tochter. Als der Markgraf Philipp starb, wurde sein ältester Sohn, der Markgraf von Schwedt, erster Prinz von königlichem Geblüt und nächststehender Thronerbe, falls die königliche Linie erlöschen sollte. In diesem Falle fielen alle Allodialländer und Freilehen mir zu. Da der König nur einen Sohn hatte, stellte ihm der Fürst von Anhalt, von Grumbkow unterstützt, vor, dass es aus politischen Gründen notwendig sei, mich mit seinem Vetter, dem Markgrafen von Schwedt, zu vermählen. Sie gaben vor, dass die zarte Gesundheit meines Bruders wenig Zuversicht für sein Leben gewähre und dass die Königin anfinge, so beleibt zu werden, dass sie schwerlich noch Kinder haben würde; dass der König beizeiten an die Erhaltung seiner Staaten denken müsse, die zerstückelt würden, wenn ich eine andere Partie einginge; und endlich, dass, falls er das Unglück haben sollte, meinen Bruder zu verlieren, sein Schwiegersohn und Nachfolger ihm an Sohnes statt stehen würde.
Der König begnügte sich eine Zeitlang, ihnen unbestimmte Antworten zu geben; aber sie brachten es endlich zuwege, ihn zu Orgien zu verleiten, bei denen er, vom Weine erhitzt, ihren Forderungen nachgab. Es wurde sogar ausgemacht, dass der Markgraf von Schwedt nunmehr Zutritt zu mir haben solle und dass man auf alle erdenkliche Weise versuchen würde, eine Neigung zwischen uns zu erwecken. Die Leti, von der Anhaltschen Clique gewonnen, wurde nicht müde, mir unaufhörlich vom Markgrafen von Schwedt zu sprechen und ihn zu loben, immer mit dem Zusatz, er würde dermal einst ein großer König und es wäre ein großes Glück für mich, wenn ich ihn heiraten könnte.
Dieser Prinz, im Jahre 1700 geboren, war sehr groß für sein Alter. Sein Gesicht ist schön, aber seine Physiognomie mitnichten einnehmend. Obwohl er erst fünfzehn Jahre zählte, zeigte sich schon sein böser Charakter, er war grausam und brutal, hatte rohe Manieren und niedrige Triebe. Ich hatte eine natürliche Abneigung gegen ihn und suchte ihm Streiche zu spielen und ihn zu erschrecken, denn er war ein Hasenfuß. Die Leti verstand hier keinen Spaß und strafte mich streng. Die Königin, welche den Zweck dieser Besuche nicht kannte, litt sie umso bereitwilliger, als ich auch die anderer Prinzen empfing und ihre Besuche bei meinem zarten Alter ohne irgendwelche Konsequenzen schienen. Trotz aller Bemühungen war es den beiden Günstlingen nicht gelungen, zwischen dem König und der Königin Zwietracht zu säen. Obwohl aber der König seine Gemahlin leidenschaftlich liebte, konnte er nicht umhin, sie unbillig zu behandeln, und ließ ihr keinerlei Anteil an staatlichen Dingen. Er verfuhr also, weil, wie er sagte, die Frauen in Zucht gehalten werden müssten, sonst tanzten sie ihren Männern auf der Nase herum.
Es blieb ihr jedoch nicht lange der Plan meiner Verheiratung verborgen. Der König vertraute ihn ihr an, und die Nachricht war für sie wie ein Donnerschlag. Ich muss hier eine Schilderung ihres Charakters und ihrer Person geben. Die Königin ist niemals schön gewesen, ihre Züge sind narbig und haben nichts Klassisches. Ihre Haut ist weiß, ihr Haar dunkelbraun, ihre Figur ist eine der schönsten, die es je gegeben hat. Ihre edle und majestätische Haltung flößt allen, die sie sehen, Ehrerbietung ein; ihre große Weltgewandtheit und ihr glänzender Geist deuten auf mehr Gründlichkeit, als ihr eigen ist. Sie hat ein gutes, großmütiges und mildreiches Herz; sie liebt die schönen Künste und die Wissenschaften, ohne sich allzu sehr mit ihnen befasst zu haben. Jeder hat seine Fehler, und sie ist nicht frei davon. Sie verkörpert allen Stolz und Hochmut ihres Hannoveranischen Hauses. Ihr Ehrgeiz ist maßlos, sie ist grenzenlos eifersüchtig, argwöhnischen und rachsüchtigen Gemütes und verzeiht nie, wo sie sich für beleidigt hält.
Das Bündnis mit England, das sie mittels der Heirat ihrer Kinder geplant hatte, lag ihr sehr am Herzen; sie hoffte, dadurch allmählich Einfluss auf den König zu gewinnen. Zudem suchte sie sich gegen die Ränke des Fürsten von Anhalt einen starken Rückhalt zu schaffen, und endlich strebte sie die Vormundschaft meines Bruders an, für den Fall, dass der König sterben sollte. Er war häufig unpass, und man hatte der Königin versichert, dass er nicht mehr lange leben könnte.
Ungefähr um diese Zeit erfolgte die Kriegserklärung des Königs von Schweden. Die preußischen Truppen begannen im Monat Mai ihren Vormarsch nach Pommern, wo sie sich mit den dänischen und sächsischen Truppen vereinten. Der Feldzug wurde durch die Einnahme der Festung Wismar eröffnet. Die ganze vereinigte Armee, die sich auf 36.000 Mann belief, zog sodann auf Stralsund, um es zu belagern.
Stralsund
Obwohl meine Mutter von neuem schwanger war, folgte sie meinem Vater auf diesem Feldzuge. Die Einzelheiten desselben will ich hier übergehen; er endete siegreich für meinen Vater, den König, der Herr über einen großen Teil von Schwedisch-Pommern wurde. Während der Abwesenheit meiner Mutter wurde ich ausschließlich der Obhut der Leti anvertraut; und der Frau von Roucoulles, die den König erzogen hatte, lag die Erziehung meines Bruders ob.
Marthe de Roucoulle Montbail – 1659 – 1741
Die Leti gab sich unendlich viel Mühe, um meinen Geist zu bilden; sie lehrte mich die Anfangsgründe der Geschichte und Geographie und suchte zugleich mir gute Manieren beizubringen. Die vielen Menschen, die ich sah, halfen dazu, dass ich bald weltgewandt wurde; ich war sehr lebhaft, und jeder unterhielt sich gerne mit mir.
Die Königin war bei ihrer Rückkunft über mein Aussehen sehr erfreut. Die Liebkosungen, mit welchen sie mich überhäufte, verursachten mir solche Freude, dass all mein Blut in Wallung geriet und ich von einem Blutsturz befallen wurde, der mich fast ins Jenseits befördert hätte. Ich erholte mich nur durch ein Wunder von diesem Unfall, der mich auf mehrere Wochen ans Bett fesselte. Kaum war ich genesen, als die Königin meine unerhört schnelle Auffassungsgabe ausnützen wollte; sie teilte mir verschiedene Lehrer zu, u. a. den berühmten La Croze, der sich durch seine Kenntnisse in der Geschichte, den orientalischen Sprachen und allen Gebieten des Altertums einen so großen Ruf erworben hatte. Ein Lehrer folgte dem andern; sie nahmen mich den ganzen Tag in Anspruch und ließen mir nur sehr wenig Zeit zur Erholung übrig. Obwohl fast alle Kavaliere zur Armee gehörten, wurde der Berliner Hof doch sehr gern von Fremden besucht, die sich zahlreich dort einfanden. Die Königin hielt in Abwesenheit des Königs jeden Abend Cercle. Der König befand sich zumeist in Potsdam, einer kleinen Stadt, die vier Meilen von Berlin entfernt liegt. Er lebte dort mehr als Edelmann denn als König; sein Tisch war auf das frugalste bestellt, es gab nur das Nötige.
Seine Hauptbeschäftigung bestand darin, ein Regiment zu drillen, das er zu Lebzeiten Friedrichs I. zu bilden angefangen hatte und das aus sechs Fuß hohen Kolossen bestand. Alle regierenden Häupter Europas trugen bereitwillig zur Rekrutierung desselben bei. Man konnte dies Regiment den Gnadenkanal nennen; denn wer dem König große Soldaten zuführte oder verschaffte, der konnte von ihm verlangen, was er wollte. Nachmittags begab er sich auf die Jagd und verbrachte den Abend in der sogenannten Tabagie mit seinen Generalen.
Zu dieser Zeit befanden sich viele schwedische Offiziere in Berlin, die bei der Belagerung von Stralsund gefangen wurden. Einer dieser Offiziere, namens Cron, war durch seine astrologischen Kenntnisse sehr berühmt. Die Königin verlangte ihn zu sehen. Er weissagte ihr, sie würde von einer Prinzessin entbunden werden. Meinem Bruder weissagte er, dass er einer der größten Fürsten werden, viele Eroberungen machen und als Kaiser sterben würde. Meine Hand erwies sich nicht als so glücklich wie die meines Bruders. Er betrachtete sie lange und sagte kopfschüttelnd, dass mein Leben nur eine Kette widriger Schicksale sein würde, dass ich zwar von vier gekrönten Häuptern, denen Schwedens, Englands, Russlands und Polens, zur Ehe begehrt, aber nie einen König heiraten würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich, wie wir später sehen werden.
Ich kann nicht umhin, hier eine Anekdote zu berichten, die den Leser über Grumbkows Charakter aufklärt und, obwohl sie außer jeder Beziehung zu den Memoiren meines Lebens steht, ihn sicher unterhalten wird. Die Königin hatte unter ihren Damen ein Fräulein von Wagnitz, die um diese Zeit sehr bei ihr in Gunsten stand. Die Mutter dieses Fräuleins stand bei der Markgräfin Albert, der Tante des Königs, in Diensten. Frau von Wagnitz wusste sich mit einem Schein von Frömmigkeit zu umhüllen und führte dabei ein ganz skandalöses Leben. In ihrer Intrigensucht prostituierte sie sich und ihre Töchter an die Günstlinge des Königs und an Einflussreiche Persönlichkeiten, so dass sie auf diese Weise die Staatsgeheimnisse erfuhr, welche sie alsbald an den französischen Gesandten Grafen von Rothenburg verkaufte.
Um ihre Ziele zu erreichen, verbündete sich Frau von Wagnitz mit Herrn Kreutz, einem Günstling des Königs. Dieser Mann war der Sohn eines Landvogtes. Vom Regimentsauditor stieg er zum Rang eines Finanzdirektors und Staatsministers auf. Seine Seele war so niedrig wie seine Geburt; er war ein Ausbund aller Laster. Obwohl sein Charakter große Ähnlichkeiten mit dem Grumbkows hatte, so waren die beiden dennoch geschworene Feinde, weil sie aufeinander eifersüchtig waren. Kreutz genoss die Gunst des Königs, weil er so große Sorge getragen hatte, die Schätze dieses Fürsten zu häufen und seine Einkünfte auf Kosten des armen Volkes zu vermehren. Er war von dem Plan der Wagnitz entzückt, der ganz seinen Absichten entsprach; indem er ihrer Tochter zu der Stellung einer Mätresse des Königs verhalf, sicherte er sich eine Stütze und konnte Grumbkow leicht in Ungnade bringen und allein Einfluss auf den König gewinnen. Er unterwies also die künftige Sultanin, wie sie sich zu verhalten habe, um zu siegen. Er hatte verschiedene Zusammenkünfte mit ihr, wobei er sich stark in sie verliebte. Er war mächtig reich. Die prachtvollen Geschenke, die er ihr gab, entwaffneten gar bald ihren Widerstand, ohne dass sie deshalb ihren eigentlichen Zweck aus dem Auge verlor. Kreutz hatte seine heimlichen Gewährsmänner beim König. Diese Elenden suchten durch mancherlei geschickt angebrachte Worte ihn von der Königin abzubringen. Man pries sogar die Schönheit der Wagnitz in seiner Gegenwart und pochte immer wieder darauf, wie glücklich doch der Mann zu nennen wäre, der ein so reizendes Wesen besitzen dürfte. Grumbkow, der überall seine Spione hatte, blieb nicht lange in Unkenntnis dieser Umtriebe. Er war ganz damit einverstanden, dass der König Mätressen hielt, doch wollte er derjenige sein, der sie ihm zuführte. Er beschloss daher, diese Intrige zu vereiteln und sich derselben Waffen zu bedienen, die Kreutz gewählt hatte, um ihn zu verderben. Die Wagnitz war engelschön, aber ihre Fähigkeiten waren nur untergeordnet. Sie hatte ein ebenso schlechtes Herz wie ihre Mutter, war schlecht erzogen und dabei von unerträglichem Hochmut. Ihre böse Zunge zeigte sich unerbittlich allen gegenüber, die das Unglück hatten, ihr zu missfallen.
Es ist unnütz zu sagen, dass sie nur wenige Freunde besaß. Grumbkow, der sie ausspionieren ließ, erfuhr, dass sie lange Unterredungen mit Kreutz führte, die sich nicht immer um Staatsangelegenheiten drehten. Um Gewissheit zu erlangen, bediente er sich eines Küchenjungen, den er für aufgeweckt genug hielt, um die ihm zugedachte Rolle zu spielen. Er benützte die Zeit, während welcher der König und die Königin sich in Stralsund aufhielten, um seinen Plan ins Werk zu setzen. Eines Nachts, da alles im tiefen Schlaf lag, erhob sich im Schloss ein fürchterlicher Lärm. Alles glaubte, es sei Feuer ausgebrochen, und war nicht wenig überrascht, als es hieß, ein Gespenst habe den ganzen Lärm verursacht. Die Wachen, die vor meiner und meines Bruders Türe Posten standen, waren halbtot vor Schreck und sagten aus, sie hätten gesehen, wie dieses Gespenst der Galerie entlang glitt, welche zu den Gemächern der Hofdamen der Königin führte. Der diensthabende Gardeoffizier verstärkte erst die Posten vor unsern Türen und durchsuchte dann das ganze Schloss, ohne etwas zu finden. Sobald er sich jedoch wieder zurückgezogen hatte, erschien das Gespenst von neuem und erschreckte die Wachen so sehr, dass man sie ohnmächtig fand. Sie sagten, es sei der große Teufel, den die Zauberer aus Schweden sendeten, um den Kronprinzen umzubringen.
Am nächsten Tage war die ganze Stadt in Aufregung; man befürchtete irgendeine Nachstellung der Schweden, die mit Hilfe jenes Gespenstes wohl das Schloss in Brand stecken und meinen Bruder und mich entführen könnten. Man traf also alle Vorsichtsmaßregeln sowohl zu unserm Schutz, wie um das Gespenst zu erhaschen. Erst in der dritten Nacht fing man diesen angeblichen Teufel. Grumbkow wusste durch seinen Einfluss durchzusetzen, dass die Untersuchung durch seine Kreaturen geführt wurde. Er stellte dem König gegenüber die Sache als eine Lappalie hin und brachte ihn dazu, dass dieser Fürst die harte Strafe, die er dem Delinquenten zugedacht hatte, dahin umänderte, dass dieser drei Tage lang in seiner ganzen Gespenstertracht auf dem hölzernen Esel saß. Indes erfuhr Grumbkow durch den vorgeblichen Teufel, just was er wissen wollte, nämlich die nächtlichen Zusammenkünfte der Wagnitz mit Kreutz. Zudem teilte ihm die Kammerfrau dieser Dame, durch Geldgeschenke bestochen, mit, dass ihre Herrin bereits eine Fehlgeburt überstanden habe und gegenwärtig guter Hoffnung sei. Er wartete nur auf die Rückkehr des Königs nach Berlin, um ihm diese Skandalgeschichte zu unterbreiten.
Der König geriet in heftigen Zorn und wollte die Wagnitz auf der Stelle fortjagen, aber die Königin erreichte durch ihre Bitten, dass sie noch eine Weile bleiben dürfe, um unter irgendeinem Vorwand gnädig entlassen zu werden. Der König ließ sich nur ungern dazu überreden und verlangte, dass die Königin ihr jedenfalls noch selbigen Tages ihre Entlassung ankündige. Er vertraute ihr alle Intrigen dieser Person an und ihre Bemühungen, seine Mätresse zu werden. Die Königin ließ sie rufen. Sie hatte für diese Kreatur eine Schwäche, die sie nicht bemeistern konnte. Sie sprach mit ihr in Gegenwart der Frau von Roucoulles, welche die Königin in ihrem Zustand nicht allein lassen wollte, denn sie war schwanger. Die Königin teilte der Wagnitz den Befehl des Königs mit und wiederholte ihr alles, was der König gesagt hatte. Sie müsse sich seinem Willen unterwerfen; „ich werde in drei Monaten niederkommen“, fügte sie hinzu; „gebäre ich einen Sohn, so wird meine erste Sorge sein, Ihre Begnadigung nachzusuchen.“ Weit entfernt, für die Güte der Königin erkenntlich zu sein, wollte die Wagnitz sie kaum zu Ende hören. Dann erklärte sie kurzweg, sie habe mächtige Stützen, die sie wohl verteidigen würden.
Die Königin wollte etwas erwidern; aber diese Person machte ihr eine heftige Szene, indem sie sich in tausend Verwünschungen auf die Königin und das Kind, welches sie unter dem Herzen trug, erging. Ihre Wut steigerte sich derart, dass sie in Konvulsionen geriet. Frau von Roucoulles führte die Königin, die sehr angegriffen war, hinaus. Diese Fürstin wollte den König von diesem Gespräch nicht in Kenntnis setzen, da sie ihn immer noch zu besänftigen hoffte, aber die Wagnitz selbst machte dieser freundlichen Gesinnung ein Ende. Sie ließ am folgenden Tage eine blutige Schmähschrift gegen den König und die Königin anschlagen. Ihre Urheberschaft war bald entdeckt. Der König verstand jetzt keinen Spaß mehr und jagte sie schmählich davon. Ihre Mutter folgte ihr kurz darauf. Grumbkow hinterbrachte dem König ihre Intrigen mit dem französischen Gesandten. Sie musste froh sein, mit der Verbannung davonzukommen und nicht für den Rest ihres Lebens in einer Festung eingesperrt zu werden. Kreutz blieb in Gunst, trotz aller Bemühungen seines Rivalen, ihn zu verderben. Was die Königin betrifft, so tröstete sie sich bald über den Verlust dieser Person. Frau von Blaspiel kam jetzt an ihrer Stelle in die Gunst der Fürstin. Die Königin wurde bald nach dieser hübschen Geschichte von einem Prinzen entbunden. Die Freude war allgemein. Er erhielt den Namen Wilhelm. Dieser Prinz starb im Jahre 1719 an Dysenterie. Die Schwester des Markgrafen von Schwedt vermählte sich in diesem Jahre mit dem Erbprinzen von Württemberg. Die Launen dieser Fürstin tragen Schuld, dass das Herzogtum Württemberg in die Macht der Katholiken fiel.
Ich will von diesem Jahre noch die Erfüllung einer der Prophezeiungen des schwedischen Offiziers berichten. Der Graf Poniatowski kam um diese Zeit inkognito nach Berlin; er war von Karl XII. gesandt. Da der Graf zu dem Großmarschall von Printz, mit welchem er zugleich in Russland als Botschafter akkreditiert war, besonders nahe Beziehungen hatte, wandte er sich an ihn wegen einer geheimen Audienz beim König. Dieser verfügte sich bei anbrechender Dunkelheit zu Herrn von Printz, der damals im Schlosse wohnte. Herr von Poniatowski wartete mit sehr vorteilhaften Anträgen vonseiten des schwedischen Hofes auf und schloss mit dem König einen Vertrag, der stets so geheimgehalten wurde, dass ich nur zwei Artikel daraus erfahren konnte. Der erste war, dass der König von Schweden Schwedisch-Pommern dem König abtreten und dass dieser hingegen eine sehr beträchtliche Summe als Entschädigung zahlen würde. Der zweite Artikel betraf den Beschluss meiner Vermählung mit dem schwedischen Monarchen; und es wurde beantragt, dass ich mit zwölf Jahren nach Schweden gebracht werden sollte, um dort erzogen zu werden.
Ich habe bisher nur Tatsachen berichten können, die mich nicht persönlich betrafen. Ich zählte erst acht Jahre. Mein zu zartes Alter gestattete mir keinen Anteil an den Dingen, die sich zutrugen. Ich war den ganzen Tag von meinen Lehrern in Anspruch genommen, und meine einzige Erholung war, mit meinem Bruder zusammen zu sein. Nie haben sich Geschwister so zärtlich geliebt. Er war geistreich, seine Gemütsart war finster. Er dachte lange nach, bevor er antwortete, aber dafür antwortete er richtig. Er lernte sehr schwer, und man erwartete, dass er einmal mehr Verstand als Geist an den Tag legen würde. Ich war hingegen außerordentlich lebhaft und schlagfertig und besaß ein erstaunliches Gedächtnis; der König liebte mich mit Leidenschaft. Keinem seiner andern Kinder zeigte er sich so aufmerksam wie mir. Meinen Bruder hingegen konnte er nicht leiden und malträtierte ihn, wo er seiner ansichtig wurde, so dass er ihm eine unüberwindliche Furcht einjagte, die sich bis ins Alter der Vernunft hinein erhielt.
Der König und die Königin machten eine zweite Reise nach Hannover.
Hannover Herrenhausen
Der König von Schweden und der von Preußen hatten reiflich über die Heirat nachgedacht, die ihre Häuser vereinen sollte, und eingesehen, dass der Altersunterschied ein allzu großer war, so dass sie den Plan fallen zu lassen beschlossen. Der König von Preußen nahm sich vor, jenen schon früher gefassten Heiratsplan mit dem Herzog von Gloucester von neuem aufzunehmen.
König Georg I. von England zeigte sich mit Freuden bereit, doch wünschte er, dass eine Doppelheirat die Bande ihrer Freundschaft noch enger verknüpfe, nämlich, dass mein Bruder die Prinzess Amalie, zweite Schwester des Herzogs von Gloucester, heimführe. Diese Doppelheirat wurde zur großen Befriedigung meiner Mutter beschlossen, deren langgehegter Wunsch hiermit erfüllt werden sollte. Sie übergab uns, meinem Bruder und mir, die Verlobungsringe. Ich trat sogar mit meinem kleinen Liebhaber in Korrespondenz und empfing mehrere Geschenke von ihm. Die Intrigen des Fürsten von Anhalt und Grumbkows bestanden immer fort. Die Geburt meines zweiten Bruders hatte ihre Pläne zwar stören, aber nicht vernichten können. Nur war es nicht an der Zeit, ihnen Folge zu geben.
König Georg I. von England
Die neue Allianz des Königs mit England schien ihnen kein sonderlich großes Hindernis. Da die Interessen des Hauses Brandenburg und des Hauses Hannover stets entgegengesetzte waren, so dachten sie gleich, dass ihr Bund nicht von langer Dauer sein würde. Das Temperament des Königs kannten sie von Grund aus und wussten, wie leicht er sich erregen ließ und dass der König nicht politisch handelte, wenn er in Leidenschaft geriet. Sie nahmen sich daher vor, ruhig abzuwarten, bis eine Gelegenheit sich böte, die ihren Projekten günstig wäre. In diesem Jahre entdeckte man eine geheime Verschwörung, die ein gewisser Clément angezettelt hatte. Er wurde der Majestätsbeleidigung angeklagt und überdies beschuldigt, die Unterschriften verschiedener mächtiger Fürsten gefälscht und Zwietracht zwischen den verschiedenen Großmächten gesät zu haben. Dieser Clément befand sich im Haag und hatte mehrmals an den König geschrieben. Sein schlechtes Gewissen hielt ihn dort zurück, und es gelang dem König nicht, ihn nach seinem Lande zu locken. Endlich wandte er sich an einen kalvinistischen Geistlichen namens Gablonski, um jenes Menschen habhaft zu werden. Gablonski, der mit ihm studiert hatte, begab sich nach Holland und wusste ihm so viel von der freundlichen Aufnahme und den Ehren, die ihm der König zugedacht habe, zu erzählen, dass er ihn endlich dazu brachte, mit nach Berlin zu kommen. Sobald Clément den Fuß über die Grenze gesetzt hatte, wurde er verhaftet. Man glaubte stets, dass dieser Mann von hoher Abkunft sei; die einen hielten ihn für einen natürlichen Sohn des Königs von Dänemark, und die andern für den des Herzogs von Orleans, Regenten von Frankreich. Die große Ähnlichkeit, die er mit letzterem Prinzen hatte, machte, dass man zu dieser Annahme neigte. Man begann mit seinem Prozess, sobald er in Berlin anlangte. Es wird behauptet, dass er dem König alle Intrigen Grumbkows enthüllt und sich angeboten habe, seine Beschuldigung durch Briefe dieses Ministers, die er dem König übergeben wollte, zu beweisen. Grumbkow stand am Rande seines Verderbens. Aber zum Glück für ihn vermochte Clément die bewussten Briefe nicht vorzuweisen; daher wurde seine Anklage als Verleumdung angesehen. Die Einzelheiten seines Prozesses blieben stets so geheim, dass ich davon nur das wenige, was ich eben niederschrieb, erfahren konnte.
Der Prozess zog sich sechs Monate lang hin, dann wurde das Urteil gesprochen. Er sollte zu drei Malen der Zangentortur unterworfen und dann gehängt werden. Mit heroischer Festigkeit und ohne eine Miene zu verziehen, vernahm er seine Verurteilung. „Der König“, sprach er, „ist Herr über mein Leben und meinen Tod. Ich habe diesen nicht verdient, sondern nur getan, was die Gesandten des Königs täglich gleichfalls tun. Sie suchen die Vertreter der andern Fürsten zu betrügen und zu übervorteilen und sind weiter nichts als ehrliche Spione ihrer Regierung. Wäre ich nur wie sie akkreditiert gewesen, so stünde ich jetzt wohl auf dem Gipfel meines Glückes, statt auf der Höhe eines Galgens meinen Wohnsitz zu finden.“ Seine Standhaftigkeit verleugnete sich nicht bis zu seinem letzten Seufzer. Er darf unter die großen Geister gezählt werden; er wusste viel, sprach mehrere Sprachen und fesselte durch seine Beredsamkeit. Sie kam so recht in einer Ansprache zur Geltung, die er an das Volk hielt. Da sie gedruckt wurde, übergehe ich sie hier. Leman, einer seiner Mitschuldigen, wurde gevierteilt. Sie hatten noch einen andern Unglücksgefährten, der für ein anderes Verbrechen als das ihre bestraft wurde. Er nannte sich Heidekamm und war unter Friedrich I. geadelt worden. Er hatte gesagt und geschrieben, dass der König kein legitimer Sohn sei. Er wurde verurteilt, vom Henker ausgepeitscht zu werden, für degradiert erklärt und auf den Rest seiner Tage in Spandau eingesperrt.
Während der Haft Cléments erkrankte der König in Brandenburg an einer gefährlichen Nierenkolik und heftigem Fieber. Er schickte sofort eine Stafette nach Berlin, um die Königin zu sich zu berufen. Die Fürstin machte sich alsbald und so eilig auf, dass sie noch am selben Abend in Brandenburg anlangte.
Brandenburg
Der Zustand des Königs hatte sich sehr verschlimmert. Er war überzeugt, dass er sterben würde, und machte sein Testament; diejenigen, denen er seinen letzten Willen diktierte, waren Leute von erprobter Ehrenhaftigkeit und Treue. Er setzte darin die Königin zur Regentin des Landes während der Minderjährigkeit meines Bruders ein, und den Kaiser und den König von England zu Vormündern des jungen Fürsten. Grumbkow wie der Fürst von Anhalt blieben darin aus mir unbekannten Gründen unerwähnt. Er hatte ihnen jedoch einige Stunden vor der Ankunft der Königin eine Stafette geschickt mit der Order, sich zu ihm zu verfügen. Ich weiß nicht, welcher Zwischenfall ihre Abreise verzögerte. Der König hatte sein Testament nicht unterzeichnet; vermutlich hatte er sie berufen, um es ihnen mitzuteilen und vielleicht einige sie betreffende Klauseln hinzuzufügen. Er war so gereizt über ihre Verspätung, und seine Krankheit hatte sich so verschlimmert, dass er nicht mehr zögerte, es zu unterschreiben. Die Königin erhielt eine Abschrift davon, und das Original wurde in das Berliner Archiv gebracht. Kaum war die Urkunde vollzogen, als der König ruhiger wurde; sein Generalarzt Holtzendorff (Ernst Konrad 1688 – 1751) verordnete ihm noch im rechten Augenblick ein damals sehr beliebtes Medikament: die Brechwurzel. Dies Mittel rettete ihm das Leben. Fieber und Schmerzen ließen bis zum Morgen wesentlich nach, so dass alle Hoffnung für seine Genesung bestand. Von da ab datiert Holtzendorffs Glück und seine Gunst beim König, auf die ich später zu sprechen kommen werde.
Der Fürst von Anhalt und sein Spießgeselle kamen indes gegen Morgen an. Der König geriet in große Verlegenheit, da er ihrerseits heftiger Vorwürfe gewärtig war, weil er sie im Testamente nicht erwähnt hatte. Und er wusste sich nicht anders zu helfen, als indem er der Königin, den Zeugen und jenen, die das Testament ausfertigten, den Schwur abnahm, über den Inhalt ewiges Schweigen zu bewahren.
Trotz aller Vorkehrungen, die der König getroffen hatte, erfuhren die beiden Interessenten sehr bald, was sich zugetragen hatte. Dass man ihnen ein solches Geheimnis daraus machte, konnte ihnen die Wahrheit des Vorgangs nur bestätigen, umso mehr, als sie vernahmen, dass eine Abschrift des Testamentes in Händen der Königin wäre. Es war für sie ein vernichtender Schlag. Die Krankheit des Königs hatte sich gebessert, doch war er noch nicht außer Gefahr. Sie wagten nicht, ihm von der Sache zu sprechen; jede Gemütserregung hätte ihm das Leben kosten können. Aber ihre Sorge legte sich bald; das Übel besserte sich so schnell, dass er nach acht Tagen vollständig hergestellt war. Sobald er ausgehen konnte, fuhr er nach Berlin zurück. Von dort begab er sich nach Wusterhausen, wohin ihm die Königin folgte. Er wurde jetzt von Tag zu Tag misstrauischer und argwöhnischer. Seit der Enthüllung der Clémentschen Intrigen ließ er sich alle Briefe vorzeigen, die in Berlin ein- und ausliefen, und legte sich nicht mehr zu Bett, ohne seinen Degen und ein Paar geladene Pistolen neben sich zu haben.
Der Fürst von Anhalt und Grumbkow konnten keinen Schlaf finden; die Testamentsgeschichte ging ihnen so stark im Kopfe herum, da sie ihre früheren Pläne noch nicht aufgegeben hatten. (Mit der Gesundheit des Königs und der meines Bruders war es damals nicht wohl bestellt, und mein zweiter Bruder lag in der Wiege.) Ihre Tücke ließ sie auf Mittel und Wege sinnen, um den Inhalt dieses wichtigen Schriftstückes zu erfahren und es vielleicht den Händen der Königin zu entreißen; gelang ihnen dies, so würden sie es sicher dahinbringen, dass das Testament für ungültig erklärt, der König endgültig mit der Königin entzweit würde und ihre Pläne gelängen. Sie fingen es folgendermaßen an: Ich habe schon den neuen Günstling der Königin, Frau von Blaspiel, erwähnt. Sie konnte für eine Schönheit gelten; ihr gründlicher und lebhafter Verstand erhöhte noch die Reize ihrer Person.
Ihr Herz war edel und aufrichtig, aber zwei große Fehler, die unglücklicherweise den meisten Frauen anhaften, verdunkelten ihre schönen Eigenschaften: sie war kokett und neigte zur Intrige. Ein sechzigjähriger gichtiger und unangenehmer Gatte war auch nicht eben etwas Verlockendes für eine junge Frau. Viele Leute behaupteten sogar, sie habe mit ihm gelebt wie die Kaiserin Pulcheria mit dem Kaiser Marcian. Der Graf von Manteuffel, sächsischer Gesandter am preußischen Hofe, hatte ihr Herz zu rühren vermocht. Sie hatten ihr Liebesverhältnis so geheimzuhalten gewusst, dass man bisher nicht den leisesten Zweifel an der Tugend der Dame gehegt hatte. Der Graf verreiste auf kurze Zeit nach Dresden. Um sich für die Trennung von der Geliebten zu trösten, schrieb er ihr mit jeder Post, und sie antwortete ihm. Diese unheilvolle Korrespondenz stürzte Frau von Blaspiel ins Unglück; ihre Briefe wie die ihres Geliebten fielen in die Hände des Königs.
Dieser witterte in seinem Argwohn eine Staatsintrige und berief Grumbkow zu sich, der als der Erfahrene in Liebesfragen sofort den wahren Sachverhalt vermutete. Doch ließ er sich nichts merken, denn dieser Zwischenfall kam ihm wie gerufen. Er war mit Manteuffel eng befreundet und beim König von Polen sehr in Gunst. Dieser Fürst hatte allen Grund, sich mit dem Berliner Hofe gutzustellen.
Karl XII. von Schweden
Karl XII. von Schweden lebte noch, so dass stets neue Revolutionen in Polen zu befürchten waren; mit Hilfe meines Vaters konnte er sich dagegen schützen. Grumbkow versprach ihm die Unterstützung seines Ministeriums und sagte zu, stets zwischen den zwei Höfen volles Einverständnis zu erhalten, sofern der König von Polen auf seine Pläne eingehen und den Grafen von Manteuffel dementsprechend anweisen wollte. Der König zögerte nicht, seine Beistimmung zu geben, und schickte diesen Gesandten nach Berlin zurück. Grumbkow rückte jetzt mit der ganzen Testamentsgeschichte heraus und sagte ihm sogar, dass er von seinem Verhältnis zu Frau von Blaspiel wisse; man wünsche nun von ihm, er möge die Dame veranlassen, das Testament des Königs den Händen der Königin zu entziehen. Es war eine schwierige Angelegenheit. Manteuffel wusste, wie treu sie der Königin ergeben war. Dennoch wagte er‘s, ihr davon zu sprechen. Frau von Blaspiel brachte es nur schwer übers Herz, seinen Wunsch zu erfüllen; aber die Liebe zu Manteuffel ließ sie endlich vergessen, was sie sich selbst und ihrer Gebieterin schuldig war. Durch seine Versicherungen, wie treu er selbst der Königin ergeben sei, geblendet, glaubte Frau von Blaspiel, dass die Sache nicht von großer Bedeutung sei; sie wusste wohl, wie gänzlich sie das Herz der Königin beherrschte, und bald diese, bald jene Saiten aufziehend, vermochte sie sie endlich zu überreden, ihr das unselige Schriftstück anzuvertrauen, jedoch unter der Bedingung, es ihr, sobald sie es gelesen haben würde, zurückzugeben. –
Sobald sich der Graf von Manteuffel im Besitze des Testamentes sah, machte er eine Abschrift davon, die er Grumbkow übermittelte. Dieser fand seinen Wunsch nur zur Hälfte erfüllt. Worauf er ausging, war das Original. Doch gab er die Hoffnung nicht auf, es mit der Zeit doch noch zu erlangen, falls er geschickt zu Werke ging.
Die Königin fing an, Einfluss auf den König zu gewinnen. Sie verhalf ihm zu Rekruten für sein Regiment; und der König von England überhäufte ihn mit Aufmerksamkeiten. Die kalte Zurückhaltung, mit welcher der König das Drängen des Fürsten von Anhalt und Grumbkows betreffs meiner Vermählung mit dem Markgrafen von Schwedt entgegennahm, hatte ihnen bewiesen, dass seine Gunst nicht mehr dieselbe war. Mehrere Umstände halfen noch, sie in dieser Meinung zu bestärken. Der König zeigte sich nur noch selten in der Öffentlichkeit; er litt an einer Art Hypochondrie, die ihn melancholisch stimmte; er sah nur die Königin und ihre Kinder und speiste allein mit uns. Um ihrer Ungnade vorzubeugen, unternahmen sie es, den Einfluss der Königin zu untergraben. Aus dem Bilde, das ich vom König entwarf, konnte man ersehen, dass er leicht erregbar war und dass zu seinen Hauptfehlern sein starker Hang zum Gelde gehörte. Grumbkow wollte diese Schwäche ausnützen. Er teilte seinen Plan dem Staatsminister von Kamecke mit. Aber dieser ehrenwerte Mann ließ die Königin warnen. Sie liebte das Spiel und hatte beträchtliche Summen dabei verloren, weshalb sie heimlich ein Kapital von 30.000 Talern geliehen hatte. Vom König war sie kürzlich mit einem Paar durchbrochener Diamant-Ohrgehänge von großem Werte beschenkt worden. Sie trug sie nur selten, da sie dieselben mehrmals verloren hatte. Grumbkow, der überall seine Spione besaß, wusste bald von dem schlechten Stand ihrer finanziellen Angelegenheiten, und in der Vermutung, dass sie diese Ohrgehänge verpfändet hätte, um das Kapital, von dem ich sprach, zu erhalten, beschloss er, es dem König zu hinterbringen, wohl wissend, dass ihm dies höchst empfindlich sein würde. Die Königin verfehlte nicht, den König zu warnen und ihm ihre – Beschuldigungen, die man gegen sie zu erheben suchte. Über Grumbkows hässliche Schliche empört, beschwor sie den König, ihr Genugtuung zu verschaffen. Und auf seine Antwort, man könne niemand ohne hinreichenden Beweis bestrafen, beging sie die Unvorsichtigkeit, ihm einzugestehen, dass Herr von Kamecke es gewesen sei, der sie hatte warnen lassen. Der König ließ ihn alsbald rufen. Die freundliche Aufnahme, die er bei ihm fand, ermutigte ihn, bei den Aussagen, die er der Königin erstattet hatte, zu beharren. Er fügte ihnen sogar einige für Grumbkow sehr gravierende Einzelheiten hinzu. Da er jedoch nur durch seine Gespräche, die er ohne Zeugen mit ihm geführt, Kenntnis von seinen Plänen erlangt hatte, so gab die Ableugnung des andern den Ausschlag, und Kamecke wurde nach Spandau geschickt.
Diese Festung, die nur vier Meilen von Berlin entfernt liegt, füllte sich bald darauf mit vornehmen Gefangenen. Ein schlesischer Edelmann, namens Troski, war soeben verhaftet worden. Während der Belagerung von Stralsund war er als Spion im schwedischen Lager tätig gewesen. Obwohl er dem König Dienste erwiesen hatte, konnte dieser Fürst ihn nicht leiden und hegte gegen ihn ein heimliches Misstrauen. Er stand im Verdacht, in Berlin dieselbe Rolle zu spielen, die er im schwedischen Lager vertreten hatte. Seine Papiere, die beschlagnahmt wurden, bestätigten dies einigermaßen. Troski war ein höchst geistreicher Mann, der sehr hübsch zu schreiben verstand; diese beiden Talente ersetzten ihm die äußeren Gaben. In seiner Kassette fanden sich alle Liebesanekdoten des Hofes vor, über die er eine sehr beißende Satire verfasst hatte, und eine Menge Briefe mehrerer Damen Berlins, in denen des Königs nicht geschont wurde. Die der Frau von Blaspiel zeugten besonders stark gegen ihn, sie nannte ihn darin einen Tyrannen und abscheulichen „Skriblifax“. Grumbkow, der zur Durchsicht dieser Papiere berufen wurde, ergriff diese Gelegenheit, um die Dame zu stürzen. Er hatte ihr zum Teil seine Pläne anvertraut, in der Hoffnung, sie auf seine Seite zu bringen und das Testament des Königs durch sie zu erlangen. Frau von Blaspiel, die seine Absichten durchschaut hatte, hielt ihn mit falschen Versprechungen hin und wusste ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Da ihr die genügenden Beweise fehlten und Kameckes Unglück frisch in aller Gedächtnis stand, wagte sie sich mit ihren Enthüllungen nicht an den König heran, bevor ihr keine unwiderlegbaren Beweise zu Gebote standen. Grumbkow gab indes ihre Briefe an Troski dem König zu lesen und brachte ihn stark gegen sie auf. Der Fürst ließ sie holen, sagte ihr sehr harte Dinge ins Gesicht und zeigte ihr dann jene fatalen Briefe. Sie ließ sich nicht verblüffen – [Textstelle fehlt im Original] von ihrer Hand, und dass ihr Inhalt echt sei; sie nahm diese Gelegenheit wahr, ihm alle seine Fehler vorzuwerfen, und fügte hinzu, dass sie ihm, allem was sie gegen ihn geschrieben habe zum Trotz, treuer ergeben sei als alle andern; wäre sie doch die einzige, die es wage, offen und aufrichtig mit ihm zu sprechen. Ihre von Geist und Energie getragenen Worte machten Eindruck auf den König. Er blieb eine Weile nachdenklich: „Ich verzeihe Ihnen“, sagte er dann, „und bin Ihnen verbunden, denn Sie haben mich überzeugt, dass Sie meine wahrhafte Freundin sind, indem Sie mir die Wahrheit sagten; vergessen wir beide, was vergangen ist, und seien wir Freunde.“ Dann reichte er ihr die Hand und führte sie zur Königin. „Hier“, sagte er, „ist eine gerade Natur, vor der ich die größte Achtung habe.“ Frau von Blaspiel jedoch fühlte sich nicht beruhigt. Sie kannte alle Einzelheiten des schrecklichen Komplotts, das der Fürst von Anhalt und Grumbkow gegen den König und meinen Bruder im Schilde führten. Sie sah es zur Reife gelangen und wusste nicht, welchen Entschluss sie fassen sollte; zu schweigen schien ihr ebenso gefährlich wie zu reden. Aber es ist an der Zelt, dies furchtbare Geheimnis zu enthüllen. Die Pläne der beiden Spießgesellen gingen dahin, den Markgrafen von Schwedt auf den Thron zu setzen und die ganze Regierung an sich zu reißen.
Die Gesundheit des Königs sowie die des Kronprinzen befestigte sich von Tag zu Tag, und dadurch wurden die angenehmen Aussichten, die sich die Ränkeschmiede von dem baldigen Ableben beider versprachen, in die Ferne gerückt. Sie beschlossen, nun selbst einzugreifen. Es war eine gewagte Sache, sie setzten ihr Leben dabei ein; und sie warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, um ihren teuflischen Plan auszuführen. Sie bot sich ihnen wie nach Wunsch. Es hielt sich seit einiger Zeit eine Seiltänzertruppe in Berlin auf, welche deutsche Komödien in einem recht hübschen, am Neuen Markte errichteten Theater aufführte. Der König fand viel Vergnügen daran und besuchte es ständig. Diesen Schauplatz wählten sie für ihre scheußliche Tragödie. Es galt, meinen Bruder dorthin zu ziehen, um zwei Opfer ihrer niederträchtigen Herrschsucht preiszugeben. Um jeden Verdacht von ihnen abzulenken, sollten gleichzeitig das Theater wie das Schloss in Brand gesteckt und mein Vater und mein Bruder während der unvermeidlichen Verwirrung, welche die Feuersbrunst hervorrufen würde, erdrosselt werden; denn das Haus, in dem gespielt wurde, war aus Holz, nur mit sehr engen Ausgängen versehen und stets so überfüllt, dass man sich nicht rühren konnte, was ihr Vorhaben begünstigte. Ihre Partei war so stark, dass sie sich der Regierung in Abwesenheit des Markgrafen von Schwedt, der noch in Italien war, sicherlich bemächtigen würden; denn die Armee stand dem Fürsten von Anhalt als oberstem Befehlshaber zu Gebote, und er war bei ihr sehr beliebt.
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Manteuffel, dem vor der furchtbaren Verschwörung graute, sie der Frau von Blaspiel enthüllte und ihr den Tag nannte, an dem sie ausbrechen sollte. Ich erinnere mich sehr wohl – Grumbkow drang in ihn, er möge doch meinen Bruder mit in die Komödie nehmen, unter dem Vorwand, dass man ihn aufheitern und durch Vergnügungen zerstreuen müsse. Es war am Mittwoch. Am darauffolgenden Freitag sollte der Plan zur Ausführung gelangen. Der König hatte ihre Einwendungen begründet gefunden und seine Einwilligung gegeben. Frau von Blaspiel, die zugegen war und von ihrem Vorhaben wusste, erbebte. Da sie nicht länger schweigen konnte, suchte sie der Königin Angst zu machen, ohne ihr doch zu sagen worum es sich handelte, und riet ihr, um jeden Preis zu verhindern, dass mein Bruder dem König folge. Die Königin, welche die Furchtsamkeit meines Bruders kannte, flößte ihm solche Angst vor dem Schauspiel ein und brachte ihn so weit, dass er vor Schrecken weinte, wenn man nur davon sprach.
Als der Freitag gekommen war, befahl mir die Königin, nachdem sie mich mit Zärtlichkeiten überschüttet hatte, den König zu unterhalten, damit er die Stunde, die für die Komödie angesetzt war, vergesse, sie fügte hinzu, dass, wenn es mir nicht gelänge und der König meinen Bruder mit sich nehmen wolle, ich schreien und weinen und ihn womöglich zurückhalten müsste. Um den Eindruck zu erhöhen, sagte sie mir, dass mein Leben und das meines Bruders auf dem Spiele stehe. Ich hielt mich so brav, dass es halb sieben Uhr wurde, ohne dass es der König gewahrte, plötzlich besann er sich aber, stand auf und ging schon, seinen Sohn an der Hand führend, auf die Türe zu, als dieser sich zu sträuben und schrecklich zu schreien anfing. Der König, sehr verwundert, suchte ihn erst in Güte zu bereden, da es aber nichts half und das arme Kind ihm nicht folgen wollte, wollte er es schlagen. Die Königin widersetzte sich, allein der König hob ihn in seine Arme und wollte ihn mit Gewalt davontragen. Ich aber warf mich ihm nun zu Füßen und umschlang sie unter tausend Tränen. Die Königin stellte sich vor die Türe und beschwor ihn, heute im Schloss zu bleiben. Der König, über dies seltsame Gebaren sehr erstaunt, wollte die Ursache desselben wissen. Die Königin wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Aber der von Natur aus argwöhnische König schloss, dass irgendeine Verschwörung gegen ihn im Werke sei. Troskis Prozess war noch nicht beendet; er dachte, dass diese Angelegenheit die Besorgnis der Königin hervorriefe. Da er also heftig in sie drang, ihm alles zu sagen, begnügte sie sich, ihm zu erwidern, dass sein Leben wie das meines Bruders gefährdet sei, ließ jedoch Frau von Blaspiel unerwähnt. Als diese Dame sich abends bei der Königin einfand, glaubte sie, dass nach der Szene, die sich zugetragen hatte, sie nicht länger schweigen könne. Sie vertraute ihr das ganze Komplott an und bat sie dringend, ihr für den nächsten Tag zu einer geheimen Audienz beim König zu verhelfen. Es fiel der Königin leicht, sie zu erlangen. Als Frau von Blaspiel dem König alle Einzelheiten mitteilte, von denen sie Kenntnis hatte, fragte er sie, ob sie dies alles auch in Grumbkows Gegenwart aufrechterhalten würde; und als sie dies bejahte, wurde der Minister gerufen. Der hatte seine Vorsichtsmaßregeln längst getroffen und keinen Grund, etwas zu befürchten. Der Generalfiskal Katsch, ein Mann von niederer Herkunft, verdankte ihm sein Glück. Er war der würdige Schützling Gumbkows, das lebendige Abbild des ungerechten Richters aus dem Evangelium und von allen ehrlichen Leuten verabscheut. Grumbkow hatte außerdem zahlreiche Kreaturen in der Justiz und in den Kanzleien. So erschien er dreist vor dem König, der ihm die Aussagen der Frau von Blaspiel bekanntgab. Er beteuerte seine Unschuld und rief, man könne wahrlich nicht Minister sein, ohne sich Verfolgungen ausgesetzt zu sehen, und es ginge ja aus den Briefen der Frau von Blaspiel an Troski zur Genüge hervor, dass dieser Dame nichts so sehr am Herzen läge, wie zu intrigieren und am Hofe Zwist zu erregen. Er warf sich dem König zu Füßen, beschwor ihn, die Angelegenheit mit aller Schärfe und ohne Rücksicht untersuchen zu lassen, und erbot sich, den untrüglichen Beweis für die Falschheit der Beschuldigungen aufzubringen. Der König ließ sodann Katsch rufen, wie Grumbkow richtig vorausgesehen hatte. Trotz aller Spitzfindigkeiten sah sich dieser doch am Rande seines Verderbens; Kasch wusste es von ihm abzuwehren. Er besaß eine erstaunliche Geschicklichkeit im Überführen der Übeltäter, die das Unglück hatten, ihn zum Richter zu haben. Vorsichtige Fragen und schlaue Umschweife setzten sie bald in Verwirrung. Frau von Blaspiel fiel ihnen zum Opfer. Sie vermochte keine untrüglichen Beweise für ihre Anklagen aufzubringen, die infolgedessen als Verleumdungen galten. Da Katsch den König in heftigem Zorn sah, riet er ihm, ihr die Folter aufzuerlegen. Doch behielt der König so viel Rücksicht für ihren Rang und ihr Geschlecht, dass sie von dieser Schmach verschont blieb.
Er begnügte sich, sie noch am selben Abend nach Spandau zu schicken, wohin Troski einige Tage später abgeführt wurde. Sie ertrug dies Missgeschick mit heldenhaftem Mut. Anfangs wurde sie mit Strenge und Härte behandelt. In einem vergitterten, feuchten Zimmer ohne Bett noch Möbel eingesperrt, verbrachte sie drei Tage lang, indem sie nur so viel erhielt, als zum Leben unumgänglich nötig war. Obwohl die Königin sich in guter Hoffnung befand, schonte der König ihrer nicht und teilte ihr in rücksichtsloser Weise die Ungnade ihrer Vertrauten mit. Jene wurde davon so betroffen, dass eine Fehlgeburt befürchtet wurde. Abgesehen von der Zuneigung, die sie für Frau von Blaspiel hegte, erfüllte sie der Gedanke, dass das Testament in den Händen dieser Dame geblieben war, mit tödlicher Angst. Ein glücklicher Zwischenfall befreite sie von dieser Sorge.
Der Hofmarschall von Natzmer, ein Mann von hohem Verdienst und anerkannter Rechtlichkeit, erhielt Befehl, bei Frau von Blaspiel die Siegel anzulegen. Die Königin wandte sich an ihren Kaplan, namens Boshart, um den Marschall von ihrer Sorge in Kenntnis zu setzen und ihn zu bitten, ihr doch um Gottes willen das Testament des Königs auszuliefern. Der Kaplan schilderte ihm die Gefahr, in der die Fürstin sich befand, wenn man das Dokument vorfände, und entledigte sich seiner Aufgabe so gut, dass er den Marschall überredete, dem Wunsche der Königin zu willfahren; was den Plänen Grumbkows sehr zuwider lief. Man fand nichts Verdächtiges unter den Papieren der Frau von Blaspiel und stellte weitere Untersuchungen ein.
Ich habe alle Einzelheiten, die ich hier berichtete, von meiner Mutter, der Königin, vernommen; sie sind nur sehr wenigen bekannt. Die Königin hatte eifrig Sorge getragen, sie zu verheimlichen, und mein Bruder hat seit seiner Thronbesteigung alle Akten des Prozesses verbrannt. Frau von Blaspiel wurde nach einem Jahre in Freiheit gesetzt, jedoch nach Kleve verbannt. Der König sah sie einige Jahre später wieder, begegnete ihr mit großer Zuvorkommenheit und verzieh das Vergangene. Nach seinem Tode berief sie mein Bruder aus Rücksicht auf die Königin zur Erzieherin meiner beiden jüngeren Schwestern, ein Posten, den sie noch heute innehat.
All jene Intrigen, die sich Schlag auf Schlag in Berlin abspielten, hatten aber doch zuletzt den König verdrossen. Er war zu klug, um nicht einzusehen, dass der Fürst von Anhalt und Grumbkow nicht ganz unschuldig sein konnten. So wollte er denn allen Umtrieben ein für alle Mal ein Ende machen und beschloss, den Markgrafen von Schwedt zu verheiraten. Sein enges Bündnis mit Russland ließ ihn nach dieser Seite hin das Auge lenken. Herr von Martenfeld, sein Gesandter in Petersburg, erhielt den Auftrag, um die Herzogin von Kurland (der späteren Kaiserin) für den Prinzen anzuhalten. Der Zar zeigte sich diesem Projekte sehr geneigt. Der Markgraf von Schwedt wurde also aus Italien, woselbst er zu der Zeit verweilte, zurückberufen. Nach seiner Ankunft in Berlin ließ ihm sodann der König den Antrag kundtun und ihm vorstellen, wie vorteilhaft diese Heirat sei und wie geeignet, seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Allein dieser Prinz, der noch immer eine Vermählung mit mir erhoffte, weigerte sich entschieden, dem Wunsch des Königs zu willfahren. Da er achtzehn Jahre alt und mündig war, konnte man ihn nicht zum Gehorsam zwingen, und so ließ man die Sache fallen.
Zar Peter
Ich vergaß, von dem Besuche Peters des Großen in Berlin zu erzählen, der sich im Jahre zuvor ereignete. Was sich da zutrug, ist merkwürdig genug, um in diese Memoiren aufgenommen zu werden. Der Zar, der sehr gerne auf Reisen ging, kam aus Holland. Er hatte sich in Kleve wegen einer Fehlgeburt der Zarin aufhalten müssen. Da er sich weder aus Festlichkeiten noch aus der Etikette etwas machte, ließ er den König bitten, ihn in einem Lusthaus der Königin, das in einem Vorort von Berlin lag, wohnen zu lassen. Der Königin missfiel dies sehr, sie hatte dort ein sehr hübsches Haus bauen lassen und es prachtvoll ausgestattet. Die Porzellangalerie, die dort zu sehen war, sowie alle Spiegelzimmer waren wunderschön, und da dies Haus als ein wirkliches Kleinod gelten durfte, wurde es auch Monbijou genannt. Der reizende Garten zog sich dem Flusse entlang, was seine Vorzüge noch erhöhte.
Um dem Schaden, den die Herren Russen überall, wo sie gehaust, angerichtet hatten, vorzubeugen, ließ die Königin alle Möbel sowie alle zerbrechlichen Dinge wegschaffen. Der Zar, seine Gemahlin und ihr ganzer Hof kamen einige Tage später auf dem Wasserweg in Monbijou an.
Monbijou
Der König und die Königin empfingen sie am Ufer. Der König reichte der Zarin die Hand, um sie ans Land zu führen.
Zarin Jekatarina
Sobald der Zar gelandet war, streckte er dem König die Hand entgegen und sagte: „Ich freue mich, Euch zu sehen, lieber Bruder Friedrich.“ Er näherte sich dann der Königin und wollte sie umarmen, aber sie wehrte sich dagegen. Die Zarin küsste erst die Hand der Königin und tat es zu verschiedenen Malen. Dann stellte sie den Herzog und die Herzogin von Mecklenburg vor, die sie begleitet hatten, und 400 sogenannte „Damen“ ihres Gefolges. Es waren zumeist deutsche Mägde, die den Dienst von Kammerjungfern, Köchinnen und Wäscherinnen vertraten. Fast eine jede dieser Kreaturen trug ein kostbar gekleidetes Kind im Arm; und als man sie fragte, ob es ihre eigenen wären, antworteten sie, indem sie sich in allerlei russischen Verbeugungen ergingen, der Zar sei Vater derselben, er hätte ihnen diese Ehre erwiesen. Die Königin wollte diese Kreaturen nicht grüßen. Die Zarin dagegen begegnete den königlichen Prinzessinnen mit ausgesuchter Arroganz und ließ sich nur mit Mühe durch den König bewegen, sie zu grüßen.
Ich sah diesen ganzen Hofstaat tags darauf, als der Zar und seine Gattin die Königin besuchten. Diese empfing sie in den großen Empfangsräumen des Schlosses und kam ihnen bis zum Saale der diensttuenden Wache entgegen. Die Königin reichte der Zarin die Hand, ließ sie rechts gehen und geleitete sie in den Audienzsaal. Der König und der Zar folgten ihnen. Sobald dieser mich sah, erkannte er mich wieder, da er mich fünf Jahre zuvor gesehen hatte. Er nahm mich in seine Arme und kratzte mich mit seinen Küssen im ganzen Gesicht. Ich schlug auf ihn los und wehrte mich mit allen Kräften, indem ich ihm sagte, dass ich solche Vertraulichkeiten nicht dulde und er mir meine Ehre raube. Er lachte hellauf über diese Idee und unterhielt sich lange mit mir. Ich war gut unterwiesen worden; sprach also von seiner Flotte und seinen Siegen, was ihn so freute, dass er mehrmals zur Zarin sagte, er gäbe eine seiner Provinzen her, um ein Kind wie mich zu haben. Auch die Zarin war sehr zärtlich mit mir. Die Königin und sie nahmen, jede auf einem Sessel, unter dem Baldachin Platz; ich neben der Königin und die königlichen Prinzessinnen ihr gegenüber.
Die Zarin war klein und gedrungen, sehr gebräunt, unansehnlich und ungraziös. Man brauchte sie nur anzusehen, um ihre niedrige Abkunft zu vermuten. Man hätte sie ihrem Aufzug nach für eine deutsche Komödiantin gehalten. Ihr Gewand war wohl von einer Trödlerin gekauft. Es war ganz altmodisch, mit viel Silber und Schmutz überzogen; die Vorderseite ihres Rockes mit Steinen besetzt. Sie bildeten ein seltsames Muster: einen Doppeladler, dessen Federn mit den kleinsten Diamantensplittern besetzt und sehr schlecht gefasst waren. Sie trug ein halb Dutzend Orden und ebenso viele Heiligenbilder und Reliquien, die längs der Verzierungen ihres Kleides angebracht waren, und wenn sie ging, glaubte man, es käme ein Maultier daher: All die Orden an ihr klirrten wie Schellen zusammen. – Der Zar hingegen war sehr groß und ziemlich gut gewachsen; sein Gesicht war schön, aber der Ausdruck hatte etwas Raues und Furchteinflößendes. Er trug einen matrosenartigen Anzug ohne jegliche Tressen. Die Zarin, die sehr schlecht Deutsch sprach und nicht gut verstand, was die Königin ihr sagte, rief ihre Närrin herbei und unterhielt sich auf Russisch mit ihr. Diese beklagenswerte Kreatur war eine Fürstin Galitzin und hatte sich zu diesem Amte bequemen müssen, um ihr Leben zu retten. Da sie bei einer Verschwörung wider den Zaren beteiligt war, hatte man ihr zweimal die Knute gegeben. Ich weiß nicht, was sie der Zarin sagte, aber diese brach in helles Gelächter aus.
Man ging endlich zu Tische, wo der Zar neben der Königin Platz nahm. Bekanntlich war gegen ihn in seiner Jugend ein Vergiftungsversuch unternommen worden, mit einem feinen Gift, das die Nerven schädigte, so dass er sehr oft in konvulsivische Zustände geriet, denen er nicht gebieten konnte. Das Übel befiel ihn bei Tische, seine Bewegungen wurden unsicher, und da er gerade mit einem Messer gestikulierend der Königin damit sehr nahe kam, erschrak diese und wollte sich immer wieder erheben. Der Zar beruhigte sie und bat sie, keinerlei Angst zu haben, weil er ihr nichts antun würde; zugleich erfasste er ihre Hand, die er so heftig drückte, dass die Königin aufschreien musste; darüber lachte er nun sehr herzhaft und sagte ihr, sie habe noch zartere Knochen als seine Katharina.
Nach dem Bankett war alles für den Ball bereit, allein der Zar machte sich alsbald nach der Tafel davon und ging allein zu Fuße nach Monbijou zurück. Tags darauf zeigte man ihm alle Sehenswürdigkeiten von Berlin, u. a. das Münzenkabinett und die Sammlung antiker Statuen. Unter diesen soll sich eine befunden haben, die, wie man mir sagte, eine heidnische Göttin in sehr indezenter Haltung darstellte, man stellte solche Statuen zur Zeit der alten Römer gern in den Hochzeitsgemächern auf. Das Stück galt für sehr selten und für eins der schönsten, die es gab. Der Zar bewunderte diese Statue sehr und befahl der Zarin, sie zu küssen. Diese wollte sich sträuben, er wurde aufgebracht und sagte in schlechtem Deutsch: „Kop ab“, was so viel heißt als: Ich werde Sie enthaupten lassen, wenn Sie nicht gehorchen. Die Zarin erschrak so sehr, dass sie alsbald gehorchte. Er verlangte nun ohne weiteres diese und mehrere andere Statuen vom König, der sie ihm nicht verweigern konnte. Desgleichen wollte er ein Schränkchen haben, dessen ganzes Getäfel aus Amberholz und einzig in seiner Art war. Es hatte dem König Friedrich I. Unsummen gekostet. Ihm ward nun zum allgemeinsten Bedauern das traurige Los beschieden, nach Petersburg gebracht zu werden.
Dieser barbarische Hofstaat zog zwei Tage später endlich fort. Die Königin begab sich sogleich nach Monbijou. Dort herrschte die Zerstörung von Jerusalem; ich habe Ähnliches nie gesehen. Alles war derartig ruiniert, dass die Königin fast das ganze Haus neu herrichten lassen musste.
Ich komme aber jetzt auf mein Thema zurück, von dem ich lange abwich.
Da mein Bruder im Monat Januar in sein siebentes Jahr getreten war, fand der König es für ratsam, ihn den Händen der Frau von Roucoulles zu entziehen und ihm Gouverneure zu geben. Die Kabalen fingen jetzt von neuem an. Die Königin wollte sich die Wahl selbst vorbehalten, aber die beiden Günstlinge wollten ihre Kreaturen anstellen. Beide Parteien gewannen den Sieg. Die Königin mit dem General, späterem Marschall Grafen von Finkenstein, einem sehr ehrenwerten Mann, der sowohl seiner Ehrlichkeit wie seiner kriegerischen Fähigkeiten halber allgemein geachtet wurde, dessen sonstige Talentlosigkeit ihn jedoch außerstand setzte, einen jungen Fürsten richtig zu erziehen. Er gehörte zu jenen Leuten, die sich viel auf ihren Geist einbilden, die Politiker abgeben wollen und, mit einem Wort, gewaltig räsonieren, ohne etwas zu erreichen. Er hatte die Schwester der Frau von Blaspiel geheiratet. Diese Dame besaß zum Glück mehr Geist als ihr Mann und beherrschte ihn vollkommen. Der Fürst von Anhalt bestellte den zweiten Gouverneur. Er hieß Kalkstein und war Oberst eines Infanterieregiments. Diese Wahl war ihres Urhebers würdig. Herr von Kalkstein ist ein Intrigant, der bei den Jesuiten studierte und sich ihre Lehren wohl zu Herzen nahm; er legt viel Frömmigkeit, ja Bigotterie an den Tag, hebt immer seine Rechtlichkeit hervor und hat Leute genug gefunden, die daran geglaubt haben. Er ist von schmiegsamer und einschmeichelnder Art, birgt aber unter diesem schönen Schein die schwärzeste Seele. Durch die argen Schilderungen, die er täglich von den unschuldigsten Handlungen meines Bruders entwarf, wusste er den König wider seinen Sohn aufzubringen und zu erbittern.
Ich werde des Öfteren in diesen Memoiren auf diesen Mann zu sprechen kommen. Die Erziehung meines Bruders wäre also in sehr schlechten Händen gewesen, wenn der König nicht einen dritten Lehrer den beiden andern noch zugesellt hätte: einen Franzosen, namens Duhan, der ein geistreicher und verdienstvoller junger Mann von großem Wissen war.
Duhan
Ihm verdankt mein Bruder seine Kenntnisse und die guten Grundsätze, die er hatte, solange jener arme Mensch ihm zur Seite stand und Einfluss auf ihn behielt.
So endete das Jahr 1718. Ich gehe zum nächsten über, wo ich anfing in die Welt zu treten und zugleich ihre Verkehrtheiten erfahren lernte. Der König verbrachte den Winter größtenteils in Berlin und wohnte jeden Abend den Gesellschaften bei, die in der Stadt veranstaltet wurden. Die Königin musste den ganzen Tag im Zimmer des Königs verbringen, der es so haben wollte, und hatte meinen Bruder und mich als einzige Gesellschaft.
Wir aßen mit ihr zur Nacht im Beisein der Frau von Kamecke, ihrer Oberhofmeisterin, und Frau von Roucoulles. Die erstere war aus Hannover von meiner Mutter mitgenommen worden; und obwohl sie vorzügliche Eigenschaften besaß, schenkte ihr die Königin keinerlei Zutrauen. Diese war jetzt fortwährend tief melancholisch, und man fürchtete für ihre Gesundheit, besonders da sie guter Hoffnung war. Dennoch kam sie glücklich mit einer Prinzessin nieder, die den Namen Sophie Dorothea erhielt.
Das traurige Leben, das die Königin führte, trug zu ihrer Schwermut bei. Sie kam sich seit dem Verlust ihrer Vertrauten ganz vereinsamt vor. Vergebens hatte sie nach jemandem gesucht, dem sie ihre Gunst zuwenden könnte; denn obgleich sich unter den Damen ihres Hofes durchaus verdienstvolle befanden, fühlte sie sich keiner zugeneigt. Dies zwang sie, aller Politik zum Trotze, sich an mich zu wenden; doch bevor sie mir ihr Herz eröffnete, wollte sie gewissen Verdachtmomenten, die sie gegen die Leti hegte, auf den Grund kommen; auch war ihr manches hinterbracht worden. Als ich eines Tages bei ihr saß und lieb zu ihr war, fing sie mit mir zu scherzen an und fragte mich, ob ich denn nicht bald heiraten möchte. Ich gab ihr zur Antwort, dass ich nicht daran dächte und zu jung dazu sei. Aber wenn es sein müsste, meinte sie, wen würde ich dann vorziehen: den Markgrafen von Schwedt oder den Herzog von Gloucester? „Obwohl mir die Leti immer sagt, dass ich den Markgrafen von Schwedt heiraten würde, kann ich ihn nicht leiden“, erwiderte ich; „er ist ein bösartiger Mensch, also ziehe ich den Herzog von Gloucester vor.“ „Aber“, entgegnete die Königin, „woher wissen Sie, dass der Markgraf böse ist?“ „Von meiner guten Amme“, sagte ich. Sie stellte dann noch mehrere, die Leti betreffende Fragen an mich und wollte wissen, ob es wahr sei, dass sie mich zwänge, ihr alles zu hinterbringen, was sich im Gemach des Königs und der Königin zutrüge. Ich zögerte, unschlüssig, was ich antworten sollte; aber sie kam mir von so verschiedenen Seiten bei, dass ich ihr endlich alles gestand. Die Mühe, die es ihr bereitet hatte, mich dazu zu bringen, machte, dass sie etwas auf meine Diskretion hielt. Sie vertraute mir erst zum Schein einiges an, um zu sehen, ob ich es für mich behalten würde; und da sie sah, dass ich nichts davon verraten hatte, hielt sie nicht länger vor mir zurück.
So nahm sie mich denn eines Tages beiseite. „Ich bin zufrieden mit Ihnen“, sagte sie, „und da ich sehe, dass Sie anfangen, verständig zu werden, will ich Sie stets um mich haben und Sie wie eine Erwachsene behandeln. Doch soll die Leti durchaus nichts mehr erfahren dürfen; wenn sie Sie fragt, was vorging, sagen Sie, Sie hätten nicht drauf achtgegeben. Hören Sie mich wohl? Und versprechen Sie es mir?“ Ich bejahte es ihr. „Wenn dem so ist“, sagte sie, „so will ich Ihnen mein Vertrauen schenken, doch bedarf es der Vorsicht, und Sie müssen mir dafür ganz allein ergeben sein.“ Darüber gab ich ihr nun alle erdenklichen Versicherungen. Sie erzählte mir daraufhin alle Intrigen des Fürsten von Anhalt, die Ungnade der Frau von Blaspiel, kurz alles, was ich darüber berichtet habe, und fügte hinzu, wie sehr sie mich nach England zu vermählen wünschte und wie glücklich ich als die Gattin ihres Neffen sein würde. Ich brach in Tränen aus, als sie mir sagte, dass ihre Freundin in Spandau sei. Ich hatte die Dame sehr geliebt, und man hatte mir gesagt, dass sie auf ihren Gütern lebe. Meine Empfindsamkeit gewann mir der Königin Herz; sie sprach auch von der Leti und fragte mich, ob es wahr sei, dass sie jeden Tag den Oberst Forcade sähe sowie einen geflüchteten französischen Geistlichen, namens Fourneret. Ich bejahte es. „Wissen Sie den Grund?“ fragte sie mich; „– weil der Fürst von Anhalt sie für sich gewann und er sich dieser beiden Kreaturen bedient, um gemeinsam zu intrigieren!“ Ich wollte sie verteidigen, aber die Königin hieß mich schweigen. So jung ich war, stellte ich mancherlei Betrachtungen über das eben Gehörte an. Obwohl ich für die Leti eintrat, merkte ich zu verschiedenen Malen, dass die Königin wahr gesprochen hatte. Ich befand mich in großer Verlegenheit, als der Abend hereinbrach; denn ich fürchtete die Leti wie das Feuer, sie schlug und misshandelte mich sehr oft.
Sobald ich in mein Zimmer zurückgekehrt war, fragte mich die Person wie üblich aus. Ich saß mit ihr auf einer zwei Stufen hohen Estrade in einem Erker. Ich gab ihr die Antwort, welche die Königin mir vorgeschrieben hatte. Sie genügte ihr nicht, und sie stellte mir so viele Fragen, dass ich in Verwirrung geriet. Sie war zu schlau, um nicht zu merken, dass ich unterwiesen worden war; und um es zu erfahren, überschüttete sie mich mit Zärtlichkeiten. Aber da sie durch Güte nichts bei mir ausrichtete, geriet sie in einen grässlichen Zorn, schlug mich auf den Arm und stieß mich die Estrade hinab. Meine Gelenkigkeit bewahrte mich vor einem Fall, und ich kam mit ein paar Beulen davon.
Die Szene wiederholte sich am folgenden Abend, nur mit viel größerer Heftigkeit; sie warf mir einen Leuchter an den Kopf, der mich hätte töten können; mein Gesicht war ganz blutig, und mein Geschrei rief die gute Mermann herbei, die mich den Händen dieser Megäre entriss und ihr drohte, die Königin zu benachrichtigen, wenn sie nicht anders mit mir verführe. Die Leti bekam Angst. Mein Gesicht war ganz zerschunden, und sie wusste nicht, wie sie sich aus der Klemme ziehen sollte; nun beschaffte sie einen mächtigen Vorrat kühlenden Wassers und legte die ganze Nacht hindurch Kompressen auf mein armes Gesicht, und ich machte tags darauf der Königin weis, ich sei gefallen.
So verging der ganze Winter. Ich wurde keinen Tag mehr in Ruhe gelassen, und mein armer Rücken erhielt täglich seinen Teil. In der Gunst der Königin stieg ich dagegen so hoch, dass sie mir nichts mehr vorenthielt. Sie bat den König, ob ich sie nicht überallhin begleiten dürfe. Er willigte mit Freuden ein und wünschte, dass auch mein Bruder mit ihm ginge. Wir machten unsere erste Ausfahrt im Juni, als der König und die Königin nach Charlottenburg fuhren, einem prachtvollen Landsitz in der Nähe der Stadt.
Schloss Charlottenburg
Die Leti blieb von dieser Reise ausgeschlossen, und Frau von Kamecke ward mir statt ihrer zugeteilt. Ich habe schon erwähnt, dass diese Dame die trefflichsten Eigenschaften besaß; obwohl sie sich aber stets in der großen Welt bewegt, hatte sie die Manieren derselben nicht angenommen: Sie durfte eher für eine etwas bäuerliche, vernünftige, aber geistlose Person gelten. Sie war sehr fromm, und ich musste zwei bis drei Stunden lang Gebete verrichten, was mich sehr langweilte; dann kam der Katechismus daran und die Psalmen, die ich auswendig lernen musste, aber ich legte dabei so große Zerstreutheit an den Tag, dass sie mich jeden Tag auszankte.
Der König feierte meinen Geburtstag, gab mir sehr schöne Geschenke, und abends war Ball. Ich ging jetzt in mein elftes Jahr, war für mein Alter ziemlich reif und fing an zu beobachten. Von Charlottenburg fuhren wir nach Wusterhausen. Die Königin vernahm am Abend ihrer Ankunft durch eine Stafette aus Berlin, dass mein zweiter Bruder an Dysenterie (Ruhr – eine entzündliche Erkrankung des Dickdarms bei einer bakteriellen Infektion) erkrankt sei. Diese Nachricht versetzte sie in große Bestürzung, und der König und die Königin wollten sich nach der Stadt begeben, doch hielt sie die Furcht vor der Ansteckung zurück. Tags darauf kam eine zweite Stafette, dass auch meine Schwester Friederike von demselben Übel ergriffen sei. Diese Krankheit wütete in Berlin wie die Pest, die meisten Menschen starben am dreizehnten Tage daran. Man verbarrikadierte selbst die Häuser, in denen die Krankheit herrschte, um ihrer Verbreitung entgegenzuwirken. Die Königin war noch nicht am Ende ihrer Leiden. Einige Tage später erkrankte der König selbst an denselben schweren Koliken, von denen er einige Jahre früher in Brandenburg befallen worden war.
Nie hatte ich so viel auszustehen als während dieser Zeit. Die Hitze war außerordentlich, so groß wie sie in Italien vorkommt. Im Zimmer, in dem der König lag, waren alle Fenster geschlossen, und dabei brannte ein mächtiges Feuer. So jung ich noch war, musste ich den ganzen Tag hier verweilen; man hatte mich neben den Kamin gesetzt, ich war wie vom heftigen Fieber ergriffen und mein Blut so in Aufruhr, dass mir die Augen fast herausstanden. Ich war so erhitzt, dass ich keinen Schlaf finden konnte. Des Nachts machte ich so viel Spektakel, dass Frau von Kamecke davon erwachte; um mich zu beruhigen, gab sie mir Psalmen zu lernen, und als ich entgegnete, es fehle mir die Fassung dazu, schalt sie und sagte der Königin, dass ich nicht gottesfürchtig sei. Darüber kam es zu neuem Zank. Endlich erlag ich all der Mühsal und dem Ungemach und erkrankte nun meinerseits an Dysenterie. Meine getreue Mermann benachrichtigte erst die Königin, die es nicht glauben wollte und mich zwang, obwohl es mir schon recht schlecht ging, auszugehen, und die auf die Warnungen nicht eher achtete, als bis ich schwer darniederlag.
Man brachte mich todkrank nach Berlin. Die Leti kam mir auf der Treppe entgegen. „Ah Prinzessin“, sagte sie, „Sie sind es. Haben Sie große Schmerzen? Sind Sie sehr krank? Nun seien Sie aber vorsichtig! Ihr Bruder ist heute Morgen verschieden, und ich glaube nicht, dass Ihre Schwester den Tag überleben wird.“ Diese traurige Botschaft bekümmerte mich sehr, doch war ich so krank, dass ich sie mir weniger zu Herzen nahm, als zu irgendeiner andern Zeit geschehen wäre. Acht Tage lang schwebte ich in größter Gefahr. Am Abend des neunten Tages fing mein Übel an sich zu lindern; doch erholte ich mich nur sehr langsam. Der König und meine Schwester genasen vor mir. Die Art, wie die Leti mit mir umging, verzögerte meine Genesung. Tagsüber misshandelte sie mich, und nachts ließ sie mich nicht schlafen, denn sie schnarchte wie ein Dragoner.
Die Königin kehrte indessen nach Berlin zurück, und obwohl ich noch sehr schwach war, befahl sie, dass ich ausgehen sollte. Sie empfing mich sehr freundlich, würdigte aber die Leti kaum eines Blickes. Diese Person, aufs höchste darüber aufgebracht, rächte sich an mir. Hiebe und Stöße waren mein tägliches Brot; sie erging sich in Schmähungen auf die Königin und nannte sie für gewöhnlich die große Eselin. Das ganze Gefolge dieser Fürstin hatte Spitznamen so gut wie sie. Frau von Kamecke war die dicke Kuh, Fräulein von Sonsfeld die dumme Gans usw. Solcher Art war die treffliche Moral, die sie mir beibrachte. Ich hatte so viel Ärger und Verdruss, dass mir die Galle ins Blut trat und ich acht Tage nach meinem ersten Ausgang von der Gelbsucht befallen wurde. Ich litt zwei Monate daran und genas von dieser Krankheit nur, um in eine andere, viel gefährlichere zu fallen. Sie setzte mit einem hitzigen Fieber ein und artete zwei Tage später in Scharlach aus. Ich war fortwährend im Delirium, und das Übel verschlimmerte sich so sehr, dass man mir nur noch einige Stunden gab. Der König und die Königin vergaßen in ihrer zärtlichen Sorge um mich alle Rücksicht auf ihr eigenes Wohl. Sie eilten beide um Mitternacht zu mir und fanden mich bewusstlos. Man erzählte mir später, in welch unerhörte Verzweiflung sie gerieten. Sie gaben mir ihren Segen unter tausend Tränen, und man musste sie zwingen, sich von meinem Lager zu entfernen. Ich war in einen lethargischen Zustand gefallen. Die Pflege, die man mir angedeihen ließ, sowie meine gesunde Natur wehrten den Tod von mir ab; das Fieber legte sich gegen Morgen, und zwei Tage später war ich außer Gefahr. Hätte man mich doch in Frieden von dieser Erde scheiden lassen; es wäre zu meinem Glück geschehen. Allein ich war erkoren, tausendfaches Missgeschick zu erdulden, wie der schwedische Prophet es verkündet hatte.
Sobald ich wieder imstande war, ein wenig zu sprechen, kam der König zu mir. Es beglückte ihn so sehr, mich gerettet zu sehen, dass er mir befahl, eine Gunst von ihm zu erbitten. „Ich will Ihnen eine Freude machen“, sagte er, „was immer Sie verlangen, sollen Sie haben.“ Ich war ehrgeizig und konnte es nicht leiden, dass ich immer noch als Kind galt; ich fasste Mut und beschwor ihn, mich nunmehr als eine Erwachsene zu behandeln und mich die Kinderkleider ablegen zu lassen. Er lachte sehr über meinen Einfall. „Nun denn“, sagte er, „es sei Ihnen gewährt, und ich verspreche Ihnen, dass Sie nicht mehr im kurzen Kleide erscheinen sollen.“ Ich war außer mir vor Freude. Ich erlitt fast einen Rückfall, und man hatte alle Mühe, meine erste Aufregung zu mildern. Wie glücklich ist man in diesen Jahren! Die geringste Kleinigkeit erfreut und erheitert uns. Der König hielt jedoch Wort, und was auch die Königin dagegen einwenden mochte, er befahl ihr, mir unbedingt die Courschleppe anzulegen.
Ich konnte mein Zimmer erst im Jahre 1720 (11jährig) verlassen. Ich war selig, keine Kinderkleider mehr zu tragen. Ich stellte mich vor den Spiegel, um mich zu betrachten, und dünkte mich nicht uninteressant in meinem neuen Staat. Ich studierte alle meine Bewegungen und meine Schritte, um wie eine Erwachsene auszusehen; kurz, ich war mit meiner kleinen Person sehr zufrieden. Triumphierend ging ich zur Königin hinab und war auf einen trefflichen Empfang gefasst. Wie ein Cäsar zog ich aus, und wie ein Pompejus kehrte ich zurück. Schon als sie mich von weitem erblickte, rief die Königin aus: „Mein Gott, wie sehen Sie aus! Das ist meiner Treu eine stattliche Figur! Sie sehen auf ein Haar einer Zwergin gleich.“ Ich stand ganz betroffen, in meiner Eitelkeit sehr verwundet, und der Verdruss trieb mir die Tränen in die Augen. Eigentlich hatte ja die Königin nicht unrecht, wenn es bei dieser flüchtigen Verspottung geblieben wäre; allein sie machte mir heftige Vorwürfe, dass ich mich an den König gewandt hatte, um eine Gunst zu erbitten. Sie sagte, dass sie das nicht haben wollte, dass sie mir befohlen habe, ihr allein anzuhängen, und dass, wenn ich mich je an den König wenden würde zu irgendwelchem Zweck, ich sie aufs höchste erzürnen würde. Ich entschuldigte mich, so gut ich konnte und beteuerte ihr so lebhaft meine Ergebenheit, dass sie sich endlich besänftigte.
Ich habe bereits den Charakter der Leti deutlich genug bezeichnet, aber ich kann nicht umhin, noch einen Umstand zu berichten, der zwar geringfügig war, jedoch nicht ohne Folgen blieb. Vor den Fenstern meines Zimmers lief eine ungedeckte, hölzerne Galerie, welche die beiden Flügel des Schlosses verband. Diese Galerie war stets mit Unrat angefüllt, was in meinen Gemächern einen unerträglichen Gestank hervorrief. Die Nachlässigkeit Eversmanns, des Hausmeisters, war daran schuld. Dieser Mensch genoss die Gunst des Königs, der ja stets das Unglück hatte, nur unredliche Günstlinge zu haben. Besonders dieser war ein rechter Teufelsknecht, der nichts wie Unheil zu stiften liebte und mit allen Kabalen und Intrigen, die vorkamen, zu tun hatte. Die Leti hatte ihn mehrmals ersuchen lassen, die Galerie säubern zu lassen, ohne dass er sich dazu bequemen wollte. Da riss ihr endlich die Geduld; sie ließ ihn eines Morgens rufen und fing damit an, dass sie ihn ausschalt. Er blieb ihr nichts schuldig, und sie gerieten endlich in solchen Streit, dass sie sich beide bei den Ohren genommen hätten, wäre nicht zum Glück Frau von Roucoulles erschienen, die sie trennte. Eversmann schwur Rache, und die Gelegenheit bot sich ihm schon am folgenden Tag. Er sagte dem König, dass die Leti sich keineswegs um meine Erziehung kümmere, sie sei die Mätresse des Oberst Forcade sowie des Herrn Fourneret, mit denen sie sich den ganzen Tag eingesperrt hielte, so dass ich nichts lerne; er spräche die Wahrheit, der König möge die Sache nur untersuchen.
Der Bericht Eversmanns war in jedem Punkte zutreffend, doch war die Leti unschuldig, was die letzte Anklage betraf. Ich war sechs Monate lang krank gewesen, was mich sehr zurückgebracht hatte; und seit meiner Genesung konnte ich meine Studien nicht wieder aufnehmen, da ich mich stets bei der Königin aufhielt, zu der ich mich schon um zehn Uhr morgens verfügte, um mich erst um elf Uhr abends zurückzuziehen. Der König, welcher der Wahrheit auf den Grund kommen wollte, stellte mir eines Tages verschiedene Fragen über die Religion. Ich zog mich sehr gut aus der Sache und befriedigte ihn in allen Punkten; doch als ich ihm die zehn Gebote aufsagen sollte, verwirrte ich mich und brachte es nicht zuwege, was ihn in solchen Zorn versetzte, dass er mich fast geschlagen hätte. Mein armer Lehrer musste für den Schaden stehen. Er wurde tags darauf davongejagt. Die Leti blieb auch nicht verschont. Der König gebot der Königin, ihr einen tüchtigen Verweis zu geben und ihr die Ungnade anzudrohen, falls sie je wieder Männer bei sich empfinge; selbst Geistliche sollten ausgeschlossen sein. Die Königin gehorchte mit Freuden und begrüßte die Gelegenheit, sie zu demütigen. Die Leti verteidigte sich, so gut es ging. Sie beschwerte sich über mich; sagte, dass ich weder Ehrfurcht noch Achtung vor ihr habe, dass ich ihr stets zuwiderhandle und dass sie für mein Betragen nicht verantwortlich sein könne, da sie ja fast nie mehr in meiner Nähe sei. Die Königin behandelte mich sehr ungnädig und sagte mir so harte Worte, dass ich trostlos darüber war. Trotz meiner Jugend machte es großen Eindruck auf mich. „Wie!“ dachte ich, „ein Gedächtnisfehler soll so viele Vorwürfe verdienen? Ich habe der Leti nicht gefolgt, das ist wahr; ich habe nicht ihre Zuträgerin werden wollen, sie hat mir keine Geheimnisse entlockt, die mir die Königin anvertraute; ich habe allen Befehlen der Königin gehorcht, und heute macht sie mir dennoch ein Verbrechen daraus. Ich habe allen erdenklichen Verdruss ihr zuliebe erduldet, bin mit Hieben zugerichtet worden, und dies ist der Lohn!“
Im nächsten Augenblick verwünschte ich meine Güte für die Leti. Es lag nur an mir, mich über ihre schlechte Behandlung bei der Königin zu beklagen; und ich gestehe, dass ich einige Zeit schwankte, ob ich die Königin oder diese Person verraten sollte. Allein meine Herzensgüte siegte über diese rachsüchtigen Gedanken, und ich beschloss zu schweigen. Meine Lebensweise wurde jetzt eine ganz andere; meine Stunden begannen um acht Uhr morgens und dauerten bis um acht Uhr abends. Ich hatte nur die Stunden der Mittags- und Abendmahlzeiten als Pausen, und sie vergingen auch wieder unter Verweisen, die mir die Königin gab. War ich dann in mein Zimmer zurückgekehrt, so begann die Leti mit den ihrigen. Sie war sehr erbittert darüber, dass sie niemanden mehr bei sich sehen durfte, und rächte sich an mir. Es verging kaum ein Tag, an dem sie die gefürchtete Kraft ihrer Fäuste nicht an meiner armen Person erprobte. Ich weinte die ganze Nacht, wusste mich gar nicht zu beruhigt, hatte keinen Augenblick der Erholung und wurde wie verdummt. Meine Lebhaftigkeit war verschwunden; mit einem Wort, man hätte mich körperlich wie geistig nicht wiedererkannt. Sechs Monate lang dauerte dies Leben, bis wir nach Wusterhausen übersiedelten.
Ich fing an, bei der Königin wieder in Gunst zu kommen und folglich ein wenig mehr Ruhe zu haben; sie bewies mir sogar ihr Vertrauen und teilte mir alle ihre Pläne mit. Vor der Rückkehr nach Berlin sagte sie mir eines Tages: „Ich habe Ihnen allen Kummer erzählt, den ich bis jetzt erfahren habe, doch habe ich Ihnen nur den kleinsten Teil all der Gründe gesagt, die ihn verursachten; ich will sie jetzt nennen, und ich verbiete Ihnen aufs strengste, mit jenen Leuten zu sprechen noch irgendwelchen Verkehr mit ihnen zu pflegen. Erwidern Sie ihren Gruß, das ist alles, was Sie nötig haben.“ Dabei nannte sie mir halb Berlin, das, wie sie sagte, mit ihr verfeindet sei. „Zwar will ich nicht“, fügte sie hinzu, „dass Sie mich kompromittieren. Falls man Sie fragt, warum Sie mit diesen Leuten nicht sprechen, antworten Sie, dass Sie Ihre guten Gründe dafür haben.“
Ich folgte genau dem Geheiß der Königin und hatte bald alle Welt gegen mich. Die Leti jedoch fing an, sich gewaltig zu langweilen. Das Verbot des Königs hatte sie außerstande gesetzt, ihre Liebes- und Staatsintrigen weiterzuführen, zumal der Einfluss des Fürsten von Anhalt seit der Blaspiel-Affäre sehr gesunken war, so dass die Person um die Geschenke kam, die sie von dem Fürsten zu erhalten pflegte. Er erwähnte nichts mehr von einer Verbindung zwischen mir und dem Markgrafen von Schwedt. All dies veranlasste die Leti, sich an ihre Beschützerin, Lady Arlington, zu wenden, um sie zu bitten, sich ihrer bei der Königin anzunehmen, so dass sie zu meiner Hofmeisterin ernannt würde, ein Titel, der ihr manche Vorrechte brächte, falls dies verweigert würde, solle sie ihr doch um Gottes willen diese Stellung bei den Prinzessinnen von England verschaffen.
Mylady schrieb ihr einen Brief, der für die Königin berechnet war. Er enthielt große Versprechungen über eine Beförderung der Leti in England, eine Aufzählung ihrer guten Eigenschaften und das Bedauern, dass sie in Berlin so wenig Anerkennung fänden; sie möge doch die Auszeichnungen und Belohnungen für meine Pflege fordern und, sofern sie ihr nicht bewilligt würden, ihren Abschied nehmen und sich nach einem Lande verfügen, in welchem das Verdienst mehr Würdigung erfahre. Dies alles war nur eine List, um die Königin zu bewegen, ihr alles zu gewähren, was sie verlangte. Die Leti schickte den Brief der Mylady an die Königin und fügte demselben einen höchst impertinenten von ihrer eigenen Hand hinzu. Sie wolle, sagte sie, Genugtuung haben oder ihren Abschied nehmen. Die Königin war in großer Verlegenheit, da sie Rücksichten auf diese Person zu nehmen hatte, um ihre Beschützerin nicht zu reizen, die den größten Einfluss auf den König von England hatte. Sie wandte sich also an mehrere Personen, um die Leti von ihrem Entschlüsse abzubringen, jedoch vergebens. Endlich sprach die Königin auch mit mir darüber, und ich war auf das höchste erstaunt, da mir gegenüber die Leti nichts hatte verlauten lassen. Die Königin fragte mich eindringlich, wie ihr Verhalten mir gegenüber sei. Ich sagte ihr nur Lobenswertes davon und beschwor die Königin, den Brief der Leti doch ja nicht dem König zu zeigen, bevor ich mit ihr gesprochen hätte. „Wenn Sie sie umstimmen können“, sagte sie, „so bin ich bereit, bis morgen zu warten, aber später wird es nicht mehr Zeit sein, dass sie ihr Gesuch zurückzieht.“ In mein Zimmer zurückgekehrt, sprach ich alsbald mit jener Person. Meine Tränen, meine Bitten und Liebkosungen erweichten sie, oder vielmehr, sie war recht froh, einen einleuchtenden Vorwand zu finden, um ihre Meinung zu ändern. Sie schrieb also einen zweiten Brief an die Königin, in dem sie diese flehentlich bat, den ersten Brief beim König nicht zu erwähnen.
So hatte es für dieses Mal sein Bewenden. Die Zärtlichkeit, die ich ihr bei dieser Gelegenheit bezeigt hatte, verschaffte mir vierzehn Tage lang Ruhe; allein die Leti hielt nur inne, um desto besser ihren Anlauf zu nehmen. Ich litt sechs Monate hindurch wie im Fegefeuer. Meine gute Mermann, die mich jeden Tag von Hieben gequält sah, wollte die Königin in Kenntnis setzen, doch ließ ich es nie geschehen. Um das Maß ihrer Bosheiten vollzumachen, wusch mich die Megäre mit einem bestimmten Wasser, das sie von England hatte kommen lassen und das so scharf war, dass es mir die Haut aufschürfte. Kaum acht Tage genügten, um mein Gesicht zu entstellen und meine Augen heftig zu entzünden. Als die Mermann die schreckliche Wirkung jenes Wassers bemerkte, nahm sie die Flasche und warf sie zum Fenster hinaus, sonst wären meine Augen und mein Teint auf immer verdorben worden.
Der Anfang des Jahres 1721 (Wilhelmine war 12jährig) ließ sich so schlimm an wie das vorhergehende. Meine Drangsal dauerte noch immer fort. Die Leti wollte sich für die Weigerung der Königin rächen; und da sie fest entschlossen war, mich zu verlassen, wollte sie mir noch einen Denkzettel hinterlassen. Ich glaube, sie hätte mir am liebsten einen Arm oder ein Bein gebrochen; nur wagte sie es nicht, aus Furcht, dass es herauskommen würde. So tat sie denn, was sie nur konnte, um mir das Gesicht zu verderben, gab mir Faustschläge auf die Nase, dass ich manchmal davon blutete wie ein Ochse.
Inzwischen kam wieder eine Antwort auf einen zweiten Brief, den sie an Lady Arlington geschickt hatte. Diese Dame schrieb, sie möge nur nach England kommen, woselbst sie Schutz bei ihr finden, ja auf eine zu erwirkende Pension zuversichtlich hoffen dürfe. Die Leti reichte darnach wiederholt ihr Abschiedsgesuch bei der Königin ein, in einem Brief, der noch unverschämter als der erste war. „Ich muss wohl sehen“, schrieb sie, „dass Eure Majestät nicht gewillt sind, mir die Rechte zuzuerkennen, die ich beanspruche. Mein Entschluss ist gefasst. Ich bitte dringend um meine Entlassung. Ich will diesem barbarischen Lande, in dem ich weder Geist noch Vernunft vorgefunden habe, den Rücken kehren und mein Leben in einer milderen Gegend beschließen, wo das Verdienst seinen Lohn findet und wo der regierende Herr nicht allerlei nichtsnutzige Offiziere auszuzeichnen beliebt, wie es hier der Brauch ist, und Leute von Geist geringschätzt.“ Frau von Roucoulles war zugegen, als die Königin diesen Brief empfing. Die Fürstin teilte ihn ihr mit, sie war außer sich vor Zorn. „Aber mein Gott!“ sagte die Dame, „so lassen Sie diese Kreatur doch gehen, es wäre das größte Glück für die Prinzessin. Das arme Kind leidet Qualen bei ihr, und ich fürchte, man bringt sie Ihnen eines Tages mit zerschlagenen Rippen; denn sie wird windelweich geschlagen und riskiert, jeden Tag zum Krüppel zu werden. Die Mermann wird Eurer Majestät besser als alle darüber berichten können.“ Die Königin war sehr erstaunt und ließ meine gute Amme holen. Diese bestätigte ihr alles, was Frau von Roucoulles eben behauptet hatte, und setzte hinzu, sie habe nicht gewagt, früher davon zu sprechen, da die Leti sie einschüchterte, indem sie vorgab, einen großen Einfluss auf die Königin zu besitzen, und ihr drohte, sie würde sie wegjagen lassen. Die Königin zögerte nun nicht länger, den bewussten Brief dem König vorzuzeigen. Dieser war darüber so empört, dass er die Leti sofort nach Spandau geschickt hätte, wenn ihn die Königin nicht daran gehindert hätte.
Sie wusste gar nicht, wen sie nun zu meiner Erzieherin erwählen sollte; sie schlug dem König zwei Damen vor (deren Namen ich nie erfuhr), aber er wies sie beide zurück und ernannte Fräulein von Sonsfeld zu diesem Posten.
Fräulein Dorothea Luise von Sonsfeld – 1681 – 1746
Ich kann meinem Vater für diese Wohltat nicht dankbar genug sein. Fräulein von Sonsfeld stammt aus einem sehr vornehmen Hause, das mit den besten des Landes verwandt ist; ihre Ahnen zeichneten sich durch ihre Verdienste sowie durch die hohen Ämter aus, die sie bekleideten. Eine geschicktere Feder als die meinige vermöchte kaum eine würdige Schilderung von ihr zu entwerfen. Ihr Charakter wird sich im Laufe dieser Memoiren deutlich zeigen. Er darf als einzig gelten, als eine Zusammensetzung von Tugenden und Gefühlen; Geist, Tatkraft und Großmut vereinen sich bei ihr mit einem reizenden Wesen. Ihre vornehme Höflichkeit flößt Achtung und Vertrauen ein; neben all diesen Vorzügen hat sie ein sehr angenehmes Äußeres, das sich bis in ihr Alter erhielt. Sie war Hofdame meiner Großmutter, der Königin Charlotte, gewesen und vertrat dieselbe Stellung im Hause meiner Mutter, der Königin. Sie hatte sehr glänzende Partien ausgeschlagen, da sie nie heiraten wollte.
Großmutter Sophie Charlotte
Sie war vierzig Jahre alt, als sie bei mir eintrat. Ich liebe und verehre sie wie meine Mutter; sie ist heute noch bei mir, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird nur der Tod uns trennen.
Die Königin konnte sie nicht leiden; sie stritt lange mit dem König, aber am Ende musste sie nachgeben, da sie keine triftigen Gründe für ihre Abneigung angeben konnte. Ich wurde von all dem durch meinen Bruder unterrichtet, der dem Gespräche beiwohnte; mir selbst hatte es die Königin verheimlicht. Sie war sehr erstaunt, als sie mich bei ihrer Rückkehr in ihre Gemächer in Tränen fand. „Aha!“ sagte sie, „ich merke wohl, dass Ihr Bruder Ihnen alles hinterbracht hat und dass Sie Bescheid wissen. Sie sind wahrlich töricht, dass Sie deshalb weinen. Haben Sie die Schläge noch nicht satt?“ Ich beschwor sie, die Leti doch wieder zu begnadigen; allein sie antwortete mir, dass ich mich darein schicken müsste und dass die Sache nicht mehr zu ändern sei. Fräulein von Sonsfeld, die sie hatte rufen lassen, erschien in diesem Augenblick; sie nahm sie bei der Hand, mich bei der andern, und führte uns zum König. Dieser zeigte sich sehr zuvorkommend und sagte ihr dann, welches Amt er ihr zugedacht habe. Ihr Verhalten war sehr ehrfurchtsvoll, doch bat sie den König auf das dringendste, sie mit diesem Amte zu verschonen, da sie sich ihm nicht gewachsen fühle. Der König ließ keines ihrer Bedenken gelten, aber nur auf sein Drohen hin fügte sie sich endlich; er verlieh ihr einen Rang und sicherte ihr allerlei Vorteile sowohl für sie als auch für ihre Familie zu. Sie wurde am dritten Ostertage als meine Hofmeisterin eingesetzt.
Das Unglück der Leti ging mir äußerst nahe, sie wurde sehr rücksichtslos verabschiedet. Der König ließ ihr durch die Königin sagen, dass er sie am liebsten nach Spandau geschickt hätte; sie dürfe nicht mehr wagen, sich vor ihm zu zeigen und müsse innerhalb acht Tagen den Hof sowie das Land verlassen. Ich tat, was ich konnte, um sie zu trösten, und bezeigte ihr viel Freundschaft. Ich besaß nicht viel in jener Zeit, dennoch schenkte ich ihr an Steinen, Schmuck und Silbersachen etwa fünftausend Taler, von allem abgesehen, was sie von der Königin erhielt. Trotzdem hatte sie die Bosheit, mich gänzlich zu berauben; und am Tage nach ihrer Abreise hatte ich kein Kleid mehr übrig, da die Person alles mitgenommen hatte. Die Königin musste mich von Kopf bis zu Fuß neu ausstatten.
Ich gewöhnte mich bald an meine neue Vorgesetzte. Fräulein von Sonsfeld beobachtete erst mein Temperament und meinen Charakter. Sie merkte, dass ich außerordentlich schüchtern war; ich bebte, wenn sie ernst wurde, und getraute mir nicht zwei Worte zu sagen, ohne zu stocken. Sie verhehlte der Königin nicht, dass man trachten müsse, mich zu zerstreuen und mich mit großer Schonung zu behandeln, um mir Mut zu machen; ich sei sehr lenksam, und wenn man an mein Ehrgefühl sich wende, könne man alles mit mir erreichen. Die Königin ließ ihr in meiner Erziehung ganz freie Hand. Sie unterhielt sich täglich über unverfängliche Dinge mit mir, und indem sie sich auf die Ereignisse des Tages bezog, suchte sie mein Gefühlsleben zu wecken. Ich fing an mich des Lesens zu befleißigen, und es wurde bald meine liebste Beschäftigung. Sie feuerte mich so geschickt an, dass ich auch an meinen anderen Studien Interesse fand. Ich lernte Englisch, Italienisch, Geschichte, Geographie, Philosophie und Musik. In kurzer Zeit machte ich erstaunliche Fortschritte. Ich lernte jetzt mit solchem Eifer, dass man meiner übergroßen Lernbegierde einen Zaum anlegen musste. So verbrachte ich zwei Jahre; und da ich nur solche Tatsachen verzeichne, welche der Mühe lohnen, gehe ich zum Jahre 1722 (Wilhelmine war 13jährig) über.
Es setzte gleich mit erneuten Widerwärtigkeiten für mich ein. Da jedoch vom englischen Hof in diesen Memoiren viel die Rede sein wird, geziemt es sich, dass ich einiges darüber sage. Der König von England war ein Fürst, der sich zwar etwas auf seine Gesinnungen zugutetat, aber zu seinem Unglück hatte er sich nie die Mühe gegeben, zu ergründen, wie sie zu betätigen seien. Viele Tugenden, maßlos betrieben, werden zu Lastern. Es war sein Fall. Er befliss sich einer Festigkeit, die in Rauheit ausartete, einer Ruhe, die man Indolenz nennen durfte. Seine Großmut erstreckte sich nur auf seine Günstlinge und Mätressen, von denen er sich beherrschen ließ, der Rest der Menschheit war davon ausgeschlossen. Seit seiner Thronbesteigung war er unerträglich hochmütig geworden. Zwei Eigenschaften machten ihn achtenswert: seine Gerechtigkeit und sein Billigkeitssinn; er war nicht böse und setzte seinen Stolz darein, Leuten, denen er wohlgesinnt war, treu zu bleiben. Im Umgang zeigte er sich kalt, sprach wenig und hörte nur gerne von Albernheiten sprechen.
Gräfin Melusine von der Schulenburg – 1667 – 1743
Die Gräfin Schulenburg, nachherige Herzogin von Kendal und Prinzessin von Eberstein, war seine Geliebte oder, besser gesagt, seine morganatische Frau. Sie gehörte zu jenen Personen, welche so gut sind, dass sie sozusagen zu nichts gut sind. Sie hatte weder Tugenden noch Laster, und all ihr Sinnen war nur darauf gerichtet, ihre Gunst beim König nicht zu verlieren und von niemandem verdrängt zu werden.
Die Prinzessin von Wales war außerordentlich geistreich, sehr gebildet, von reichen Kenntnissen und von großer politischer Begabung. Sie gewann zuerst alle Herzen in England für sich. Ihr Wesen war leutselig und anmutig, allein sie vermochte ihre Popularität nicht zu bewahren: Man hatte ihren wahren Charakter zu ergründen gewusst, der in keiner Weise ihrem Äußeren entsprach. Sie war herrschsüchtig, falsch und ehrgeizig. Man verglich sie stets mit Agrippina; sie hätte mit dieser Kaiserin ausrufen können: „Mag alles verderben, wenn ich nur herrsche.“ – Der Prinz, ihr Gemahl, hatte ebenso wenig Geist wie sein Vater; er war lebhaft, heftig, hochfahrend und von einem unverzeihlichen Geiz.
Lady Arlington, die den zweiten Rang behauptete, war die natürliche Tochter des verstorbenen Kurfürsten von Hannover und einer Gräfin Platen. Man darf in Wahrheit von ihr sagen, dass sie höllisch viel Geist besaß, denn er war ganz dem Bösen zugewandt. Sie war lasterhaft, voller Ränke und ebenso ehrgeizig wie die beiden anderen, deren Charakterbild ich entwarf. Diese drei Frauen herrschten abwechselnd über den König, obwohl sie sich sonst spinnefeind waren. Nur darin waren sie einig, dass sie nicht wollten, dass der junge Herzog von Gloucester eine Prinzessin aus einem mächtigen Hause heimführe, und dass ihnen eine recht unbegabte erwünscht war, damit sie weiterhin das Regiment behielten.
Lady Arlington, die ihre eigenen Pläne hatte, schickte Fräulein von Pöllnitz nach Berlin. Diese Dame war die Hofdame und Vertraute meiner Großmutter, der Königin Charlotte, gewesen; sie hatte sich nach dem Tode dieser Fürstin nach Hannover zurückgezogen, wo sie von einer Pension lebte, die ihr der König bewilligt hatte. Sie war so schlimmen Geistes wie Mylady, eine ebenso große Intrigantin, ihre böse Zunge verschonte niemanden; um nur drei kleine Fehler hervorzuheben: Sie liebte das Spiel, die Männer und den Wein. Die Königin, meine Mutter, kannte sie seit langem. Da ihr gemeldet wurde, dass Fräulein von Pöllnitz beim Hofe von Hannover sehr gut angeschrieben sei, empfing sie dieselbe aufs Beste. Sie stellte sie mir vor: „Hier ist eine meiner alten Freundinnen“, sagte sie, „mit der Sie gerne Bekanntschaft machen werden.“ Ich begrüßte sie und sagte ihr auf diese Worte der Königin etwas sehr Verbindliches. Sie betrachtete mich eine Weile von Kopf bis zu Fuß, dann wandte sie sich an die Königin: „Aber mein Gott“, hub sie an, „wie sieht die Prinzessin aus! welche Figur und wie ungraziös! und wie schlecht angezogen!“ Die Königin, auf solche Komplimente nicht gefasst, wurde ein wenig verlegen. „Sie könnte in der Tat besser aussehen“, sagte sie; „allein an ihrer Taille ist nichts auszusetzen, sie ist nur noch nicht entwickelt. Wenn Sie aber mit ihr reden wollen, werden Sie sehen, dass etwas hinter ihr steckt.“ Die Pöllnitz ließ sich also in eine Unterhaltung mit mir ein, aber auf ironische Weise, indem sie Fragen an mich stellte, wie wenn ich ein vierjähriges Kind wäre. Dies reizte mich so sehr, dass ich sie keiner Antwort mehr würdigte. Sie aber gab nun der Königin zu verstehen, dass ich launisch und hochmütig sei und sie von oben herab behandelt hätte. Dies zog mir sehr bittere Verweise zu, die anhielten, solange die Person in Berlin verblieb. Sie stellte mir überall nach. Man sprach eines Tages von meinem Gedächtnis. Dabei bemerkte die Königin, dass es geradezu unerhört sei. Die Pöllnitz lächelte boshaft dazu, als wüsste sie es anders. Dies reizte die Königin, und sie schlug ihr vor, mich auf die Probe zu stellen, ich würde hundertundfünfzig Verse in einer Stunde auswendig lernen. „Nun denn“, sagte die Pöllnitz, „so mag sie eine kleine lokale Gedächtnisübung machen, und ich wette, sie wird nicht behalten, was ich ihr aufschreiben werde.“ Die Königin wollte recht behalten und ließ mich rufen. Sie nahm mich beiseite und sagte mir, sie wolle mir alles Vergangene verzeihen, wenn sie ihre Wette durch mich gewänne. Ich wusste nicht, was ein lokales Gedächtnis sei, und hatte niemals davon vernommen. Die Pöllnitz schrieb nieder, was ich lernen sollte. Es waren fünfzig ganz barocke Namen, die sie erfunden und alle nummeriert hatte; sie las sie mir zweimal vor, indem sie stets die Nummern dazu nannte, worauf ich sie alsbald auswendig hersagen musste. Es gelang mir aufs erste Mal sehr gut, aber sie wollte das Experiment wiederholen und fragte mich von neuem aus und hieß mich die Namen nicht mehr der Reihenfolge nach hersagen, sondern griff nur aufs Geratewohl eine Nummer heraus. Dennoch bestand ich auch diese Probe zu ihrem großen Ärger. Ich habe nie im Leben mein Gedächtnis so sehr angestrengt, dennoch konnte sie es nicht über sich bringen, mich zu loben. Die Königin konnte dies Benehmen gar nicht begreifen und war darüber sehr gereizt, obwohl sie es sich nicht merken ließ. Endlich befreite uns Fräulein von Pöllnitz von ihrer unausstehlichen Gegenwart und kehrte nach Hannover zurück.
Bald darauf kam auch Fräulein von Brunow, die Schwester der Frau von Kamecke, nach Berlin. Sie war Hofdame bei meiner Urgroßmutter, der Kurfürstin Sophie von Hannover, gewesen und lebte noch an diesem Hofe, woselbst sie eine Pension genoss. Sie war gutmütig, aber strohdumm. Sie stellte bei ihrer Schwester eifrige Erkundigungen nach mir an. Da diese mir sehr gewogen war, lobte sie mich mehr, als ich es wohl verdiente. Die Brunow war über den Bericht der Frau von Kamecke erstaunt. „Unter Schwestern“, meinte sie, „sollte man offener sprechen und nicht Dinge leugnen, die alle Welt weiß, denn wir sind in Hannover über die Prinzessin längst unterrichtet worden, und wir wissen, dass sie verwachsen und zum Erschrecken hässlich ist, hochmütig und böse, mit einem Wort ein kleines Monstrum, das lieber nie zur Welt hätte kommen sollen.“ Frau von Kamecke wurde böse, geriet mit ihrer Schwester in lebhaften Streit, und um sie von ihrem Irrtum zu überzeugen, führte sie sie alsbald zur Königin, bei der ich mich befand. Sie wollte gar nicht glauben, dass ich es wirklich sei. Aber dass ich nicht verwachsen sei, davon ließ sie sich erst überzeugen, als man mich in ihrer Gegenwart auszog. Verschiedene Damen wurden wiederholt von Hannover nach Berlin geschickt, um mich in Augenschein zu nehmen. Ich musste vor ihnen aufziehen und ihnen meinen Rücken zeigen, um ihnen zu beweisen, dass ich nicht bucklig sei. Ich war sehr erbost über all dies, und zum Unglück ließ mich die Königin, damit ich zierlicher erscheine, so entsetzlich schnüren, dass ich ganz blau im Gesicht wurde und mir der Atem ausging. Dank der Sorge des Fräuleins von Sonsfeld war mein Teint wiederhergestellt; ich hätte ganz leidlich ausgesehen, wenn mir die Königin nicht geschadet hätte, indem sie mich so arg schnüren ließ. So verging dieses Jahr. Da sich nichts Bemerkenswertes in demselben zutrug, gehe ich zum Jahr 1723 (Wilhelmine war 14jährig) über.
Der König von England kam im Frühjahr nach Hannover, die Herzogin von Kendal und Lady Arlington begleiteten ihn, und letztere hatte die Leti in ihrem Gefolge. Diese lebte einzig nur von ihrer Gnade und von einer Pension des Königs, die ihr erwirkt worden war. Mein Vater, der König, der damals einzig meine Vermählung mit dem Herzog von Gloucester anstrebte, begab sich bald nach der Ankunft des Königs von England nach Hannover. Er wurde daselbst auf das herzlichste und wärmste bewillkommt und kehrte, von seinem Aufenthalt sehr befriedigt, nach Berlin zurück.
Die Königin reiste bald nach seiner Rückkehr zu ihrem Vater, dem König. Sie war mit vielen geheimen Instruktionen behufs eines offensiven wie defensiven Bündnisses betraut, das durch die Ehe meines Bruders und durch die meine besiegelt werden sollte. Sie fand jedoch nicht die günstige Stimmung vor, die sie erhofft hatte. Der König von England war mit allen Vorschlägen einverstanden, außer mit dem meiner Vermählung, und er redete sich damit hinaus, dass er vorgeblich die Neigung seines Enkels, des Prinzen, berücksichtigen und wissen müsse, ob unsere beiderseitigen Temperamente und Charaktere zueinander passten. Die Königin, aufs höchste bestürzt und ratlos, wandte sich an die Herzogin von Kendal. Sie beklagte sich bitterlich bei dieser Dame über die Antwort des Königs und gab sich alle Mühe, sie für sich zu gewinnen. Sie bat und bestürmte sie so lange, bis sie sie endlich zu dem Geständnis brachte, dass die Abneigung des Königs gegen meine Vermählung von den schlechten Eindrücken herrühre, die man ihm von mir beigebracht habe; die Leti habe ein solches Bild von mir entworfen, dass jedem Manne die Lust vergehen müsste, mich zu heiraten: Ich sei von abstoßender Hässlichkeit und ganz verwachsen; und was sie dann von meinem Charakter gesagt, stände im besten Einklang mit meinem Äußeren: ich sei so zornig und boshaft, dass ich aus reiner Wut mehrere Male tagsüber von der fallenden Sucht ergriffen würde. „Urteilen Sie selbst, Madame“, fuhr die Herzogin fort, „ob nach solchen Berichten, die durch Fräulein von Pöllnitz bestätigt wurden, Ihr königlicher Vater seine Einwilligung zu der Heirat geben konnte.“ Die Königin, unfähig, ihre Entrüstung zu bemeistern, erzählte ihr, wie die Leti sich gegen mich benommen hatte und aus welchen Gründen man sie weggeschickt habe; sie nannte ihr alle Personen, die von Hannover nach Berlin entsendet worden waren, und berief sich auf deren Zeugnis. Kurz, man bewies der Herzogin so deutlich die Falschheit jener Gerüchte, dass man sie ganz von dem Gegenteil überzeugte. Diese Dame, welche die intime Freundin des Lord Townshends, des damaligen ersten Staatssekretärs, war, beschloss selbst, die ganze Sache ins reine zu bringen, auf dass sie auch allen Lohn allein davontrüge. Aber sie verhehlte sich nicht, wie schwer es sein würde, den König von seinen Vorurteilen gegen mich abzubringen; und sie riet der Königin, ihn zu einer Reise nach Berlin zu bereden, damit er sich mit eigenen Augen von den Verleumdungen, die man über mich ausgestreut hatte, überzeugen könne. Die Königin wusste ihren Vater so geschickt zu beeinflussen und wurde dabei von der Herzogin so emsig unterstützt, dass er sich ihren Wünschen fügte und seine Reise für den Monat Oktober in Aussicht stellte.
Triumphierend kehrte die Königin nach Berlin zurück und wurde aufs Beste von ihrem Gemahl empfangen. Welche Freude der Besuch des Königs von England überall bei uns hervorrief und welche Genugtuung der König darüber empfand, lässt sich nicht beschreiben. Nur ich hatte keinen Teil daran, denn vom Morgen bis zum Abend wurde ich jetzt malträtiert. Zu allem, was ich tat, bemerkte die Königin: „Das sind Manieren, die meinem Neffen nicht gefallen werden, Sie müssen sich von nun an nach seinem Geschmack richten.“ Diese Verweise, die mir wohl zwanzigmal am Tage erteilt wurden, waren für meine kleine Eigenliebe durchaus nicht schmeichelhaft. Ich hatte von jeher das Unglück, viel über die Dinge nachzudenken; ich sage das Unglück, denn auf diese Weise ergründet man in der Tat gar vieles auf recht unerwünschte Weise. Über sich selbst nachzudenken, ist heilsam. Doch würde man viel glücklicher sein, wenn man alle trüben Betrachtungen von sich weisen könnte. Es ist ein physisches Übel, jedoch ein moralischer Vorzug, und obwohl er mir oft sehr zur Last fällt, finde ich ihn doch für die Lebensführung von Wert. Aber während ich mich so über das überflüssige Nachdenken aufhalte, merke ich, dass ich eben wieder dabei begriffen bin, von meiner Erzählung abzuweichen. Ich komme also auf das Verhalten der Königin zurück. „Wie hart ist es für mich“, klagte ich oft meiner Hofmeisterin, „von der Königin immer wieder auf so auffällige Weise gerügt zu werden. Ich weiß, ich habe Fehler, und wünsche lebhaft, sie abzulegen, weil ich mir die Achtung und den Beifall aller Welt erwerben möchte. An dieses Gefühl sollte man sich bei mir wenden, statt nur immer vom Herzog von Gloucester zu sprechen und von der Mühe, die ich mir geben sollte, ihm eines Tages zu gefallen. Mir scheint, ich bin so viel wert als er; und wer weiß, ob er mir gefallen wird und ob ich glücklich mit ihm werden könnte. Warum all dieses Entgegenkommen, bevor es an der Zeit ist? Ich bin die Tochter eines Königs; es ist keine so sonderliche Ehre für mich, einen Prinzen zu heiraten. Ich fühle keinerlei Neigung für ihn, und was mir die Königin täglich von ihm sagt, flößt mir eher Widerwillen als den Wunsch ein, ihn zu heiraten.“ Fräulein von Sonsfeld wusste nicht, was sie erwidern sollte. Was ich sagte, war zu richtig, um getadelt zu werden. Ich war von Natur aus schüchtern, und diese fortgesetzten Missbilligungen waren nicht angetan, mich zu ermutigen. Sie machte der Königin Vorstellungen, aber umsonst.
Um diese Zeit kam einer der Kavaliere des Herzogs von Gloucester nach Berlin. Die Königin gewährte ihm Audienz, und er wurde ihr wie auch mir vorgestellt. Er entbot mir einen sehr zuvorkommenden Gruß seines Herrn; ich errötete und erwiderte nur mit einer Verbeugung. Die Königin, die hinhorchte, war sehr böse, dass mir keine Antwort auf das Kompliment des Herzogs einfiel; sie wusch mir den Kopf und befahl mir, wenn ich sie nicht erzürnen wollte, am nächsten Tage meinen Fehler gutzumachen. Ich ging weinend auf mein Zimmer, wider die Königin, wider den Herzog sehr aufgebracht. Ich schwor, dass ich ihn nie heiraten wollte; wenn ich schon vor meiner Verheiratung so unter seiner Fuchtel stünde, würde ich späterhin nicht besser als seine Sklavin gehalten werden; die Königin handle nur nach ihrem Kopf, ohne meine Gefühle zu berücksichtigen. Endlich wollte ich mich zu ihren Füßen stürzen und sie anflehen, mich nicht unglücklich zu machen, indem sie mich zwänge, einen Prinzen zu heiraten, für den ich keine Neigung hatte und mit dem ich sicherlich unglücklich sein würde. Fräulein von Sonsfeld hatte alle Mühe, mich zu beruhigen, um mich von einem so törichten Schritt abzuhalten. Tags darauf musste ich mich mit jenem Kavalier unterhalten und etwas über den Herzog sagen, aber ich tat es sehr gezwungen und mit recht verlegener Miene.
Indes stand die Ankunft des Königs von England bevor. Wir begaben uns am 6. Oktober nach Charlottenburg, um ihn zu empfangen. Das Herz schlug mir heftig, und ich war von banger Aufregung erfüllt. Der König kam am 8. Oktober um sieben Uhr abends an. Der König, die Königin und der ganze Hof empfingen ihn im Schlosshof, da die Gemächer zu ebener Erde lagen. Nachdem er den König und die Königin begrüßt hatte, wurde ich ihm vorgestellt. Er umarmte mich, und sich zur Königin wendend, sagte er: „Sie ist sehr groß für ihr Alter.“ Er reichte ihr die Hand und führte sie in seine Gemächer, und alle anderen folgten. Sobald ich eintrat, nahm er eine Kerze und betrachtete mich von Kopf bis zu Fuß. Ich stand unbeweglich wie eine Statue und aufs tiefste verwirrt. Dies alles geschah, ohne dass er ein Wort zu mir sagte. Nachdem er mich also gemustert hatte, wandte er sich an meinen Bruder, dem er viel Liebes erwies und mit dem er sich lange unterhielt. Ich nahm die Gelegenheit wahr, um mich zu entfernen; die Königin gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen, und ging in ein anstoßendes Zimmer, wo sie sich die Engländer und Deutschen vom Gefolge des Königs vorstellen ließ. Nachdem sie eine Weile mit ihnen gesprochen hatte, sagte sie zu diesen Herren, dass sie mich bei ihnen lasse, um sie zu unterhalten; und zu den Engländern sich wendend, sagte sie: „Sprechen Sie Englisch mit meiner Tochter, Sie werden sehen, dass sie es sehr gut kann.“ Ich fühlte mich viel weniger verlegen, sobald die Königin sich entfernt hatte, schöpfte Mut und begann mit den Herren ein Gespräch. Da ich ihre Sprache so gut wie meine Muttersprache konnte, bestand ich sehr wohl vor ihnen, und alle schienen entzückt. Sie lobten mich bei der Königin und sagten ihr, dass ich englisch aussähe und wie dazu geboren sei, eines Tages ihre Herrscherin zu sein. Dies wollte viel sagen, denn diese Nation hält sich so sehr für die erste, dass, wenn sie jemandem sagen, man könne ihn für einen Engländer halten, sie das größte Lob zu spenden glauben. Ihr König hätte wohl für einen Spanier gelten können, er war außerordentlich gemessen und sprach mit keinem Menschen. Er begrüßte Fräulein von Sonsfeld sehr kühl und fragte sie, ob ich immer so ernst sei und ob ich ein melancholisches Temperament habe. „Nichts weniger als das“, entgegnete sie „allein die Ehrfurcht vor Eurer Majestät macht, dass sie nicht so munter zu sein wagt, als sie es für gewöhnlich ist.“ Da schüttelte er den Kopf und antwortete nichts. Der Empfang, den er mir bereitet hatte, sowie das, was ich soeben vernommen hatte, schüchterten mich so ein, dass ich nie den Mut fand, mit ihm zu sprechen. Endlich ging man zu Tische, wo der König ebenso einsilbig verharrte; vielleicht hatte er recht, vielleicht hatte er unrecht; ich glaube jedoch, er hielte sich an das Sprichwort: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Gegen Ende der Mahlzeit wurde er unwohl. Die Königin wollte ihn bereden, von Tische aufzustehen; eine Weile entschuldigten sie sich hin und her, endlich warf sie ihre Serviette hin und erhob sich. Der König von England fing an zu schwanken, der von Preußen eilte herzu, um ihn zu stützen; alles wollte ihm behilflich sein, jedoch vergeblich: er fiel auf die Knie, seine Perücke auf eine Seite, der Hut auf die andere. Man streckte ihn sachte am Boden aus, und eine gute Stunde lang blieb er besinnungslos liegen. Endlich nach vielen Belebungsversuchen kam er wieder zu sich. Der König und die Königin waren indes untröstlich; und viele glaubten, dass dieser Anfall der Vorbote eines Schlagflusses sei. Man bat ihn dringend, sich zurückzuziehen, doch er wollte nicht und geleitete die Königin in ihre Gemächer. Nachts ging es ihm sehr schlecht, was man erst unter der Hand erfuhr. Aber dies hielt ihn nicht ab, am folgenden Tage wieder zu erscheinen. Die ganze übrige Zeit seines Hierseins verlief in Festlichkeiten und Vergnügungen. Täglich fanden geheime Sitzungen der englischen und preußischen Minister statt. Das Ergebnis war das endliche Zustandekommen des Bündnisvertrages und der doppelten Verlobung, die in Hannover eingeleitet worden war. Die Unterschriften wurden am 12. desselben Monats vollzogen. Der König von England reiste am folgenden Tage ab, und sein Abschied von der ganzen Familie war ebenso kalt wie seine Begrüßung. Der König und die Königin sollten seinen Besuch erwidern und nach Göhrde kommen, einem Jagdschloss in der Nähe von Hannover.
Schon seit sieben Monaten war die Königin sehr unpass; ihr Übel war so seltsam, dass die Ärzte keinen Rat wussten. Ihr Körper schwoll jeden Morgen mächtig an, und diese Geschwulst verging gegen Abend. Eine Zeitlang schwankte die Fakultät, ob es sich um eine Schwangerschaft handelte; aber sie erachtete zum Schluss, dass dieses Unwohlsein von einer andern Ursache herrühre, welche sehr unbequem, jedoch keineswegs gefährlich ist.
Die Reise des Königs nach Göhrde war für den 8. November angesetzt; er sollte frühmorgens fahren, und wir verabschiedeten uns von ihm, aber die Königin machte alles zunichte. In der Nacht erkrankte sie an heftiger Kolik, verheimlichte aber ihr Übel, so gut sie konnte, um den König nicht aufzuwecken. Als sie auf gewisse Anzeichen hin merkte, dass ihr eine Entbindung bevorstand, rief sie um Hilfe. Es blieb keine Zeit, einen Arzt und eine Wärterin zu holen, und sie brachte glücklich eine Prinzessin zur Welt, ohne andere Beihilfe als die des Königs und einer Kammerfrau. Es waren weder Windeln noch eine Wiege bereit, und alles geriet in Verwirrung. Der König ließ mich um vier Uhr morgens rufen. Ich habe ihn nie so guter Laune gesehen; er hielt sich die Seiten vor Lachen, wenn er des Amtes gedachte, dessen er bei der Königin gewaltet hatte. Der Herzog von Gloucester, mein Bruder, Prinzessin Amalie von England und ich wurden zu Paten und Patinnen des Kindes gewählt; ich hielt es nachmittags über die Taufe, und meine Schwester erhielt den Namen Anna Amalia.
Der König reiste am folgenden Tage ab. Da er sehr rasch zu reisen pflegte, kam er am selben Abend in Göhrde an, wo alles in großer Besorgnis war, da ihn der König von England schon tags zuvor erwartet hatte. Dieser war sehr überrascht, als er den Grund der Verzögerung erfuhr. Grumbkow befand sich im Gefolge des Königs. Er hatte sich seit einiger Zeit mit dem Fürsten von Anhalt entzweit und suchte sich mit dem König von England anzufreunden. Da er stets alle Angelegenheiten selbst besorgen wollte und die Königin es oft zu verhindern suchte, so ließ er jetzt die Gelegenheit nicht unbenützt, zwischen dem König und der Königin wieder Zwietracht zu säen. Ich erwähnte schon, dass der König äußerst eifersüchtig war. Grumbkow hatte diese Schwäche wahrgenommen und erweckte in ihm durch geschickte und undeutliche Anspielungen sehr schimpflichen Verdacht auf die Tugend seiner Gemahlin. Der König kehrte nach vierzehn Tagen wie ein Wütender nach Berlin zurück. Uns begrüßte er sehr freundlich, doch die Königin wollte er nicht sehen. Er ging durch ihr Schlafzimmer, um sich zum Souper zu begeben, ohne ein Wort an sie zu richten. Die Königin und wir waren über dies Benehmen von banger Besorgnis erfüllt; endlich sprach sie zu ihm und drückte ihm in zärtlichsten Worten ihren Kummer über sein Verhalten aus. Als Antwort beschimpfte er sie nur, indem er ihr ihre vermeintliche Untreue vorwarf; und wenn Frau von Kamecke ihn nicht entfernt hätte, so würde ihn seine Heftigkeit zu sehr bedauernswerten Ausschreitungen hingerissen haben. Am nächsten Tage berief er die Ärzte, den Generalarzt Holtzendorff und Frau von Kamecke, um den Wandel der Königin zu untersuchen. Alles nahm lebhaft Partei für dieselbe. Ihre Oberhofmeisterin fand sogar sehr harte Worte für den König und bewies ihm die Ungerechtigkeit seines Misstrauens. Die Tugend der Königin stand in der Tat hoch über jedem Verdacht, und selbst die bösesten Zungen konnten nichts gegen sie zu sagen finden. Der König ging in sich, bat die Königin unter vielen Tränen, die für die Güte seines Herzens zeugten, um Vergebung, und es herrschte wiederum Friede.
Ich erwähnte das Zerwürfnis der beiden Günstlinge. Da es im Jahre 1724 (Wilhelmine war 15jährig) ausbrach, muss ich hier einige Einzelheiten darüber berichten. Seit dem Sturze der Frau von Blaspiel und dem guten Einvernehmen zwischen den Höfen von England und Preußen war der Einfluss des Fürsten von Anhalt sehr gesunken; er verbrachte die meiste Zeit in Dessau und kam nur selten nach Berlin. Der König erwies ihm zwar immer noch viele Aufmerksamkeiten und hielt auf gute Beziehungen mit ihm wegen seiner militärischen Kenntnisse. Grumbkow indessen stand nach wie vor bei ihm in Gunst und war mit den äußeren und inneren Angelegenheiten des Landes betraut. Der Fürst war Pate einer der Töchter Grumbkows gewesen und hatte ihr eine Mitgift von 5.000 Talern versprochen. Diese Tochter stand nun vor ihrer Heirat, und ihr Vater schrieb ihm, um ihn an sein Versprechen zu mahnen. Der Fürst war aber über Grumbkow, der keinerlei Rücksicht mehr auf ihn nahm und ganz allein den König zu beeinflussen suchte, höchst aufgebracht und leugnete jenes Versprechen ab. Grumbkow erwiderte, der andere entgegnete ihm wieder; einer warf zuletzt dem andern all seine Schurkereien vor, und der Briefwechsel artete in eine solche Schimpferei aus, dass der Fürst von Anhalt beschloss, den Streit durch einen Waffengang zu entscheiden. Bei allen Vorzügen, die Grumbkow sonst besaß, galt er für einen ausgemachten Feigling. Er hatte Proben seiner Tapferkeit in der Schlacht von Malplaquet gegeben, wo er sich die ganze Zeit hindurch in einem Graben versteckt hielt; so zeichnete er sich auch vor Stralsund aus und verrenkte sich ein Bein zu Anfang des Feldzuges, so dass er bei dem Ansturm fehlen musste. Er hatte dasselbe Unglück wie jener König von Frankreich, der kein bloßes Schwert sehen konnte, ohne in Zuckungen zu verfallen, abgesehen davon aber ein sehr tapferer General war. Der Fürst schickte ihm seinen Kartellträger. Grumbkow erbebte vor Wut; er berief sich auf die Religion und das Gesetzbuch und antwortete, dass er sich nicht schlagen würde, dass die Duelle von den göttlichen und menschlichen Geboten untersagt seien und dass er nicht gewillt sei, sie zu übertreten. Nicht genug damit, wolle er sich auch um die ewige Seligkeit verdient machen, indem er Unbill geduldig ertrage. Er war jetzt zu jedem Entgegenkommen bereit, zog sich aber dadurch nur umso mehr die Verachtung seines Gegners zu, der unerbittlich blieb. Die Sache gelangte zu Ohren des Königs, der sich alle Mühe gab, die beiden auszusöhnen, jedoch vergeblich: Der Fürst ließ sich nicht erweichen. So wurde denn beschlossen, dass sie ihren Streit vor zwei Sekundanten austragen sollten. Der Fürst wählte hierzu einen gewissen Oberst Corff, der in Hessen diente, und Grumbkow den General Grafen von Seckendorff, der im Dienste des Kaisers stand. Die beiden Letzteren waren intime Freunde. Die Chronique scandaleuse sagte, dass sie in ihrer Jugend als Spießgesellen ihre beträchtlichen Gewinne beim Spiele teilten.
Friedrich Heinrich von Seckendorff
Wie dem auch sei, Seckendorff war Grumbkows lebendiges Abbild, nur mit dem Unterschied, dass er sich mehr für einen Christen ausgab und eine sehr tapfere Klinge führte. Die Briefe, die der General an Grumbkow schrieb, um ihn zu ermutigen, waren das Komischste, was man sich denken konnte. Dennoch wollte der König nochmals dazwischentreten.
Er berief zu Anfang des Jahres 1725 (Wilhelmine war 16jährig) einen Kriegsrat in Berlin, der sich aus allen Generalen und Obersten der Armee zusammensetzte. Die Königin hatte auf die meisten Generale einen großen Einfluss. Die schönen Versprechungen, die Grumbkow ihr machte, dass er ihrer Partei unverbrüchlich anhängen wollte, verblendeten sie; sie ließ die Waagschale zu seinen Gunsten entscheiden, sonst hätte er leicht kassiert werden können. So aber kam er mit einigen Tagen Arrest davon, die über ihn verhängt wurden als eine Art Genugtuung für den Fürsten von Anhalt. Sobald sie verbüßt waren, ließ ihm der König unter der Hand den Rat erteilen, seine Sache ins Reine zu bringen. Der Kampfplatz lag nahe bei Berlin; die beiden Gegner begaben sich mit ihren Sekundanten dorthin. Der Fürst zog seinen Degen, indem er Grumbkow einige beleidigende Worte zurief. Dieser aber warf sich ihm jetzt zu Füßen, umschlang seine Knie, indem er ihn bat, ihm zu verzeihen und wieder in Gnaden aufzunehmen. Der Fürst drehte ihm statt aller Antwort den Rücken. Seit dieser Zeit waren die beiden geschworene Feinde und verfolgten einander ihr Lebtag lang. Der Fürst hat sich seitdem sehr zu seinem Vorteil verändert, und viele Leute schoben die meisten seiner schlimmen Taten dem verderblichen Einfluss Grumbkows zu. Von ihm gilt, was vom Kardinal Richelieu ausgesagt wurde: „Er hat zu viel Böses getan, als dass man ihn loben kann, und zu viel Gutes, um schlecht von ihm zu sprechen.“
Der König von England kam im Laufe dieses Jahres wieder über das Meer nach Deutschland. Mein Vater, der König, versäumte nicht, ihn aufzusuchen; er hoffte, meine Heirat endgültig zum Abschluss zu bringen. Da die Königin schon einmal so erfolgreich gewesen war, wurde sie wieder mit dieser Mission betraut. Sie begab sich also nach Hannover und wurde dort mit offenen Armen aufgenommen. Sie nahm bei ihrem königlichen Vater dieselbe Gesinnung betreffs einer Heirat zwischen unsern Häusern wahr wie in den vorhergehenden Jahren. Er sprach sich sogar sehr liebevoll über mich aus, hielt ihr jedoch vor, dass zwei Hindernisse seinen Wünschen im Wege stünden. Das erste sei, dass er uns nicht verheiraten dürfe, ohne zuvor die Einwilligung seines Parlaments eingeholt zu haben; das zweite sei unsere Jugend, denn ich sei erst sechzehn, der Herzog erst achtzehn Jahre alt. Um jedoch all diese Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, versprach er ihr, alles so zu ordnen, dass bei seiner nächsten Anwesenheit in Deutschland unsere Hochzeit gefeiert werden könne. Die Königin hoffte jedoch noch mehr zu erreichen; sie hatte sich nie zuvor so gut mit ihrem königlichen Vater gestanden wie jetzt. Er schien sogar von großer Zärtlichkeit für sie erfüllt, und so viel ist gewiss, dass er ihr alle erdenklichen Aufmerksamkeiten erwies. Sie bat deshalb den König, ihren Gemahl, um eine verlängerte Frist, innerhalb der, so schrieb sie, ihre Pläne gelingen sollten. Der König willfahrte ihr und gestattete ihr sogar, so lange in Hannover zu bleiben, als die Angelegenheiten es erfordern würden. Inzwischen stand ich in Berlin sehr in Gnaden bei dem König; ich unterhielt ihn jeden Nachmittag, und er speiste bei mir zu Abend. Er zeigte sich sogar sehr mitteilsam und sprach oft von Geschäften mit mir. Um mich noch mehr auszuzeichnen, befahl er, dass man mir gleich wie der Königin huldigen solle. Die Hofmeisterinnen meiner Schwestern wurden mir unterstellt und erhielten Befehl, nichts ohne meine Einwilligung vorzunehmen. Ich wollte die Gunst des Königs nicht missbrauchen. Ich war bei aller Jugend so vernünftig, wie ich es heute bin, und hätte also wohl die Erziehung meiner Schwestern leiten können. Aber ich hatte Einsicht genug, um zu erkennen, dass es sich nicht geziemt hätte; ebenso wenig wollte ich Cercle halten und begnügte mich damit, jeden Tag einige Damen zu mir zu bitten.
Schon seit sechs Monaten wurde ich von grausamen Kopfschmerzen geplagt, die so heftig waren, dass ich oft in Ohnmacht fiel. Trotzdem wagte ich nie das Zimmer zu hüten, da es die Königin nicht haben wollte. Sie, die von sehr kräftigem Körperbau war, wusste nichts von Krankheit; sie zeigte sich hierin von unerhörter Härte, und wenn ich manchmal halbtot war, musste ich doch vergnügt darein sehen, sonst konnte sie in schrecklichen Zorn gegen mich geraten. Am Vorabend ihrer Rückkehr befiel mich ein hitziges Fieber mit starkem Blutandrang und so starken Kopfschmerzen, dass man mich vom Schlosshof aus schreien hörte. Sechs Personen mussten mich Tag und Nacht halten, um zu verhindern, dass ich mich tötete. Fräulein von Sonsfeld schickte sogleich Eilboten an den König und die Königin, um sie von meinem Zustand in Kenntnis zu setzen. Die Königin kam abends an und war sehr besorgt, mich so krank zu finden. Die Ärzte verzweifelten schon an meinem Aufkommen, aber ein Geschwür im Kopfe, das am dritten Tag aufbrach, rettete mir das Leben; zum Glück floss der Eiter zum Ohre heraus, sonst wäre ich verloren gewesen. Der König begab sich zwei Tage später nach Berlin und suchte mich sofort auf. Mein kläglicher Zustand betrübte ihn so sehr, dass er Tränen darüber vergoss. Zur Königin ging er nicht und ließ alle Verbindungstüren zwischen seinen Gemächern und denen der Königin verbarrikadieren. Der Grund dieses Verfahrens war sein Zorn darüber, dass er durch falsche Versprechen hingehalten worden war. Er hatte sich so sehr auf den Einfluss der Königin bei dem König von England verlassen, dass er glaubte, meine Heirat würde noch in diesem Jahre zustande kommen. Er war nun überzeugt, sie habe ihm dies nur vorgespiegelt, um ihren Aufenthalt in Hannover verlängern zu können. Diese Entfremdung dauerte sechs Wochen, dann versöhnten sie sich. Ich erholte mich indes sehr langsam und musste zwei Monate lang das Zimmer hüten.
Meine Mutter, die Königin, ist von Natur aus sehr eifersüchtig. Die vielen Auszeichnungen, die mir der König zuteilwerden ließ, brachten sie wider mich auf; überdies wurde sie hierin von einer ihrer Damen ermutigt, der Tochter der Gräfin Fink, die ich nunmehr die Gräfin Amalie nennen werde, um sie von ihrer Mutter zu unterscheiden. Diese Person führte hinter dem Rücken ihrer Eltern eine Intrige mit dem preußischen Gesandten am englischen Hofe, der Wallenrodt hieß. Er war ein richtiger Geck, mit einem kurzen rundlichen Gesicht, der nur als Spaßmacher seines Amtes waltete. Diesem Manne hatte sie sich heimlich verlobt, und ihr Plan war dahin gerichtet, meine Oberhofmeisterin zu werden und mir nach England zu folgen. Zu diesem Zwecke hatte sie sich alle Mühe gegeben, um sich bei dem Herzog von Gloucester einzuschmeicheln, und ihm erzählen lassen, dass sie meine Freundin sei, was ihr vonseiten des Herzogs allerlei Aufmerksamkeiten eintrug. Aber es stand ihr noch Fräulein von Sonsfeld im Wege, und sie ließ nicht ab, die Königin gegen sie wie gegen mich zu erbittern.
Diese Person hatte einen allmächtigen Einfluss bei der Königin und nützte ihre Schwächen aus, um zum Ziele zu gelangen. Ich wurde täglich malträtiert, und die Königin warf mir fortgesetzt die Liebenswürdigkeiten vor, die mir der König erwies. Ich wagte kaum mehr, ihn zu liebkosen, und fürchtete jedes Mal die Folgen. Mit meinem Bruder war es ebenso. Sobald der König ihm etwas befahl, pflegte sie es ihm zu verbieten. Wir wussten uns oft nicht mehr Rat, da wir es nicht beiden recht machen konnten. Da aber unsere Zuneigung für die Königin größer war, richteten wir uns nach ihren Wünschen. Dies war die Quelle aller unsrer Leiden, wie man in der Folge sehen wird. Das Herz blutete mir jedoch, weil ich dem König meine Gefühle nicht mehr zu äußern wagte; ich liebte ihn mit Leidenschaft, und er hatte mir tausendfache Freundlichkeiten erwiesen, seit ich auf der Welt war; allein da ich mit der Königin leben musste, war ich genötigt, mich nach ihr zu richten.
Die Königin gebar zu Anfang des Jahres 1726 (Wilhelmine war 17jährig) einen Prinzen, der den Namen Heinrich erhielt. Sobald sie sich erholt hatte, begaben wir uns nach Potsdam, einer kleinen Stadt in der Nähe von Berlin. Mein Bruder blieb zurück; da er sich den Wünschen des Königs nicht unterwerfen wollte, konnte dieser ihn nicht leiden. Er ließ nicht ab, ihn zu schelten, und seine Erbitterung gegen ihn wuchs dermaßen, dass alle Wohlgesinnten der Königin den Rat erteilten, den Kronprinzen zu bewegen, dass er dem König seine Unterwürfigkeit bezeige, was sie bisher nie dulden wollte; dies gab Anlass zu einem recht lächerlichen Auftritt.
Ich hatte auf Befehl der Königin mehrere Dinge heimlich an meinen Bruder geschrieben, sowie auch den Entwurf eines Briefes verfassen müssen, den er an den König richten sollte. Ich saß zwischen zwei chinesischen Fachschränkchen über diesen Briefen, als ich den König kommen hörte; ein Wandschirm stand vor der Türe, so dass ich eben Zeit hatte, meine Papiere hinter eines jener Schränkchen zu schieben. Fräulein von Sonsfeld nahm die Federn, und da ich den König schon kommen sah, steckte ich den Tintenbehälter zu mir, ihn sorgfältig haltend, damit er nicht umstürze. Der König sprach einige Worte mit der Königin und wendete sich dann plötzlich den Schränken zu. „Sie sind gar schön“, sagte er, „und stammen von meiner Mutter, die viel darauf hielt.“ Zugleich näherte er sich, um sie zu öffnen. Das Schloss war ruiniert, er zog an dem Schlüssel, so fest er nur konnte; und ich erwartete jeden Augenblick, dass meine Briefe herausfallen würden. Die Königin kam mir zu Hilfe, aber dadurch geriet ich in eine andere Klemme. Sie hatte einen sehr schönen kleinen Bologneserhund, ich desgleichen, und die beiden Tiere befanden sich im Zimmer. „Meine Tochter behauptet, ihr Hund sei schöner als der meine“, sagte sie zum König, „und ich ziehe den meinen vor. Wollen Sie nicht entscheiden?“ Er lachte und fragte mich, ob ich denn meinen Hund sehr liebe? „Von ganzem Herzen“, sagte ich, „denn er ist so gut und gescheit“; die Antwort machte ihm Spaß, er umarmte mich mehrere Male, und ich war genötigt, das Tintenfass loszulassen. Alsbald floss die schwarze Flüssigkeit über mein Kleid und fing an, am Boden nieder zu tropfen; ich wagte nicht, mich vom Platze zu rühren, aus Furcht, der König könne es sehen. Ich war fassungslos vor Angst. Er erlöste mich, indem er sich entfernte; ich war mit Tinte bis zur Haut durchnässt und musste mich einer Waschung unterziehen; wir lachten herzlich über dies ganze Abenteuer. Der König versöhnte sich indes mit meinem Bruder, der uns nach Potsdam folgte. Er war der liebenswürdigste Prinz, den man sich denken konnte, schön und gut gewachsen, mit einem für sein Alter überlegenen Geist, und er war mit allen Gaben ausgestattet, die einen vollkommenen Fürsten kennzeichnen. Aber hier muss ich einer ernsteren Begebenheit gedenken, in der die Quelle aller Leiden zu suchen ist, die dieser geliebte Bruder und ich erfahren mussten.
Der Kaiser hatte schon seit dem Jahre 1717 (Wilhelmine war 8jährig) in Ostende, einer belgischen Hafenstadt, durch eine Gesellschaft einen Verkehr mit Indien eingeleitet, der mit nur zwei Schiffen anfing, sich jedoch trotz dem Widerstand Hollands so erfolgreich entwickelte, dass sich der Kaiser bewogen fühlte, ihr das Privilegium zu erteilen, auf dreißig Jahre in Afrika und Ostindien mit Ausschluss all seiner andern Untertanen Handel zu treiben. Da der Handel zu den Dingen gehört, die am meisten dazu beitragen, einem Staat zur Blüte zu verhelfen, hatte der Kaiser im Jahre 1725 (Wilhelmine war 16jährig) einen geheimen Vertrag mit Spanien geschlossen, in dem er sich verpflichtete, den Spaniern Gibraltar und Port Mahon zu verschaffen. Russland schloss sich später an. Die Seemächte wurden der geheimen Machenschaften des Wiener Hofes bald gewahr; und um sich den ehrgeizigen Plänen des Hauses Österreich, die nichts weniger als den Handel, das heißt die hauptsächliche Kraft ihrer Staaten ruinieren wollten, zu widersetzen, schlossen sie einen Gegenvertrag, dem auch noch Frankreich, Dänemark, Schweden und Preußen beitraten; es ist derselbe, der in Charlottenburg unterschrieben wurde und den ich schon erwähnte. Der Kaiser sah wohl ein, dass er sich gegen eine so gewaltige Liga nicht würde halten können und sah sich zu andern Maßregeln genötigt: Er suchte nun Zwietracht unter den betreffenden Staaten zu säen. Der General Seckendorff schien ihm die berufene Persönlichkeit, um seine Pläne beim preußischen Hofe auszuführen. Dass dieser Minister mit Grumbkow intim befreundet war, wurde schon erwähnt; er kannte den eigennützigen und ehrgeizigen Charakter dieses letzteren und zweifelte nicht, dass er ihn den Interessen des Kaisers gefügig machen würde. Er wandte sich erst schriftlich an ihn und suchte seine Gesinnung zu ergründen; ja er machte ihm sogar einige Enthüllungen über die Lage, in der sein Landesherr sich befand. Diese Korrespondenz hatte schon im vorhergehenden Jahre ihren Anfang genommen, und Seckendorffs Briefe waren von sehr schönen Geschenken und großen Versprechungen begleitet gewesen. Grumbkows käufliche Seele zeigte sich so verlockenden Aussichten bald empfänglich. Die Umstände kamen ihm dabei zustatten.
Zwischen den Höfen von Preußen und Hannover war eine gewisse Kälte eingetreten. Mein königlicher Vater fühlte sich wegen der Verzögerung meiner Heirat verletzt, und andere Verdrießlichkeiten kamen hinzu. Er hegte nichts so sehr wie den Zuwachs seines Regiments. Die mit der Rekrutierung beauftragten Offiziere führten mit Güte oder mit Gewalt die langen Männer fort, deren sie auf fremdem Gebiete habhaft werden konnten. Die Königin hatte bei ihrem Vater bewirkt, dass das Kurfürstentum Hannover jährlich eine bestimmte Anzahl solcher Leute stellen würde. Aber das hannoveranische Ministerium, vielleicht auf Veranlassung der Anti-Preußen, an deren Spitze Lady Arlington stand, unterließ es, die Order des Königs von England auszuführen. Die Königin erhob wiederholt Beschwerden hierüber, erreichte aber nichts als einige leere Entschuldigungen. Der König fühlte sich über die geringe Rücksicht sehr beleidigt; und Grumbkow trug eifrig Sorge, diese Erbitterung so sehr zu steigern, dass jener, um sich zu rächen, seinen Offizieren den Befehl erteilte, alle Männer, deren Größe sie für sein Regiment geeignet mache, aus Hannover zu entführen. Dieser Gewaltstreich rief eine ungeheure Erregung hervor. Der König von England verlangte Genugtuung und forderte, dass seine Untertanen in Freiheit gesetzt würden; der preußische König weigerte sich hartnäckig und behielt sie, was zwischen beiden Höfen eine Missstimmung hervorrief, die bald genug in offenen Hass ausartete. Die Lage konnte also für Seckendorff, als dieser nach Berlin kam, nicht erwünschter sein. Grumbkows lang betriebene Hetzereien bei dem König erleichterten die Verhandlungen. Seckendorff fand bei diesem sehr gnädige Aufnahme, denn der König kannte ihn schon von früher her, als er noch in sächsischen Diensten stand, und hatte ihn stets sehr geachtet. Eine ganze Anzahl von Heiducken, oder besser gesagt Riesen, die er dem König im Auftrag des Kaisers überwies, brachte ihn noch mehr in Gunst, und das Kompliment, das er dabei dem König vonseiten seines Herrn ausrichtete, gewann jenen vollends. „Da dem Kaiser“, so sagte er, „nichts willkommener ist, als Eurer Majestät sich bei jeder Gelegenheit gefällig zu erzeigen, bewilligt er Ihnen alle Rekrutierungen, die in Ungarn vorgenommen werden und hat bereits Befehl erteilt, dass man alle großen Männer in seinen Staaten ausfindig macht, um sie Ihnen anzubieten.“ Diese große Zuvorkommenheit, die von der Handlungsweise seines Schwiegervaters so sehr abwich, freute den König, doch blieb er noch unschlüssig; und Seckendorff sah wohl ein, dass er ihn nicht so schnell von dem großen Bündnis abbringen würde. Er suchte sich allmählich bei dem König einzuschmeicheln, und da er seine Schwächen erkannte, verstand er trefflich, sie zu nützen. Er gab ihm fast täglich großartige Bankette, zu denen nur seine und Grumbkows Kreaturen geladen waren. Man unterließ nie, das Gespräch auf die gegenwärtige politische Lage zu bringen und auf geschickte Weise die Interessen des Kaisers zu vertreten. Endlich gelang es während eines Gelages, den vom Weine erhitzten König zu bewegen, dass er einigen seiner Verpflichtungen, die er dem König von England angelobt hatte, untreu wurde und sich mit dem Hause Habsburg einließ. Er versprach Letzterm, dass die Truppen, die er kraft eines Artikels des Hannoveranischen Vertrages an England zu stellen habe, nicht gegen Österreich marschieren würden. Dies Versprechen wurde sehr geheimgehalten; denn der König war noch nicht gesonnen, sich vom großen Bündnis loszusagen, da er stets noch auf das Zustandekommen meiner Heirat hoffte. Erst zu Ende des folgenden Jahres, zu dessen Anfang ich jetzt gelangt bin, bekannte er Farbe. Die Königin war außer sich über den Lauf, den jetzt die Dinge nahmen, sie litt persönlich darunter. Der König quälte sie mit fortwährenden Vorwürfen über die Verzögerung meiner Vermählung; er sprach mit schimpflichen Worten von seinem Schwiegervater, dem König, und suchte sie in jeglicher Weise zu kränken.
Seckendorffs Aussichten stiegen mit jedem Tag. Er gewann so großen Einfluss auf den König, dass er über alle Ämter verfügte. Die spanischen Pistolen hatten ihm die meisten Diener und Generale, welche die Umgebung des Königs bildeten, zu Willen gemacht, so dass er von allem, was vorging, unterrichtet war. Da die zwischen Preußen und England beschlossene Doppelheirat ein großes Hindernis für seine Zwecke war, beschloss er, sie unmöglich zu machen, indem er Zwietracht in der Familie säte. Er bediente sich hierzu geheimer Boten; tausend falsche Berichte, die man täglich dem König über meinen Bruder und mich ausstellte, brachten ihn so gegen uns auf, dass er uns schlecht behandelte und dass unser Leben zur Qual wurde. Man schilderte ihm meinen Bruder als einen ehrgeizigen und intriganten Prinzen, der den Tod seines Vaters herbeiwünsche, um bald zur Herrschaft zu gelangen; er hätte keinerlei Interesse für militärische Dinge und sage vor aller Welt, dass er die Truppen verabschieden würde, sobald ihm die Macht zustünde; außerdem sei er verschwenderisch und alles in allem dem König so unähnlich, dass er ihm naturgemäß nur Abneigung entgegenbringen könne. Mich verschonte man auch nicht und sprengte aus, ich sei unerträglich hochmütig, ränkevoll und anmaßend, spiele die Ratgeberin meines Bruders und führe Reden wider den König, die alles andere als respektvoll seien. Da mein Vater auf die Versorgung seiner Töchter sehr bedacht war, suchte ihn Seckendorff auch von dieser Seite zu beeinflussen und forderte den Markgrafen von Ansbach, einen jungen siebzehnjährigen Prinzen, auf, sich nach Berlin zu verfügen, um sich meine jüngere Schwester anzusehen. Dieser Prinz war damals sehr vielversprechend und liebenswürdig. Meine Schwester war engelschön, aber schrecklich launisch und kleinlich. Sie stand jetzt statt meiner in des Königs Gunst. Der schwere Kummer, den sie nach ihrer Verheiratung erdulden musste, hat sie sehr gebessert. Vorerst hinderte die große Jugend der beiden, dass die Heirat vollzogen wurde; dies geschah erst zwei Jahre darauf, wie ich später berichten werde.
Die Königin hatte stets gehofft, dass die Ankunft des Königs von England, der in diesem Jahre nach Deutschland zurückkommen sollte, die Harmonie zwischen den beiden Höfen wiederherstellen würde; allein ein unvorhergesehenes Ereignis machte alle ihre Hoffnungen zunichte, denn sie erhielt die traurige Nachricht vom Tode dieses Fürsten. Er hatte England bei bestem Wohlsein verlassen und wider seine Gewohnheit die Überfahrt gut überstanden. In der Nähe von Osnabrück überfiel ihn ein Unwohlsein. Alle Hilfe, die man ihm bringen konnte, war vergebens; er verschied nach vierundzwanzig Stunden an einem Schlaganfall in den Armen seines Bruders, des Herzogs von York. Dieser Verlust traf die Königin aufs bitterste. Selbst der König schien ihn nicht gefühllos aufzunehmen. Trotz aller seiner Äußerungen wider den König von Großbritannien hatte er ihn doch stets als einen Vater betrachtet, ja ihn sogar gefürchtet; während seiner Kindheit hatte er in dessen Obhut gestanden, zur Zeit, da Friedrich I. nach Hannover flüchtete, um sich vor den Nachstellungen der Kurfürstin Dorothea, seiner Schwiegermutter, zu retten. Beider Trauer wurde noch vermehrt, als sie bald darauf erfuhren, dass jener Monarch den Plan gefasst, meine Heirat zu vollziehen, und beschlossen hatte, sie in Hannover zu feiern. Sein Sohn wurde jetzt zum König von England proklamiert, und der Herzog von Gloucester nahm den Titel Prinz von Wales an.
Indes untergruben all die Gelage, die Seckendorff für den König veranstaltete, dessen Gesundheit: Er fing an zu kränkeln; die Hypochondrie, von der er sehr geplagt war, verfinsterte sein Gemüt. Herr Francke, ein berühmter Pietist und Begründer des Waisenhauses in der Universitätsstadt Halle, trug nicht wenig dazu bei, den König in dieser Stimmung zu erhalten. Dieser geistliche Herr liebte es, Skrupel über die unschuldigsten Dinge in ihm wachzurufen. Er verpönte alle Vergnügungen, die ihm verwerflich schienen, selbst die Jagd und die Musik. Man durfte vor ihm nur von Gottes Wort reden; alle andern Reden waren unstatthaft. Immer gab er bei Tische, wo er wie in den Refektorien das Amt des Vorlesers vertrat, den Vorsprecher ab. Der König hielt uns jeden Nachmittag eine Predigt; sein Kammerdiener stimmte einen Choral an, in den wir alle einstimmten; der Predigt mussten wir mit ebenso großer Aufmerksamkeit lauschen, als hielte sie ein Apostel. Meinen Bruder und mich überkam der Lachreiz, und oft platzten wir los. Plötzlich stieß man dann alle Anatheme der Kirche gegen uns aus, die wir mit reuiger Miene über uns ergehen lassen mussten, was uns recht viel Mühe kostete.
August Hermann Francke
Kurz, dieser Hund Francke war schuld, dass wir wie Trappisten lebten. Ja, diese übertriebene Bigotterie brachte den König auf noch seltsamere Gedanken. Er beschloss, zugunsten meines Bruders abzudanken. Er wollte sich jährlich 10.000 Taler vorbehalten und sich mit der Königin und seinen Töchtern nach Wusterhausen zurückziehen. „Dort“, sagte er, „werde ich zu Gott beten und für die gute Bestellung der Felder sorgen, während meine Frau und meine Töchter das Hauswesen übernehmen werden. Sie sind geschickt“, sagte er zu mir, „ich werde Ihnen die Aufsicht über das Hauslinnen übertragen, das Sie nähen und für dessen Wäsche Sie Sorge tragen werden. Friederike ist geizig und mag als Hüterin der Vorratskammern wirken. Charlotte wird auf den Markt gehen, um Lebensmittel einzukaufen, und meine Frau wird die Obhut über meine kleinen Kinder und über die Küche tragen.“ Er fing sogar an, Instruktionen für meinen Bruder auszuarbeiten, worüber Grumbkow und Seckendorff nicht wenig erschraken. Sie boten vergebens alle ihre Beredsamkeit auf, um diese unheilvollen Gedanken zu verscheuchen; da sie aber einsahen, dass der ganze Entschluss des Königs nur auf seine Gemütsverfassung zurückzuführen sei, und fürchteten, dass, sofern es ihnen nicht gelänge, dieselbe umzustimmen, er wohl imstande wäre, seinen Vorsatz auszuführen, suchten sie ihn zu zerstreuen.
Der sächsische Hof war von jeher mit dem österreichischen eng befreundet, und so richteten sie ihr Augenmerk dorthin und suchten den König zu bereden, nach Dresden zu reisen. Ein Gedanke zieht gewöhnlich einen andern nach sich, und so kamen sie auf den Einfall, mich mit dem König August von Polen verheiraten zu wollen. Dieser zählte damals neunundvierzig Jahre. Seine Liebeshändel waren weltberühmt; er besaß große Eigenschaften, doch wurden sie von seinen zahlreichen Fehlern verdunkelt. Eine zu große Vergnügungssucht ließ ihn das Wohl seines Staates und seiner Untertanen vernachlässigen, und seine Trinksucht verleitete ihn zu Unwürdigkeiten, deren er sich im trunkenen Zustand schuldig machte und die auf immer seinen Namen schädigen werden.
Seckendorff hatte in seiner Jugend in sächsischen Diensten gestanden, und ich sagte schon früher, dass Grumbkow bei diesem König sehr in Gnaden stand. Beide wandten sich jetzt an den Grafen Flemming, einen Günstling dieses Monarchen, um Verhandlungen mit ihm anzubahnen. Graf Flemming war ein Mann von großem Verdienst, der oft nach Berlin kam und mich sehr gut kannte. Er nahm die Eröffnungen der beiden Minister mit Freuden entgegen und suchte die Absichten des Königs hierüber zu sondieren. Dieser schien diesem Antrag ziemlich geneigt und schickte den Grafen nach Berlin, um den König von Preußen zum Karneval nach Dresden einzuladen. Grumbkow und sein Pylades teilten jetzt dem König ihre Pläne mit. Hocherfreut, eine so glänzende Partie für mich zu finden, nahm er die Einladung bereitwillig an; er sandte eine sehr verbindliche Antwort an den Grafen Flemming und brach gegen Mitte Januar 1728 auf, um sich nach Dresden zu begeben.
Mein Bruder war untröstlich, dass er nicht mitreisen durfte. Er sollte während der Abwesenheit des Königs in Potsdam verbleiben, was ihm nicht behagte. Er teilte mir seinen Kummer mit; und da ich ihm mit Vorliebe Freude bereitete, versprach ich ihm, mein möglichstes zu tun, damit er dem König folgen dürfe. Wir kehrten nach Berlin zurück, wo die Königin wie gewöhnlich Cercle hielt. Ich sah dort Herrn von Suhm, den sächsischen Minister, den ich sehr gut kannte und der meinem Bruder sehr zugetan war. Ich sagte ihm, wie leid es dem Kronprinzen sei, nicht nach Dresden eingeladen zu sein. „Wenn Sie ihm eine Freude machen wollen“, fuhr ich fort, „so veranlassen Sie den König von Polen, dass er den König von Preußen auffordere, ihn nachkommen zu lassen.“ Suhm sandte alsbald eine Stafette an seinen Hof, um seinen Herrn, den König, hiervon zu benachrichtigen, der alsbald meinen Vater beredete, meinen Bruder kommen zu lassen. Dieser erhielt Befehl, sich aufzumachen, was er mit tausend Freuden tat.
Der Empfang, der meinem Vater bereitet wurde, war der beiden Monarchen würdig. Da der König von Preußen das Zeremoniell nicht liebte, richtete man sich ganz nach seinen Wünschen. Er wollte bei dem Grafen Wackerbart, den er sehr hochschätzte, Wohnung nehmen. Sein Haus war ungemein prächtig, der König fand hier prunkvolle Gemächer vor. Leider brach in der zweiten Nacht seines Aufenthaltes Feuer aus, und zwar mit solcher Heftigkeit und Schnelligkeit, dass man ihn nur mit Mühe und Not retten konnte. Der ganze herrliche Palast fiel in Schutt. Dieser Verlust wäre für den Grafen Wackerbart sehr verhängnisvoll gewesen, hätte ihn der König von Polen nicht dafür entschädigt. Er schenkte ihm das Pirnaische Haus, das viel prachtvoller noch als das andere war und ein Mobiliar von unschätzbarem Wert enthielt.
Der Hof zu Dresden war damals der glänzendste Deutschlands. Die Pracht war hier bis aufs Äußerste getrieben, und man frönte allen Genüssen; mit Recht durfte er mit der Insel Cythere verglichen werden: Die Damen waren sehr liebenswert und die Herren sehr galant. Der König hielt eine Art von Serail, das aus den schönsten Frauen seines Landes bestand. Als er starb, schätzte man die Zahl der Kinder, die er von seinen Mätressen hatte, auf 354. Der ganze Hof folgte seinem Beispiel; man dachte nur an das Wohlleben, und Bacchus und Venus waren die herrschenden Gottheiten. Der König von Preußen vergaß da gar bald seiner Frömmelei; die ausschweifenden Gelage und der Ungarwein versetzten ihn wieder in gute Laune.
König August von Sachsen und Polen
Er schloss enge Freundschaft mit dem König von Polen, dessen verbindliches Wesen ihn anzog. Grumbkow, der inmitten der Feste seiner Ziele nicht vergaß, wollte sich diese günstige Laune zunutze machen und den König verleiten, sich Mätressen zu halten; er teilte seinen Plan dem König von Polen mit, und dieser übernahm es, ihn auszuführen.
Eines Abends nach einem Trinkgelage führte der König von Polen den König wie von ungefähr in ein reich ausgestattetes Gemach von auserlesenem Geschmack. Mein Vater stand in Bewunderung vor all den Schätzen, als man plötzlich eine Tapetenwand hob und ein höchst unerwarteter Anblick sich darbot. Es war eine weibliche Gestalt im Kostüm der Eva, die nachlässig auf einem Ruhebett ausgestreckt dalag. Das Geschöpf war schöner, als man Venus und die Grazien darstellt; ihr Körper wie aus Elfenbein war weiß wie Schnee und schöner gestaltet als der der medizeischen Venus in Florenz. Das Kabinett, das diesen Schatz in sich barg, war von so vielen Kerzen beleuchtet, dass ihr Schein das Auge blendete und die Schönheit dieser Göttin noch strahlender erschien. Die Veranstalter dieser Komödie zweifelten nicht, dass dieser Anblick das Herz des Königs entzünden würde; allein es kam ganz anders. Kaum hatte der König die Schöne gesehen, als er ihr empört den Rücken zudrehte; und meinen Bruder hinter sich gewahrend, schob er ihn sehr unsanft aus dem Zimmer hinaus; er selbst verließ es auch auf der Stelle und zeigte sich über den Streich sehr ungehalten. Er sprach sich noch am selben Abend sehr nachdrücklich mit Grumbkow darüber aus, nahm sich kein Blatt vor den Mund und erklärte ihm, dass, wenn derartige Szenen sich wiederholten, er unverzüglich abreisen würde. Anders stand es mit meinem Bruder. Trotz der Vorsorge des Königs hatte er vollauf Zeit gehabt, die Venus zu betrachten, die ihm nicht den Abscheu einflößte, den sie bei seinem Vater hervorrief. Sie wurde ihm auf recht eigentümliche Weise durch den König von Polen zuteil.
Mein Bruder hatte sich leidenschaftlich in die Gräfin Orzelska verliebt, die zugleich die natürliche Tochter und die Mätresse des Königs von Polen war. Ihre Mutter war eine französische Kaufmannsfrau in Warschau. Die Gräfin verdankte ihr Glück ihrem Bruder, dem Grafen Rudofski, dessen Geliebte sie gewesen war und der sie mit dem König von Polen, ihrem Vater, bekannt gemacht hatte. Dieser, wie gesagt, hatte so viele Kinder, dass er sich nicht aller annehmen konnte. Die Reize der Orzelska aber rührten ihn so sehr, dass er sie sogleich als seine Tochter anerkannte; er war ihr leidenschaftlich zugetan. Die Aufmerksamkeiten, die ihr mein Bruder erwies, erfüllten ihn mit grausamer Eifersucht. Um diesem Zustand ein Ende zu machen, ließ er ihm die schöne Formera antragen, unter der Bedingung, dass er der Orzelska entsagen würde. Mein Bruder versprach alles, um jene Schönheit besitzen zu dürfen, die seine erste Geliebte wurde.
Indes ließ der König den Zweck seiner Reise nicht außeracht. Er schloss mit dem König August einen geheimen Vertrag, dessen Artikel ungefähr folgende waren: Der König von Preußen verpflichtet sich, eine bestimmte Anzahl von Truppen dem König von Polen zu stellen, um die Polen zu zwingen, die Erblichkeit der Krone dem kurfürstlichen Hause Sachsens zuzuerkennen. Er versprach mich dem König zur Ehe und lieh ihm vier Millionen Taler, meine Mitgift nicht eingerechnet, die sehr ansehnlich sein sollte. Dagegen überließ ihm der König von Polen als Pfand für die vier Millionen die Lausitz. Er sicherte mir darauf ein Witwengehalt von 200.000 Talern, mit der Erlaubnis, nach seinem Tode an einem beliebigen Orte meinen Aufenthalt zu nehmen. Ich sollte meine Religion in Dresden frei ausüben dürfen und eine Kapelle dort errichtet finden, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Und alle diese Artikel sollten von dem Kurprinzen von Sachsen unterschrieben und bestätigt werden. Da mein Vater den König von Polen nach Berlin eingeladen hatte, damit er der Truppenschau beiwohnte, wurde die Unterzeichnung des Vertrages bis dahin verschoben. König August wünschte diesen Aufschub, um seinen Sohn vorzubereiten und ihn zu der Einwilligung, die von ihm erwartet wurde, zu bereden. So schied denn mein Vater in größter Zufriedenheit von Dresden, und er sowie mein Bruder konnten den König von Polen und seinen Hof nicht genug loben.
Während all diese Dinge vor sich gingen, hatte ich in Berlin unter den Nachstellungen der Gräfin Amalie bitter zu leiden. Sie ließ nicht ab, die Königin wider mich aufzuhetzen. Diese quälte mich unaufhörlich; von ihr nahm ich es in Ehrfurcht hin, aber das Benehmen ihrer Vertrauten versetzte mich manchmal in eine schreckliche Wut. Sie behandelte mich von oben herab, was mir unerträglich war; und obwohl sie nur zwei Jahre älter war, wollte sie sich anmaßen, mich zu unterweisen. Trotz aller Erbitterung gegen sie musste ich mich beherrschen und mir nichts merken lassen, und dies war mir ärger als der Tod. Denn ich hasse die Falschheit; meine Offenheit hat mir oft viele Leiden eingetragen, doch ist sie ein Fehler, den ich nicht ablegen möchte. Mein Grundsatz ist, dass man stets gerade Wege einhalten soll und dass man sich keine Reue bereitet, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat. Doch noch ein neues Ungeheuer fing an, sich als Vertraute zu erheben und sich in die Gunst der Königin mit der Gräfin Amalie zu teilen; es war eine ihrer Kammerfrauen, sie hieß Ramen und war dieselbe, die bei der Niederkunft der Königin schleunige Hilfe leistete, als meine Schwester Amalie zur Welt kam. Diese Frau war Witwe, oder, besser gesagt, sie folgte dem Beispiel der Samaritanerin und hatte ebenso viele Gatten, als es Monate im Jahre gibt. Ihre falsche Frömmigkeit, ihre vorgebliche Mildtätigkeit, endlich die Geschicklichkeit, mit der sie ihren lockeren Lebenswandel zu bemänteln wusste, hatten Frau von Blaspiel veranlasst, sie der Königin zu empfehlen. Es gelang ihr, sich zuerst dadurch einzuschmeicheln, dass sie mancherlei Arbeiten, die ihr Spaß machten, gewandt verfertigte; zu ihrer hohen Gunst bei der Königin brachte sie es aber erst durch ihre Zuträgereien über den König. Meine Mutter setzte ein blindes Vertrauen in diese Frau und teilte ihr die geheimsten Angelegenheiten und Gedanken mit. Zwei solche Rivalinnen in der Gunst der Königin konnten sich auf die Dauer nicht vertragen: Die Gräfin Amalie und die Ramen waren geschworene Feindinnen; aber da sie einander fürchteten, hielten sie ihre Feindschaft geheim.
Bald nach der Rückkehr des Königs von Dresden erschien der Marschall Graf von Flemming mit seiner Gemahlin, der Fürstin Radzivill, in Berlin, und zwar als außerordentlicher Gesandter des Königs von Polen. Die Fürstin war jung und unerzogen, aber sehr naiv und lebhaft; ohne schön zu sein, besaß sie Reiz. Der König begegnete ihr mit großer Auszeichnung und forderte die Königin auf, sich in gleicher Weise ihr gegenüber zu verhalten. Sie zeigte mir viel Anhänglichkeit; ihr Mann, der mich von Kindheit auf kannte, war mir sehr zugetan. Da er schon alt war, hatte ihm die Königin erlaubt, mich zu besuchen, soviel er wollte; von dieser Vergünstigung machte er reichlichen Gebrauch und verbrachte alle seine Vormittage bei mir mit seiner Frau, die mir alle Zuvorkommenheiten erwies. Ich war sehr unvorteilhaft gekleidet. Die Königin ließ mich frisieren und kleiden, wie meine Großmutter sich in ihrer Jugend getragen hatte. Die Gräfin Flemming machte ihr darüber Vorstellungen und sagte, am sächsischen Hofe würde man meiner spotten, wenn ich dort so erschiene. Sie ließ mich nach der neuen Mode kleiden, und jedermann sagte, ich sei nicht wiederzuerkennen und viel hübscher, als ich gewesen sei. Meine Taille fing an, sich zu bilden und schlanker zu werden, wodurch mein Äußeres gewann. Die Gräfin sagte täglich tausendmal zur Königin, ich müsste ihre Landesherrin werden. Aber da wir beide nichts von dem Dresdener Vertrag vernommen hatten, hielten wir die Redensarten für leeres Geplänkel. Der Graf hielt sich zwei Monate lang in Berlin auf und verabschiedete sich von mir am Vorabend seiner Abreise, indem er mir wiederholt seine Huldigungen erwies. „Ich hoffe“, sagte er mir, „dass ich Eurer Königlichen Hoheit bald die Beweise meiner unverbrüchlichen Anhänglichkeit geben und Sie so glücklich machen werde, als Sie es verdienen. Ich denke, Sie mit meinem Königlichen Herrn binnen kurzem wiederzusehen.“ Ich verstand den Sinn dieser Rede nicht und glaubte, er wollte mir einfach bekunden, dass er meine Vermählung mit dem Prinzen von Wales betreiben würde. Ich antwortete ihm in verbindlichster Weise, worauf er sich zurückzog.
Einige Tage später fuhren wir nach Potsdam. Die Reise hätte mich zu jeder andern Zeit sehr verdrossen, aber dieses Mal verließ ich Berlin mit Freuden. Ich hoffte, mich wieder in Gunst bei der Königin zu setzen; denn man hatte sie so gegen mich aufgebracht, dass sie mich nicht mehr leiden konnte. Die Unterhandlungen mit England blieben in der Schwebe. Die Königin intrigierte fortwährend wegen meiner Verheiratung, ohne vorwärtszukommen; man hielt sie mit schönen Phrasen hin. Dies alles nahm sie gegen mich ein, denn sie meinte, wenn ich wohlerzogener wäre, so würde ich jetzt schon verheiratet sein. Ich hoffte sie von diesen Gedanken, die ihr die Gräfin Amalie eingegeben hatte, in Abwesenheit dieser Dame abzubringen, allein ich täuschte mich. Sie war so gegen mich erbittert, dass mein Los in Potsdam nicht besser wurde als in Berlin. Die Königin wollte sich sogar bei dem König über mich und meine Hofmeisterin beschweren und ihn bitten, mich einer andern Führung zu übergeben, doch die Furcht hielt sie zurück. Sie kannte die große Achtung, die der König für Fräulein von Sonsfeld hatte, so dass sie besorgen musste, von ihm abgewiesen zu werden. Selbst der Graf Fink, mit dem sie darüber sprach, riet ihr von diesem Schritte dringend ab. Dieser General wusste nichts von den ehrgeizigen Plänen seiner Tochter; er war außerdem ein zu rechtlich gesinnter Mann, als dass er sie gebilligt hätte. Er trat sehr lebhaft für mich und Fräulein von Sonsfeld bei der Königin ein und machte ihr so viele Vorstellungen über die Härte, mit der sie gegen mich wie gegen Fräulein von Sonsfeld verfuhr, dass sie in sich ging. Sie sprach noch am Nachmittag mit mir und sagte mir alles, was sie gegen mich hatte. Es war vor allem das Vertrauen, das ich meiner Erzieherin schenkte, das sie missbilligte; auch verdross es sie, dass ich blindlings die Ratschläge dieser Dame befolgte, und tausend ähnliche Dinge. Ich warf mich ihr zu Füßen und sagte ihr, der Charakter des Fräuleins von Sonsfeld sei derart, dass ich ihr gegenüber keine Geheimnisse haben könne, dass ich ihr alle meine eignen Angelegenheiten anvertraue, aber niemals die der andern; und dass gerade meine Kenntnis ihrer Verdienste mich dazu triebe, die Ratschläge dieser Dame zu befolgen, da ich überzeugt sei, dass es nur gute sein könnten; und dass ich übrigens hierin nur den Befehlen gehorche, die mir die Königin erteilt habe. Ich bat sie dringend, gegen Fräulein von Sonsfeld gerecht zu sein und mich nicht in Verzweiflung zu stürzen, indem sie mir ihre frühere Huld entzöge. Die Königin war von meiner Erwiderung etwas betroffen; sie erging sich in allerlei Ausflüchten, um Beschwerden gegen mich zu finden. Ich versicherte sie meiner Unterwürfigkeit, und endlich schlossen wir Frieden. Zwei Tage später stand ich höher in ihrer Gunst denn je zuvor, und Fräulein von Sonsfeld, der sie absichtlich Kränkungen zuzufügen bestrebt gewesen, wurde jetzt freundlicher behandelt. Ich hätte jetzt in vollkommener Ruhe gelebt, wäre ich nicht durch meinen Bruder darin gestört worden.
Seit seiner Rückkehr von Dresden war er in düsterste Melancholie verfallen. Seine Gesundheit wurde dadurch angegriffen; er magerte zusehends ab, wurde häufig von Schwächezuständen befallen, die befürchten ließen, dass er schwindsüchtig würde. Ich liebte ihn leidenschaftlich, und wenn ich ihn nach der Ursache seines Kummers fragte, gab er stets die schlechte Behandlung des Königs an. Ich suchte ihn zu trösten, so gut ich konnte, doch war alle Mühe vergebens. Sein Übel verschlimmerte sich so sehr, dass man endlich den König benachrichtigen musste. Dieser beauftragte den Generalarzt, ihn zu untersuchen und seine Gesundheit zu überwachen. Über den Bericht, den dieser Mann über den Zustand meines Bruders erstattete, war der König sehr bestürzt: Der Kronprinz wäre sehr krank und von einem schleichenden Fieber befallen, das in Schwindsucht ausarten könnte, wenn er sich nicht schonen und in Behandlung begeben würde. Der König hatte im Grunde ein gutes Herz; obwohl Grumbkow ihm eine große Abneigung gegen den armen Prinzen eingeflößt hatte und trotz der gerechtfertigten Beschwerden, die er gegen ihn zu haben glaubte, überwog jetzt doch die Stimme der Natur. Er machte sich Vorwürfe, den traurigen Zustand des Prinzen durch den Kummer, den er ihm zugefügt, verursacht zu haben. Er suchte das Vergangene gutzumachen, indem er ihn mit Liebesbeweisen überschüttete; doch all dieses nutzte nichts, und man war weit entfernt, die Ursache seines Leidens zu erraten. Endlich entdeckte man, dass es durch nichts anderes als die Liebe entstanden war. Er hatte sich in Dresden an ein ausschweifendes Leben gewöhnt, dem er sich hier nicht länger ergeben konnte, weil ihm die Freiheit mangelte, aber sein Temperament konnte die Entbehrung nicht ertragen. Mehrere Leute setzten in bester Absicht den König davon in Kenntnis und rieten ihm, ihn zu verheiraten, sonst liefe er Gefahr, zu sterben oder Ausschweifungen zu verfallen, die seine Gesundheit zugrunde richten würden. Hierüber äußerte der König in Gegenwart mehrerer junger Offiziere, dass er hundert Dukaten demjenigen geben würde, der ihm die Nachricht brächte, sein Sohn sei von einem hässlichen Übel behaftet. Den Liebesbeweisen und Wohltaten, die er ihm erst erwiesen hatte, folgten nun Vorwürfe und Schelte. Graf Fink und Herr von Kalkstein erhielten Befehl, mehr denn je seinen Wandel zu überwachen. Diese Dinge erfuhr ich alle erst viel später.
Der Tod des Königs von England hatte den König von der großen Allianz endgültig entfernt. Er schloss endlich einen Vertrag mit dem Kaiser, Russland und Sachsen. Wie diese beiden letzteren Mächte, so verpflichtete auch er sich, 10.000 Mann dem Kaiser zu stellen, falls er deren bedürfe. Als Entgelt dafür sicherte ihm der Kaiser die Gebiete von Jülich und Berg zu. Die Königin verzehrte sich vor Leid, alle ihre Pläne vernichtet zu sehen; sie konnte ihre Erbitterung, die sich allein gegen Seckendorff und Grumbkow wandte, nicht verhehlen. Der König sprach oft bei Tische über seinen Vertrag mit dem Kaiser und erging sich dabei jedes Mal in Ausfällen wider den König von England; dabei richtete er stets die Worte an die Königin. Diese übte sofort gegen Seckendorff Vergeltung; und in ihrer Lebhaftigkeit vergaß sie dabei der Schranken. Sie behandelte ihn sehr schimpflich und hart und hielt ihm manchmal Dinge aus seiner Vergangenheit vor, die schlimm anzuhören waren. Seckendorff erstickte fast vor Wut; doch nahm er alles mit einer scheinbaren Fassung hin, die dem König sehr gefiel. Der Teufel verlor dabei nichts, und er wusste sich anders als in Worten zu rächen.
Die Ankunft des Königs von Polen stand nahe bevor; wir kehrten anfangs Mai nach Berlin zurück. Die Königin fand dort Briefe aus Hannover, in denen ihr angekündigt wurde, dass der Prinz von Wales sich inkognito nach Berlin verfügen und sich den Trubel und die Verwirrung, die während der Anwesenheit des Königs von Polen dort herrschen würden, zunutze machen wollte, um mich zu sehen. Über diese Nachricht empfand die Königin eine maßlose Freude; sie setzte mich sofort davon in Kenntnis. Da ich nicht immer ihrer Meinung war, fühlte ich mich nicht in dem Maße beglückt. Ich hatte stets einen Stich ins Philosophische, der Ehrgeiz gehört nicht zu meinen Fehlern; ich ziehe das Glück und die Ruhe der Macht und dem Glanz des Lebens vor. Ich liebe die Welt und ihre Freuden, aber ich hasse die leere Vergnügungssucht. Mein Charakter, so wie ich ihn hier beschreibe, eignete sich nicht für den Hof, dem meine Mutter mich zuführen wollte. Ich war mir dessen bewusst, und darum bangte mir davor, dort leben zu müssen. Die Ankunft mehrerer Damen und Kavaliere aus Hannover brachten meine Mutter auf den Gedanken, dass der Prinz von Wales sich unter ihnen befände. Kein Esel und kein Maultier, hinter dem sie nicht ihren Neffen wähnte; sie schwur sogar, sie habe ihn in Monbijou unter der Menge gesehen. Allein ein zweiter Brief aus Hannover klärte sie über ihren Irrtum auf. Sie erfuhr, dass dieses Gerücht nur durch einen Scherz entstanden sei, den der Prinz von Wales abends bei der Tafel gemacht hatte, wodurch die Meinung hervorgerufen wurde, er würde sich wirklich nach Berlin verfügen.
Der König von Polen kam endlich am 29. Mai an. Er stattete erst der Königin einen Besuch ab. Sie empfing ihn an der Tür ihres dritten Vorzimmers. Der König von Polen reichte ihr die Hand und führte sie in das Audienzzimmer, wo wir ihm vorgestellt wurden. Dieser König war fünfzig Jahre alt, von majestätischem Aussehen, leutselig und verbindlich in seinem Wesen. Er war für sein Alter sehr gebrechlich; seine furchtbaren Ausschweifungen hatten ihm ein Leiden am rechten Fuße zugezogen, so dass er kaum gehen noch lange stehen konnte. Der Brand war schon dazu getreten, so dass man, um den Fuß zu retten, zwei Zehen hatte abnehmen müssen. Die Wunde war stets offen, und er litt große Schmerzen. Die Königin bat ihn, sich zu setzen, was er lange nicht tun wollte; endlich, auf ihr Drängen hin, nahm er auf einem Taburett Platz. Die Königin setzte sich ihm gegenüber auf ein anderes. Da wir stehen blieben, entschuldigte er sich vielmals bei mir und meinen Schwestern wegen seiner Unhöflichkeit. Er betrachtete mich sehr aufmerksam und sagte jeder von uns etwas Verbindliches. Nach einer Stunde zog er sich zurück. Die Königin wollte ihn begleiten, aber er wollte es nicht dulden.
Alsdann meldete sich der Kurprinz von Sachsen bei der Königin zu Besuch. Er ist groß und sehr beleibt, sein Gesicht ist regelmäßig und schön, doch hat er nichts Einnehmendes. Er stellt sich bei allem, was er tut, sehr verlegen an; und um seine Schüchternheit zu verbergen, bricht er oft in ein gezwungenes, äußerst unangenehmes Lachen aus. Er spricht wenig; und es fehlt ihm die Gabe der Leutseligkeit und Verbindlichkeit, die seinem Vater eigen ist. Man könnte ihn sogar der Unaufmerksamkeit und Grobheit zeihen. Diese wenig angenehmen Außenseiten bergen jedoch hohe Eigenschaften, die erst hervortraten, als der Prinz König von Polen wurde. Er hat sich zum Grundsatz gemacht, sich als wahrhaft rechtschaffenen Mann zu zeigen, und nichts gilt ihm höher, als die Wohlfahrt seiner Untertanen. Die, welche sich seine Ungnade zuziehen, dürften sich andernorts gar glücklich schätzen; denn weit entfernt, ihnen etwas anzutun, setzt er ihnen große Pensionen aus. Diejenigen aber, denen er einmal seine Zuneigung schenkte, hat er niemals im Stich gelassen. Sein Leben ist sehr geregelt, man kann ihm kein Laster vorwerfen, und sein gutes Einvernehmen mit seiner Gemahlin muss ihm als Verdienst angerechnet werden. Diese Fürstin war außerordentlich hässlich, und nichts entschädigte sie für ihr unglückliches Äußeres.
Er hielt sich nicht lange bei der Königin auf. Nach diesem Besuche fielen wir wieder in unsere Öde zurück und brachten den Abend wie gewöhnlich in Zurückgezogenheit und fastend zu. Ich sage fastend, denn wir aßen kaum genug, uns zu sättigen. Aber hierüber ein andres Mal.
Der König und der Prinz von Polen soupierten jeder für sich. Am nächsten Tage, einem Sonntag, verfügten wir uns alle nach der Predigt in die großen Staatsgemächer des Schlosses. Die Königin, von ihren Töchtern und den Prinzessinnen von Geblüt begleitet, schritt von einem Ende der Galerie herauf, während von der andern Seite die beiden Könige vortraten. Ich habe nie etwas Schöneres gesehen. Alle Damen der Stadt in ihrem Schmuck bildeten der Galerie entlang Spalier; der König und der Prinz von Polen und ihr Gefolge, das aus dreihundert Würdenträgern, sowohl polnischen als sächsischen, bestand, trugen prachtvolle Gewänder; sie stachen sehr gegen die Preußen ab. Diese waren nur in Uniform, deren Besonderheit auffallend war. Die Röcke sind so kurz, dass sie unseren Vorfahren kaum zu Lendenschürzen gereicht hätten, und so eng, dass sie sich nicht zu rühren wagten, aus Furcht, sie zu zerreißen. Ihre Sommerhosen sind aus weißem Stoff, wie auch ihre Gamaschen, ohne die sie nicht erscheinen dürfen. Das Haar tragen sie gepudert, doch ungelockt und hinten mittels eines Bandes zu einem Schopf gebunden. Der König selbst war so gekleidet. Nach den ersten Begrüßungen stellte man alle die Fremden der Königin und dann mir vor. Der Herzog Johann Adolf von Weißenfels, sächsischer Generalleutnant, war der erste, mit dem wir bekannt wurden. Mehrere andere folgten dann; so der Graf von Sachsen und der Graf Rudofski, beide natürliche Söhne des Königs, Herr von Libski, später Primas und Erzbischof von Krakau, die Grafen von Manteuffel, Lagnasko und Brühl, Günstlinge des Königs, der Graf Solkofski, Günstling des Kurprinzen, und soundso viele andere Leute von Ansehen, die ich übergehe. Der Graf von Flemming fehlte im Gefolge: Er war drei Wochen vorher in Wien zu allgemeinem Bedauern gestorben. Es wurde feierlich Tafel gehalten. Der König von Polen und meine Mutter, die Königin, saßen an einem Ende, mein Vater, der König, saß neben dem König von Polen, der Kurprinz neben ihm, dann folgten die königlichen Prinzen und das Gefolge; ich saß neben der Königin, meine Schwester neben mir und die Prinzessinnen alle ihrem Range gemäß. Man trank sich fleißig zu, man sprach wenig, und die Langeweile war groß. Nach der Tafel zog sich jeder zurück. Abends hielt die Königin großen Empfang. Die Gräfinnen Orzelska und Bilinska, natürliche Töchter des Königs von Polen, erschienen eben sowohl wie die vielberüchtigte Madame Potge. Die erstere war, wie gesagt, die Mätresse ihres Vaters, was grauenvoll ist. Ohne von regelmäßiger Schönheit zu sein, hatte sie etwas sehr Einnehmendes; ihre Figur war vollkommen, und sie hatte ein gewisses Etwas, das Teilnahme einflößte. Ihr Herz war ihrem ältlichen Liebhaber nicht zugeneigt; sie liebte ihren Bruder, den Grafen Rudofski. Dieser war der Sohn einer Türkin, die Kammerzofe bei der Gräfin Königsmark, Mutter des Grafen von Sachsen, gewesen war. Die Orzelska lebte auf großem Fuße und besaß vor allem einen herrlichen Schmuck, da der König ihr den seiner verstorbenen Gemahlin, der Königin, geschenkt hatte. Die Polen, die mir des Morgens vorgestellt worden waren, zeigten sich sehr überrascht, weil ich ihre barbarischen Namen aussprach und sie wiedererkannte. Sie waren über meine Liebenswürdigkeit sehr erfreut und sagten laut, dass ich ihre Königin werden müsse. Tags darauf war große Truppenschau. Die beiden Könige speisten zusammen ohne Gefolge, und wir zeigten uns nicht. Am folgenden Abend wurde die Stadt illuminiert; wir erhielten die Erlaubnis, sie zu besichtigen; ich habe nichts Schöneres gesehen. Alle Häuser in den Hauptstraßen waren mit Devisen und so vielen brennenden Lampions geschmückt, dass es das Auge blendete. Zwei Tage darauf war ein Ball in den großen Schlosssälen angesetzt; man spielte dabei Lotterie, und ich zog den König von Polen. Am folgenden Tage wurde in Monbijou ein großes Fest gegeben, die ganze Orangerie wurde illuminiert, was prächtig aussah. In Berlin nahmen die Feste nur ein Ende, um in Charlottenburg wieder anzufangen. Es gab deren mehrere sehr glänzende. Ich genoss davon nur wenig. Die schlechte Meinung, die mein Vater, der König, vom weiblichen Geschlecht hatte, war schuld, dass er uns in schrecklicher Unterdrückung hielt und dass die Königin wegen seiner Eifersucht größte Vorsicht bewahren musste. Am Tage der Abreise des Königs von Polen hielten beide Könige, was man eine „Vertrauenstafel“ nennt. Sie heißt also, weil dabei nur auserwählte Freunde zugezogen werden. Diese Tafel ist so eingerichtet, dass man sie mittels Rollen herablassen kann. Man braucht keine Dienerschaft: statt ihrer dienen trommelähnliche Dinger, auf die jeder Gast aufschreibt, was er essen will, und die er so hinablässt; sie steigen dann mit dem Gewünschten wieder in die Höhe. Dieses Mahl dauerte von ein Uhr bis zehn Uhr abends. Bacchus kam dabei zu Ehren, und die beiden Könige spürten die Wirkung des göttlichen Saftes. Sie hoben die Tafel nur auf, um sich zur Königin zu verfügen. Dort wurde ein paar Stunden gespielt; ich kam daran, mit dem König von Polen und der Königin zu spielen. Er sagte mir viel Verbindliches und spielte falsch, um mich gewinnen zu lassen. Nach dem Spiel verabschiedete er sich von uns und ging, von neuem dem Gott der Reben zu opfern. Er reiste, wie ich schon sagte, am selben Abend ab. Der Herzog von Weißenfels hatte mir während seines Aufenthaltes in Berlin große Aufmerksamkeiten erwiesen. Ich hatte sie lediglich der Höflichkeit zugeschrieben und hätte mir nie träumen lassen, dass er es wagen würde, den Gedanken einer Heirat mit mir zu fassen. Er war der jüngere Sohn eines Hauses, das, obwohl sehr alt, nicht zu den vornehmsten Häusern Deutschlands zählt; ich war nicht ehrgeizigen, aber auch nicht niedrigen Sinnes, so dass ich die wirklichen Gefühle des Herzogs gar nicht erriet. Darin irrte ich mich, wie man später sehen wird.
Ich habe seit unsrer Abreise von Potsdam meinen Bruder nicht mehr erwähnt. Seine Gesundheit fing an sich zu bessern; aber er stellte sich kränker, als er war, um von der Festtafel, die in Berlin stattfinden sollte, dispensiert zu sein, da er nicht hinter dem Kurprinzen von Sachsen rangieren wollte, was der König unweigerlich von ihm gefordert hätte. Er erschien am darauffolgenden Montag. Seine Freude, die Orzelska wiederzusehen, und ihr Entgegenkommen, das sie ihm durch geheime Zusammenkünfte bewies, stellten ihn vollends her. Mein königlicher Vater verließ uns indes, um sich nach Preußen zu begeben; er ließ meinen Bruder in Potsdam, gestattete aber, dass er wöchentlich zweimal der Königin seine Aufwartung mache. Während dieser Zeit unterhielten wir uns vortrefflich. Der Hof war glänzend wegen der vielen Fremden, die herzu strömten. Überdies sandte der König von Polen seine geschicktesten Virtuosen an die Königin, wie den berühmten Weiß, der so herrlich Laute spielte, dass ihm kein andrer gleichkam und die nach ihm kommen, höchstens den Ruhm ernten können, seine Nachahmer genannt zu werden; dann Bufardin, der große Flötenbläser, und Quantz, der dasselbe Instrument spielte und ein großer Komponist war, dessen Geschmack und hohe Kunst der Flöte den Klang der schönsten Stimme verleihen konnte. Während wir in ruhigen Freuden unsere Tage verbrachten, suchte der König von Polen seinen Sohn zu bewegen, den Vertrag zu unterzeichnen, der meine Heirat betraf, aber so sehr er ihn auch bestürmte, der Kurprinz blieb bei seiner Weigerung. Da so der König von Preußen die Unsicherheit all der mir wie ihm darin gebotenen Vorteile erkannte, annullierte er alle Entschlüsse, die auf Grund jenes Vertrages gefasst worden waren, und verhinderte meine Heirat. Die Königin und ich erfuhren erst viel später davon. Sie war hocherfreut, dass diese Unterhandlung ergebnislos geblieben war, sie intrigierte noch immer mit den Gesandten Frankreichs und Englands. Diese unterrichteten sie über alles, was sie unternahmen, stets, und da sie beim König ihre bezahlten Spione hatte, trug sie den Herren wieder alles zu, was sie ihrerseits vernahm. Aber der König vergalt ihr Gleiches mit Gleichem, ihm stand die Ramen zu Diensten, die Kammerfrau und Vertraute der Königin, die vor der Kreatur nichts geheimhielt und ihr allabendlich ihre geheimsten Gedanken sowie alle Schritte anvertraute, die sie tagsüber unternommen hatte. Die Person ermangelte nicht, durch den unwürdigen Eversmann und den elenden Holtzendorff, ein neues Ungeheuer von Günstling, den König zu benachrichtigen. Sogar mit Seckendorff stand sie in Verbindung, wie ich durch meine treue Mermann erfuhr, die sie täglich um die Dämmerstunde im Hause dieses Ministers verschwinden sah. Der französische Gesandte Graf von Rottenburg hatte längst herausbekommen, dass alle seine Pläne durch Verräter an Seckendorff gelangten, er setzte alle Hebel in Bewegung und entdeckte auf diese Weise die Intrigen der Ramen. Er wollte die Königin in Kenntnis setzen, aber der englische Gesandte Mr. Dubourgay, und der Dänemarks, namens Lövener, hielten ihn ab; sie waren alle drei aufs höchste erzürnt, sich so genarrt zu sehen. Ja, es kam zu einem Auftritt zwischen dem Grafen Rottenburg und mir. „Die Königin“, sagte er, „hat alle unsere Maßregeln zunichte gemachte; wir sind alle übereingekommen, ihr nichts mehr anzuvertrauen, aber wir wollen uns an Sie wenden, Hoheit. Wir sind von Ihrer Diskretion überzeugt, und Sie werden ebenso gut imstande sein, uns richtig zu instruieren wie die Königin.“ „Nein“, erwiderte ich, „machen Sie mir nie, ich bitte Sie, derartige Mitteilungen, ich empfange sie nur ungern von der Königin; ich weiß am liebsten von solchen Angelegenheiten nichts, ich habe nichts damit zu tun und mische mich nicht in Dinge, die mich nichts angehen.“ „Sie betreffen aber Ihr Glück, Hoheit“, sagte der Graf, „wie das Ihres Bruders und der ganzen Nation.“ „Zugegeben,“ erwiderte ich, „aber ich habe mich bisher nicht mit der Zukunft befasst, denn ich bin zum Glück ohne Ehrgeiz, und meine Auffassung hierüber ist von der anderer vielleicht sehr verschieden.“ Auf diese Weise befreite ich mich von den Zudringlichkeiten des Gesandten. Der König war indes über alle Intrigen der Königin sehr ungehalten, doch ließ er sich trotz seines heftigen Temperaments nichts merken. Anderseits waren Grumbkow und Seckendorff über das Scheitern ihrer polnischen Heiratspläne nicht wenig in Verlegenheit. Es galt nun, eine andere Partie für mich ausfindig zu machen; denn sie wussten wohl, dass, solange ich nicht verheiratet sei, der König sich nie ganz für ihre Pläne gewinnen lassen würde. Er wünschte nach wie vor, mich mit dem Prinzen von Wales vermählt zu sehen, und nahm deshalb noch auf den König von England Rücksicht. Die beiden Minister schmiedeten also zusammen eine neue Intrige.
Der König war inzwischen aus Preußen zurückgekehrt, und sechs Wochen später befanden wir uns mit ihm in Wusterhausen. In Berlin hatten wir eine zu angenehme Zeit verlebt, als dass sie hätte von Dauer sein können, und aus dem Himmel, in dem wir gewesen waren, fielen wir jetzt ins Fegefeuer; dies wurde uns ein paar Tage nach unsrer Ankunft in dem schrecklichen Orte fühlbar gemacht. Der König hatte eine Unterredung mit der Königin, während der meine Schwester und ich ins Nebenzimmer geschickt wurden. Obwohl die Tür geschlossen war, ließ der Ton ihrer Stimmen bald erkennen, dass sie einen heftigen Streit hatten; ich hörte sogar oft meinen Namen nennen, worüber ich sehr erschrak. Dies Gespräch währte anderthalb Stunden, worauf der König mit zornigem Gesicht heraustrat. Ich kehrte sodann in das Zimmer zurück und fand die Königin in Tränen. Sobald sie mich sah, umarmte sie mich und hielt mich lange umfangen, ohne ein Wort zu sprechen. „Ich bin untröstlich“, sagte sie endlich; „man will Sie verheiraten, und der König ist auf die unvernünftigste Partie verfallen, die sich denken lässt. Er will Sie dem Herzog von Weißenfels geben, einem lumpigen Niemand, der nur von der Gnade des Königs von Polen lebt; nein, ich überlebe es nicht, wenn Sie sich dazu erniedrigen.“ Ich glaubte zu träumen, als ich dies alles vernahm, so seltsam dünkte es mir. Ich wollte sie beruhigen, indem ich ihr versicherte, dass es dem König unmöglich damit Ernst sein konnte und dass er ihr dies alles nur gesagt habe, um sie zu erschrecken; dessen sei ich überzeugt. „Aber mein Gott“, rief sie, „der Herzog wird spätestens in einigen Tagen hier sein, um sich mit Ihnen zu verloben; nun heißt es Mut, ich werde Ihnen mit allen Kräften helfen, nur müssen Sie mir beistehen.“ Ich versprach ihr alles, fest entschlossen, einer solchen Partie nicht zuzustimmen. Im Grunde gab ich nicht viel darauf, wurde aber eines Besseren belehrt, als am selben Abend Briefe aus Berlin an die Königin gelangten, die diese schönen Nachrichten bestätigten. Ich verbrachte eine schreckliche Nacht; die üblen Folgen waren mir nur zu gegenwärtig, und ich sah die Uneinigkeit voraus, die in unsrer Familie herrschen würde. Mein Bruder, der ein geschworener Feind von Seckendorff und Grumbkow und ganz für England eingenommen war, sprach sehr eindringlich mit mir. „Sie verderben uns alle“, sagte er, „wenn Sie diese lächerliche Heirat eingehen. Ich sehe freilich, dass uns allen viel Verdruss wegen dieser Sache bevorsteht, aber lieber alles ertragen, als in die Hände seiner Feinde fallen; England ist unser einziger Rückhalt, und wenn Ihre Heirat mit dem Prinzen von Wales nicht zustande kommt, ist es unser aller Unglück.“ Die Königin äußerte sich in demselben Sinn, sowie meine Hofmeisterin; aber ich bedurfte all dieser Ermahnungen nicht, und die Vernunft sagte mir zur Genüge, was ich zu tun hatte. Der reizende Gatte, den man mir zugedacht, kam am Abend des 27. Septembers an. Der König meldete es alsbald der Königin und befahl ihr, ihn wie einen Prinzen, der als ihr Schwiegersohn ausersehen sei, zu empfangen, da beschlossen sei, mich ihm sofort zu verloben. Dies veranlasste eine neue Szene, und zum Schlusse verharrten wieder beide auf ihrem Standpunkt. Am nächsten Morgen, es war Sonntag, gingen wir zur Kirche. Der Herzog wandte während des ganzen Gottesdienstes kein Auge von mir ab. Mir war schrecklich zumute. Seitdem diese Angelegenheit schwebte, hatte ich Tag und Nacht keine Ruhe mehr.
Sobald wir aus der Kirche zurückgekehrt waren, stellte der König den Herzog der Königin vor. Sie würdigte ihn keines Wortes und drehte ihm den Rücken zu. Ich hatte mich schnell davongemacht, um der Begegnung zu entgehen. Essen konnte ich nicht das Geringste, und mein Aussehen wie meine Miene verrieten nur zu wohl, was in mir vorging. Die Königin hatte nachmittags wieder einen schrecklichen Auftritt mit dem König. Sobald sie allein war, ließ sie den Grafen Fink, meinen Bruder und meine Hofmeisterin rufen, um mit ihnen zu beraten, was hier zu machen sei. Der Herzog von Weißenfels galt für einen verdienstvollen, doch nicht sehr begabten Fürsten: alle waren der Meinung, dass die Königin mit ihm verhandeln solle. Graf Fink übernahm den Auftrag. Er stellte dem Herzog vor, dass die Königin sich nie zu dieser Heirat verstehen werde und dass ich eine unüberwindliche Abneigung gegen ihn hege; er würde, falls er bei seiner Absicht beharre, unfehlbar Zwietracht in die Familie bringen; die Königin sei entschlossen, es ihm außerordentlich sauer zu machen, wenn er darauf bestünde; sie sei aber überzeugt, dass er sie nicht zum Äußersten treiben wolle; sie zweifle nicht, dass er als Mann von Ehre lieber seine Anträge aufgeben als mich unglücklich sehen würde, und in diesem Falle würde sie alles tun, um ihm ihre Hochachtung und ihre Dankbarkeit zu beweisen. Der Herzog bat den Grafen Fink, der Königin zu erwidern: er könne nicht leugnen, dass er sich von meinen Reizen sehr gefesselt fühle, dass er jedoch nie das Glück angestrebt hätte, um mich zu freien, wären ihm nicht sichere Hoffnungen in Aussicht gestellt worden; da wir ihm aber beide abgeneigt seien, würde er der erste sein, der den König von diesem Plane abbringen wolle, und die Königin könne darüber beruhigten Herzens sein. In der Tat hielt er Wort und ließ dem König ungefähr dieselben Dinge sagen, die er dem Grafen Fink zu wissen gab, mit dem Unterschied, dass er den König bitten ließ, falls die Hoffnungen betreffs meiner Vermählung mit dem Prinzen von Wales zunichtewürden, ihm den Vorzug vor andern Freiern – gekrönte Häupter ausgenommen – zuzubilligen. Der König war über dies Verfahren sehr überrascht, begab sich alsbald zur Königin und suchte sie vergeblich zu überreden, in diese Heirat einzuwilligen. Der Streit entspann sich von neuem. Die Königin weinte, schrie und flehte so lange, bis der König endlich nachgab, jedoch unter der Bedingung, dass sie an die Königin von England schriebe, um eine bestimmte Erklärung betreffs meiner Vermählung mit dem Prinzen von Wales zu fordern. „Ist die Antwort günstig“, sagte der König, „so löse ich auf immer jede andere Verbindlichkeit; wenn sie sich aber nicht endgültig erklärt, so mögen sie in England wissen, dass ich mich nicht länger narren lasse; sie werden ihresgleichen an mir finden, und ich will dann zeigen, dass ich Herr bin, meine Tochter zu verloben, wie es mir gefällt. Glauben Sie nicht, Madame, dass Ihr Wehklagen und Ihre Tränen mich dann noch beirren werden; sagen Sie nun Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin, wie es sich damit verhält, sie selbst werden unsren Zwist entscheiden. Die Königin erwiderte, dass sie bereit sei, nach England zu schreiben, und nicht zweifle, dass ihre Verwandten ihren Wünschen Gehör schenken würden. „Das wird sich zeigen, sagte der König; „ich wiederhole es Ihnen noch einmal: Kein Pardon für Ihr Fräulein Tochter, wenn die Antwort nicht befriedigend ist; und was Ihren schlecht beratenen Herrn Sohn betrifft, so denken Sie nicht, dass ich ihn mit einer Prinzessin von England vermählen werde. Ich will keine dünkelhafte Schwiegertochter, die nichts wie Intrigen an meinen Hof bringt, wie Sie; Ihrem Flegel von einem Sohn werde ich eher die Peitsche als eine Frau geben, er ist mir ein Gräuel, aber ich werde ihn zurechtbringen (dies war sein üblicher Ausdruck). Zum Teufel auch, wenn er sich nicht bessert, so werde ich ihm auf eine Weise kommen, die er nicht erwartet.“ Er setzte noch einige Schmähungen für meinen Bruder und mich hinzu, dann ging er fort.
Sobald er sich entfernt hatte, überlegte die Königin, was sie nun tun solle. Wir erwarteten nichts Gutes und dachten uns wohl, der König von England würde von meiner Heirat, ohne die meines Bruders, nichts wissen wollen. Da die Königin sich gerne Hoffnungen hingab, wurde sie gereizt, weil wir ihr die Hindernisse vor Augen hielten und die traurige Lage, in die sie wie ich geraten würden, falls die Antwort aus England nicht unsern Wünschen gemäß ausfiele. Sie wandte sich wider mich und sagte mir erzürnt, dass sie wohl merke, wie ich schon eingeschüchtert und entschlossen sei, den dicken Johann Adolf zu heiraten; dass sie mich aber lieber tot als mit ihm vermählt sähe, und mich tausendmal verfluchen würde, wenn ich fähig wäre, mich so weit zu vergessen, ja mit ihren eignen Händen möchte sie mich erdrosseln, wenn ich einer solchen Absicht fähig wäre. Dennoch ließ sie den Grafen Fink kommen, um ihn zu Rate zu ziehen. Dieser General sagte ihr dasselbe wie ich. Sie fing nun an, besorgt zu werden, besann sich eine Weile und sagte plötzlich: „Mir kommt ein Gedanke, der, wir mir scheint, uns sicher aus der Verlegenheit ziehen wird, aber an meinem Sohne ist es, ihn auszuführen: er muss an die Königin schreiben und ihr feierlich versprechen, ihre Tochter zu heiraten, sofern sie die Heirat seiner Schwester mit dem Prinzen von Wales zustande bringt, anders werden wir unsern Plan nie durchsetzen.“ In diesem Augenblick trat mein Bruder herein. Sie machte ihm den Vorschlag; er zögerte nicht, ihr zu willfahren. Wir bewahrten alle ein tiefes Schweigen, und ich missbilligte diesen Schritt durchaus, den ich für unheilvoll hielt, ohne ihn doch hindern zu können. Die Königin drang darauf, dass mein Bruder seinen Brief sofort schriebe. Sie fügte den ihren hinzu und ließ beide durch einen Kurier bestellen, den Herr Dubourgay heimlich absandte. Sie verfasste einen andern Brief, den sie dem König unterbreitete und der mit der Post abging. Der Herzog von Weißenfels befreite uns auch von seiner lästigen Gegenwart, was uns Zeit ließ aufzuatmen, aber unsere Sorgen nicht von uns nahm.
Seckendorff und Grumbkow umschmeichelten mittlerweile den König; sie hielten zusammen häufige Trinkgelage. Als sie eines Tages wacker zechten, ließ man einen großen Becher in Form eines Humpens bringen, den der König von Polen dem König von Preußen geschenkt hatte. Es war ein Humpen aus vergoldetem Silber von getriebener Arbeit. Er enthielt einen andern Becher aus Gold, dessen Deckel aus einem mit Edelsteinen besetzten kuppelartigen Knopf bestand. Man leerte die beiden Gefäße mehrmals in der Runde; vom Weine erhitzt, sprang mein Bruder auf den König los und umarmte ihn wiederholt. Seckendorff wollte es verhindern, allein er stieß ihn unsanft zurück, fuhr fort, meinen Vater zu liebkosen, indem er ihm versicherte, dass er ihn zärtlich liebe, von der Güte seines Herzens überzeugt sei und die Ungnade, von der er sich täglich betroffen fühle, nur den bösen Eingebungen gewisser Leute zuschreibe, welche aus dem Zwist, den sie in der Familie nährten, Nutzen zu ziehen suchten; er wolle den König lieben, ehren und ihm zeitlebens unterwürfig sein. Dieser Ausbruch erfreute den König sehr und schaffte meinem Bruder auf vierzehn Tage einige Erleichterung, aber die Stürme folgten auf diese kurze Ruhezeit. Der König fing von neuem an, meinem Bruder auf das härteste zu begegnen. Nicht die geringste Erholung war ihm vergönnt; die Musik, die Lektüre, die Künste und Wissenschaften waren ebenso viele Verbrechen, welche ihm untersagt waren. Niemand wagte es, mit ihm zu reden; kaum, dass er die Königin besuchen durfte; sein Leben war das traurigste der Welt. Trotz des Verbotes des Königs befliss er sich der Wissenschaften und machte große Fortschritte. Da er aber so viel sich selbst überlassen blieb, ergab er sich den Ausschweifungen. Seine Hofmeister wagten nicht, ihm zu folgen, und so verfiel er ihnen völlig. Einer der Pagen des Königs, namens Keith, wurde der Vermittler seiner Vergnügungen. Dieser junge Mann hatte sich bei ihm so sehr einzuschmeicheln gewusst, dass mein Bruder ihn leidenschaftlich liebte und ihm sein ganzes Vertrauen schenkte. Ich wusste von diesem Lebenswandel nichts, hatte jedoch bemerkt, wie vertraulich er mit dem Pagen umging, und hielt es ihm öfters vor, mit der Bemerkung, dass solche Manieren sich für ihn nicht ziemten. Er entschuldigte sich jedoch immer damit, dass dieser Knabe als sein Zwischenträger walte und er ihn schonen müsse, da ihm durch dessen Benachrichtigungen viel Verdruss erspart bliebe.
Meine eignen Angelegenheiten beunruhigten mich indessen auch zur Genüge, mein Schicksal sollte sich nun entscheiden. Meine Abneigung gegen den Prinzen von Wales wurde durch die Lobreden der Königin nur noch vermehrt. Die Schilderungen, die sie mir von ihm entwarf, waren nicht nach meinem Geschmack. „Er ist gutherzig“, sagte sie, „aber von sehr geringem Verstand, eher hässlich als schön und sogar etwas verwachsen. Sofern Sie sich ihm nur gefällig zeigen und seine Ausschweifungen dulden, werden Sie ihn gänzlich beherrschen und nach dem Tode seines Vaters mehr König sein als er. Bedenken Sie nur, wie groß Ihre Macht sein wird; von Ihnen wird das Wohl und Wehe Europas abhängig sein, und Sie werden die Nation beherrschen.“ Indem sie so zu mir sprach, verkannte die Königin meine wahren Gefühle. Ein Mann wie ihr Neffe hätte ihr zugesagt. Allein die Grundsätze, die ich mir über die Ehe gebildet hatte, wichen sehr von den ihrigen ab. Ich erachtete, dass eine gute Ehe auf gegenseitige Achtung und Rücksicht gegründet sein müsse. Ich wollte, dass sie sich auf gegenseitiger Zuneigung aufbaue, und mein Entgegenkommen wie meine Aufmerksamkeiten sollten nur die Folge davon sein. Nichts fällt uns schwer, wo wir lieben; aber kann man lieben, ohne wieder geliebt zu werden? Die wahre Liebe duldet keine Teilung. Ein Mann, der Mätressen hat, schließt sich an diese an; und in dem Maße verringert sich in ihm die Liebe für die rechtmäßige Gemahlin. Welche Achtung und Rücksicht könnte man einem Manne erzeigen, der sich gänzlich beherrschen lässt und das Wohl seines Landes vernachlässigt, um sich wilden Vergnügungen hinzugeben? Ich wünschte nur einen wirklichen Freund, dem ich mein Herz und mein ganzes Vertrauen zu schenken vermöchte; dem ich Neigung und Zuversicht entgegenbrächte und der mein Glück, wie ich das seine, machen könnte. Ich ahnte wohl, dass der Prinz von Wales sich nicht für mich eignete, da er nicht alle Eigenschaften besaß, die ich forderte. Anderseits entsprach mir der Herzog von Weißenfels noch minder. Von dem großen Missverhältnis zwischen uns abgesehen, war auch der Altersunterschied zu groß, ich zählte neunzehn, er dreiundvierzig Jahre. Sein Gesicht war eher unangenehm als sympathisch; er war klein und schrecklich dick; er war weltgewandt, insgeheim aber brutal und bei alledem von sehr lockeren Sitten. Man stelle sich vor, wie mir im Herzen zumute war! Meine Hofmeisterin wusste darüber Bescheid, und nur ihr konnte ich mich anvertrauen.
Durch den Hochmut der Königin wurden die Dinge vollends verdorben. Grumbkow hatte mit dem Gelde, das ihm vom Kaiser zugeflossen war, in Berlin ein sehr schönes Haus gekauft. Es war ihm gelungen, dieses auf Kosten aller regierenden Häupter auszustatten. Der verstorbene König von England und die Kaiserin von Russland hatten dazu beigesteuert. Er bat nun die Königin um ihr Bildnis, das, wie er sagte, seinem Hause den größten Glanz verleihen würde. Die Königin versprach es ihm willig. Sie ließ sich gerade um diese Zeit von dem berühmten Pesne malen, und das Porträt war für die Königin von Dänemark bestimmt. Da nur der Kopf desselben fertig war, als sie nach Wusterhausen abreiste, befahl sie dem Maler, eine Kopie herzustellen, weil sie nur Fürstinnen Originale gäbe. Der Minister erschien eines Tages, um der Königin zu danken, und sprach seine Freude aus, ein so vollendetes Werk zu besitzen.
Antoine Pesne mit Frau und Tochter
„Es ist Pesnes Meisterwerk“, fuhr er fort, „man kann sich nichts Ähnlicheres und Gelungeneres denken.“ Die Königin sagte leise zu mir: „Mir scheint, hier liegt das Missverständnis vor, dass man ihm das Original anstatt der Kopie gegeben hat“; und zugleich fragte sie ihn laut. „Da der König“, erwiderte er, „die Gnade hatte, mir sein Bildnis im Original zu schenken, so darf ich wohl füglich das Porträt Eurer Majestät als gleiches Gegenstück besitzen, ich habe es vom Maler abholen lassen, es ist wundervoll.“ „Und mit welchem Recht?“ versetzte die Königin. „Denn ich zeichne keinen Privatmann mit einem Originale aus und gedenke nicht, mit Ihnen eine Ausnahme zu machen.“ Sie wollte ihm bei diesen letzten Worten den Rücken kehren, aber er hielt sie auf und beschwor sie, ihm das Porträt zu überlassen. Sie verweigerte es auf höchst unfreundliche Weise und machte sehr bissige Bemerkungen über ihn, während sie sich zurückzog.
Sobald der König zur Jagd gegangen war, erzählte sie die Szene dem Grafen Fink. Dieser freute sich, Grumbkow, auf den er persönlich sehr geladen war, einen Streich spielen zu können, und redete der Königin zu, ihm die Unverschämtheit seines Verfahrens heimzuzahlen. Es wurde also beschlossen, alsbald nach ihrer Rückkehr nach Berlin einige Leute ihrer Dienerschaft zu Grumbkow ins Haus zu schicken, um das Porträt zurückzuverlangen und ihm zugleich sagen zu lassen, dass er weder Original noch Kopie erhalten solle, solange er ihr gegenüber sein Benehmen nicht ändere und ihr nicht die Achtung, die man einer Königin schulde, bezeigen lerne. Dieser glückliche Gedanke wurde gleich am nächsten Tage zur Tat. Wir kehrten an diesem Tage in die Stadt zurück; und die Königin schickte sich eiligst an, ihre Befehle zu erteilen, um ja nicht durch Vorstellungen, die ihr gemacht werden könnten, aufgehalten zu werden. Grumbkow, der vielleicht schon durch die Ramen von dem Vorhaben der Königin verständigt worden war, hörte die Ansprache, die ihm der Lakai der Königin hielt, mit ironischer Miene an. „Nehmen Sie das Porträt nur wieder mit“, sagte er, „ich besitze die so vieler andrer großer Fürsten, dass ich mich trösten kann, dieses entbehren zu müssen.“ Doch verfehlte er nicht, den König von der Beleidigung, die ihm zugefügt worden war, in Kenntnis zu setzen, und zwar auf möglichst boshafte Weise; weder er noch seine Familie setzten mehr den Fuß zur Königin. Er äußerte sich in maßloser Weise gegen sie, und seine giftige Zunge war erfinderisch, die Königin ins Lächerliche zu ziehen; wenn er es sich nur damit hätte genügen lassen! Allein er rächte sich durch die Tat, wie wir in der Folge sehen werden. Die Gutgesinnten trachteten, diese Angelegenheit zu schlichten. Grumbkow berief sich beim König auf den Respekt, den er für alles hege, was ihn beträfe, und brachte etwas wie Entschuldigungen bei der Königin vor; diese gab ihm eine höfliche Erwiderung, was scheinbar ihrem Zwist ein Ende machte.
Da man in England mit der Antwort zögerte, fing die Königin an, sich zu beunruhigen. Sie pflog jeden Tag Unterredungen mit Herrn Dubourgay, die meistens zu nichts führten. Endlich nach vier Wochen liefen die langersehnten Briefe ein. Der eine, der zur Lektüre für den König bestimmt war, hatte folgenden Inhalt: „Der König, mein Gemahl“, schrieb die Königin von England, „ist durchaus geneigt, das Bündnis, das sein verewigter Vater mit Preußen geschlossen hat, noch enger zu gestalten und sich zur Doppelehe seiner Kinder bereit zu erklären; doch kann er keine entscheidende Antwort geben, bevor er das Parlament nicht einberief.“ Dies hieß ausweichen und eine unbestimmte Antwort geben. Der andere Brief war nicht besser: Er enthielt nur Ermahnungen an die Königin, sie möchte doch den Einschüchterungen des Königs betreffs meiner Heirat mit dem Herzog von Weißenfels mutig standhalten; die Partie sei wirklich nicht ernst zu nehmen und könne nur eine Finte des Königs sein. Der an meinen Bruder gerichtete Brief lautete auch nicht anders. Nie hat der Anblick des Medusenhauptes so großen Schrecken eingeflößt, wie ihn nun das Herz der Königin beim Lesen dieser Briefe erfüllte; sie hätte sie am liebsten verheimlicht und sich entschlossen, ein zweites Mal nach England zu schreiben, um günstigere Antwort zu erhalten, wäre sie von Herrn Dubourgay nicht verständigt worden, dass diesem die gleichen, dem König mitzuteilenden Nachrichten zugegangen seien. Die Königin sprach aufs eindringlichste mit dem Gesandten und verhehlte ihm nicht ihre Unzufriedenheit über die Handlungsweise, die der englische Hof ihr gegenüber an den Tag legte; sie trug ihm auf, ihrem Bruder, dem König, zu melden, dass alles verloren sei, wenn er nicht anders verführe.
Die Ankunft des Königs erfolgte einige Tage später. Kaum war er ins Zimmer getreten, als er sich erkundigte, ob der Brief aus England eingetroffen sei. „Ja“, erwiderte die Königin und erkühnte sich zu der Behauptung: „Er ist nach Wunsch“, und sie reichte ihm den Brief. Der König nahm ihn, las und gab ihn ärgerlich zurück. „Ich sehe wohl“, sagte er, „dass man mich wieder hintergehen will, aber ich lasse mich nicht prellen.“ Damit ging er hinaus und suchte Grumbkow auf, der in seinem Vorzimmer wartete. Er blieb zwei volle Stunden bei ihm und kehrte nach dieser Unterredung mit heiterer, offener Miene zu uns zurück. Er erwähnte die Sache nicht mehr und war mit der Königin sehr freundlich. Sie ließ sich durch seine Zärtlichkeit täuschen und vermeinte, dass alles zum Besten läge. Aber ich traute der Sache nicht. Ich kannte den König, und seine Verstellungskunst weckte größere Besorgnisse in mir als seine Heftigkeit. Er blieb nur einige Tage in Berlin und kehrte nach Potsdam zurück.
Das Jahr 1729 fing gleich mit einem neuen Ereignis an. Herr de la Motte, ein hannoveranischer Offizier, kam heimlich nach Berlin und wohnte bei Herrn von Sastot, Kammerherrn der Königin, mit dem er nahe verwandt war. „Ich bin“, sagte er zu ihm, „mit außerordentlich wichtigen Botschaften betraut, die aber höchste Diskretion erfordern und mich nötigen, meinen Aufenthalt geheimzuhalten; ich habe einen Brief für den König, doch mit strengstem Befehl, ihn unmittelbar in seine Hände zu legen; deshalb habe ich mich an niemanden hier gewandt und habe hier keinerlei Bekanntschaften. Ich hoffe daher, dass Sie als mein Verwandter und alter Freund mich aus der Verlegenheit ziehen und die Depeschen dem König zukommen lassen werden.“ Diese vertraulichen Eröffnungen erfüllten Sastot mit Neugierde. Er drang in de la Motte, ihm den Grund seiner Reise anzuvertrauen. Nach langem Widerstreben gestand de la Motte endlich, er sei vom Prinzen von Wales geschickt worden, um dem König zu melden, dass er entschlossen sei, heimlich und ohne Wissen seines königlichen Vaters aus Hannover zu entfliehen und nach Berlin zu kommen, um mich zu heiraten. „Sie sehen nun wohl“, sagte de la Motte, „dass der ganze Erfolg des Planes einzig davon abhängt, dass er nicht verraten wird. Da man mir aber nicht untersagte, es auch der Königin mitzuteilen, stelle ich es Ihnen anheim, sie zu unterrichten, falls Sie glauben, dass sie schweigen kann.“ Sastot erwiderte, dass er der Sicherheit halber Fräulein von Sonsfeld ins Vertrauen ziehen und sie um ihren Rat fragen würde. Ich war einige Tage zuvor von einem heftigen Fieber und einer Erkältung befallen worden. Sastot traf Fräulein von Sonsfeld bei der Königin, der sie eben über mein Befinden Bericht erstattete. Sobald er mit ihr sprechen konnte, teilte er ihr die Ankunft de la Mottes und die Neuigkeiten, die er erfahren hatte, mit und bat sie, ihm zu raten, ob man es der Königin sagen solle. Sastot und Fräulein von Sonsfeld wussten beide, dass sie vor der Ramen nichts geheimhielt und dass also Seckendorff sicher alles erfahren würde. Aber nach reiflicher Überlegung beschlossen sie endlich, die Königin in Kenntnis zu setzen. Ihre Freude über diese Nachricht war unbeschreiblich; sie konnte sie weder vor der Gräfin Fink noch vor Fräulein von Sonsfeld verheimlichen. Beide mahnten sie zur Verschwiegenheit und hielten ihr die schlimmen Folgen vor Augen, die daraus entstünden, wenn der Plan bekannt würde. Sie versprach ihnen alles, und zu meiner Hofmeisterin sich wendend, sagte sie: „Gehen Sie zu meiner Tochter, sie auf die gute Nachricht vorzubereiten; ich werde morgen zu ihr kommen, um selbst mit ihr zu sprechen, aber trachten Sie besonders, dass sie bald wieder ausgehen kann.“ Fräulein von Sonsfeld kam alsbald zu mir: „Ich weiß nicht, was Sastot hat“, sagte sie, „er gebärdet sich wie ein Narr, er singt, er tanzt, und dies vor Freude, wie er sagt, einer guten Nachricht halber, die er nicht verraten darf.“ Ich achtete nicht darauf, und da ich nichts erwiderte, fuhr sie fort: „Ich bin doch neugierig, was es ist; denn er sagt, dass es Sie betrifft.“ „Ach“, sagte ich, „was für eine gute Nachricht könnte mir in meiner gegenwärtigen Lage zugehen, und woher sollte Sastot solche erhalten?“ „Von Hannover“, sagte sie, „und vielleicht vom Prinzen von Wales in Person.“ „Ich sehe nichts so Glückliches dabei“, gab ich zurück; „Sie wissen zur Genüge, wie ich hierüber denke.“ „In der Tat, Hoheit“, erwiderte sie, „allein ich fürchte sehr, dass Gott Sie strafen wird, weil Sie stets nur Verachtung für einen Prinzen finden, der Ihnen so ergeben ist, dass er die Ungnade seines Vaters, des Königs, nicht scheut und sich vielleicht mit seiner ganzen Familie überwerfen wird, um Sie zu heiraten. Zu welcher Partie wollen Sie sich denn entschließen? Es bleibt keine Wahl: Lieben Sie den Herzog von Weißenfels oder den Markgrafen von Schwedt, oder wollen Sie unvermählt bleiben? Wahrhaftig, Sie machen mich unglücklich, und im Grunde wissen Sie gar nicht, was Sie wollen.“ Ich musste über ihr Ungestüm lachen, da ich nicht annahm, dass sie Nachrichten von wirklichem Belange hatte. „Die Königin hat vermutlich solche Briefe wie vor sechs Monaten erhalten“, sagte ich, „und sie sind wohl der Grund Ihrer schönen Ansprache.“ „Keineswegs“, versetzte sie; und nun erzählte sie mir von der Botschaft de le Mottes. Jetzt sah ich wohl, dass die Sache ernst war, und das Lachen verging mir. Dafür befiel mich ein heftiger Kummer, der meiner Gesundheit nicht förderlich war. Die Königin kam tags darauf zu mir. Nachdem sie mich mehrmals zärtlich umarmt hatte, bestätigte sie mir alles, was ich schon von Fräulein von Sonsfeld wusste. „So werden Sie denn endlich glücklich! Welche Freude für mich!“ Ich küsste ihre Hände und benetzte sie mit Tränen. „Aber Sie weinen“, fuhr sie fort, „was ist Ihnen?“ Ich machte mir ein Gewissen daraus, ihre Freude zu stören. „Der Gedanke, Sie zu verlassen“, sagte ich zu ihr, „betrübt mich mehr, als alle Kronen der Welt mich erfreuen könnten.“ Meine Antwort rührte sie; sie liebkoste mich und ging dann weg. An diesem Abend hielt die Königin Cercle. Ihr Unstern wollte, dass Herr Dubourgay, der englische Gesandte, zugegen war. Er teilte wie gewöhnlich der Königin mit, was er von seinem Hof für Nachrichten erhalten hatte; so entspann sich ein Gespräch, bei dem die Königin, all ihrer Versprechen vergessend, ihm den Plan des Prinzen von Wales kundtat. Herr Dubourgay schien überrascht und fragte, ob sie es denn gewiss wüsste. „So gewiss“, sagte sie, „dass de la Motte von ihm hierher gesandt wurde und dem König schon die Mitteilung gemacht hat.“ Dubourgay zuckte darauf die Achseln. „Wie unglücklich bin ich“, sagte er, „dass Eure Majestät mir etwas anvertraut haben, was Sie mir ebenso verheimlichen mussten wie Herrn von Seckendorff. Mein Gott, wie beklagenswert ist meine Lage, da ich mich genötigt sehe, heute Abend einen Kurier nach England zu schicken, um meinen Herrn, den König, in Kenntnis zu setzen, der nicht ermangeln wird, die Pläne seines Sohnes, des Prinzen, zu durchkreuzen. Allein ich kann nicht anders handeln.“ Man stelle sich den Schrecken der Königin vor! Sie bot alles auf, um Dubourgay von seinem Vorhaben abzubringen, allein er zeigte sich unerbittlich und zog sich auf der Stelle zurück. Zum Unglück hatte sie sich auch der Ramen anvertraut. Seckendorff, der durch diese Person von allem unterrichtet worden war, hatte sich nach Potsdam begeben, um den König zu benachrichtigen und ihn zu verhindern, dass er eine Antwort gebe. Die Gräfin Fink erzählte mir dies alles tags darauf. Die Mine war gesprengt, es blieb also nichts übrig, als zu trachten, dass die Indiskretion der Königin nicht zu Ohren des Königs gelange. Dieser kam acht Tage später nach Berlin. Trotz aller Einwürfe Seckendorffs ließ er de la Motte kommen, empfing ihn aufs Beste und bezeigte ihm seine Ungeduld, den Prinzen von Wales zu sehen. Er gab ihm einen Brief für diesen Prinzen und trieb ihn an, so schnell als möglich abzureisen, um dessen Ankunft zu beschleunigen. Aber die Dinge hatten sich indessen sehr geändert. Das Zögern des Königs und die Unvorsichtigkeit der Königin ließen dem Schreiben des englischen Gesandten Zeit, nach England zu gelangen. Da es an den Staatssekretär gerichtet war, drang man in den König von England, ja nötigte ihn, einen andern Kurier nach Hannover zu senden, um dem Prinzen von Wales zu befehlen, unverzüglich nach England zurückzukommen. Dieser Kurier traf kurz vor der Abreise des Prinzen ein. Da er an das Ministerium geschickt worden war, blieb nichts anderes übrig, als sich dem Befehl zu fügen; und so war der Prinz genötigt, sich aufzumachen, während der König und die Königin in Berlin überglücklich ihn erwarteten. Ihre Freude verwandelte sich bald in Bestürzung durch die Ankunft einer Stafette, die ihnen die plötzliche Abreise des Prinzen nach England mitteilte.
Mit dem ganzen Geheimnis hatte es aber die folgende Bewandtnis. Die englische Nation verlangte dringend, dass sich der Prinz in seinem zukünftigen Königreich aufhalte. Sie hatte mehrmals sehr ausdrücklich bei dem König darauf bestanden, doch ohne einen günstigen Beschluss zu erlangen. Denn der König wollte seinen Sohn nicht nach England kommen lassen, weil er voraussah, dass seine Anwesenheit Parteiungen hervorrufen würde, die seinem eignen Ansehen nur zum Nachteil gereichen konnten. Er hatte jedoch eingesehen, dass er sich dem Wunsche der Nation nicht dauernd widersetzen durfte. So hatte er heimlich an seinen Sohn geschrieben, er möge sich nach Berlin verfügen und mich heiraten; doch verbot er ihm zugleich, ihn, den König, mit diesem Schritt zu kompromittieren. Auf diese Weise war ein guter Vorwand gefunden, um sich mit dem Prinzen von Wales zu überwerfen und ihn in Hannover zu lassen, ohne dass die Nation sich darüber beschweren konnte. Die Indiskretion der Königin und das Schreiben Dubourgays machten diesen ganzen Plan zunichte und zwangen den König, die Forderung der Engländer zu erfüllen. Der arme de la Motte musste den Sündenbock abgeben; er wurde auf zwei Jahre in die Festung Hameln eingesperrt und dann kassiert. Aber mein Vater nahm ihn nach seiner Freilassung in seinen Dienst, und er steht heute noch an der Spitze eines Regiments. Dies alles verschlimmerte nur mein Los. Der König war mehr denn je gegen seinen Schwager aufgebracht und beschloss, nunmehr rücksichtslos vorzugehen, sofern ihm nicht durch meine Heirat Genugtuung geboten würde.
Wir folgten ihm bald darauf nach Potsdam, wo er an beiden Füßen von heftigen Gichtschmerzen befallen wurde. Diese Krankheit im Verein mit dem Ärger über seine zerstörten Hoffnungen machten, dass er von unerträglich schlechter Laune war. Die Leiden des Fegefeuers konnten den unseren nicht gleichkommen. Wir waren gezwungen, früh neun Uhr in seinem Zimmer zu erscheinen; wir speisten dort und durften es unter keinem Vorwand verlassen. Den ganzen Tag überhäufte er meinen Bruder und mich mit Schmähungen. Der König nannte mich nur noch die englische Canaille, und mein Bruder hieß der Schuft von einem Fritz. Er zwang uns, Dinge zu essen und zu trinken, die uns widerstanden oder die unsrer Konstitution zuwider waren, was uns manchmal nötigte, in seiner Gegenwart alles von uns zu geben, was wir im Magen hatten. Jeden Tag kam es zu bösen Auftritten, und man konnte nicht aufschauen, ohne irgendeinen Unglücklichen auf eine oder die andere Weise gequält zu sehen. In seiner Ungeduld hielt es der König nicht im Bett aus, er ließ sich in einem Rollstuhl durch das ganze Schloss fahren. Seine beiden Arme waren auf zwei Krücken gestützt. Wir folgten diesem Triumphwagen wie arme Gefangene, die ihres Urteiles harren. Der arme König hatte große Schmerzen und eine schwarze Galle, die sich in sein Blut ergossen hatte war Grund an seiner üblen Laune.
Eines Morgens, da wir zur Begrüßung bei ihm eintraten, schickte er uns weg. „Hinaus mit Ihren verwünschten Kindern!“ fuhr er die Königin an, „ich will allein bleiben.“ Die Königin wollte antworten, allein er gebot ihr zu schweigen und befahl, dass man bei der Königin auftrage. Die Königin war beunruhigt; aber mein Bruder und ich waren beide hocherfreut, denn wir wurden spindeldürr, so wenig hatten wir zu essen. Kaum waren wir aber bei Tische, als einer der Lakaien atemlos hereinlief. „Um Gottes willen, Majestät, kommen Sie“, rief er, „der König will sich erdrosseln.“ Die Königin eilte sehr erschrocken hinzu. Sie fand den König, einen Strick um den Hals und dem Ersticken nahe, wäre sie nicht zu Hilfe gekommen. Er hatte starkes Fieber, und das Blut stieg ihm heftig zu Kopfe; gegen Abend fühlte er sich jedoch etwas besser. Wir waren alle hocherfreut, da wir hofften, seine Verstimmung würde sich jetzt legen; allein es kam anders. Er sagte mittags zur Königin, dass er Briefe aus Ansbach erhalten habe, die ihm mitteilten, dass der junge Markgraf im Mai nach Berlin zu kommen beabsichtige, um meine Schwester zu heiraten, und dass er seinen Hofmeister, Herrn von Bremer, senden würde, um ihr den Verlobungsring zu überreichen. Er fragte meine Schwester, ob sie sich freue und wie sie ihren Hausstand einzurichten gedenke. Meine Schwester hatte sich mit ihm auf den Fuß gestellt, dass sie ihm alles freiheraus sagte, sogar Wahrheiten, ohne dass es ihn erzürnte. Sie gab ihm also mit ihrer üblichen Offenheit zur Antwort, dass sie einen guten und reichlich bestellten Tisch führen würde, „der“, fügte sie hinzu, „besser als der Ihre sein wird; und wenn ich Kinder bekomme, so werde ich sie nicht malträtieren wie Sie, noch sie zwingen, Dinge zu essen, die ihnen widerstehen.“ „Was meinen Sie damit“, fragte der König, „was ist es, das auf meinem Tische fehlt?“ „Es fehlt daran“, sagte sie, „dass man nicht satt wird und dass das wenige nur aus schweren Gemüsen besteht, die wir nicht vertragen können.“ Der König war schon über die erste Antwort aufgebracht, über diese letzte geriet er außer Rand und Band, aber sein ganzer Zorn fiel auf meinen Bruder und mich. Er warf erst einen Teller an den Kopf meines Bruders, der dem Wurfe auswich; dann ließ er einen in meine Richtung fliegen, und ich vermied ihn ebenso. Auf diese ersten Feindseligkeiten folgte nun ein Hagel von Schmähungen. Er wandte sich wider die Königin und warf ihr die schlechte Erziehung ihrer Kinder vor; und zu meinem Bruder gewendet, sagte er: „Sie sollten Ihre Mutter verwünschen, denn sie ist schuld an Ihrer schlechten Disziplin. Ich hatte einen tüchtigen Mann zum Hofmeister und erinnere mich stets einer Geschichte, die er mir in meiner Jugend erzählte: Es war einmal ein Mann in Karthago, der wegen mehrerer Verbrechen zum Tode verurteilt worden war. Auf dem Wege zum Richtplatz verlangte er, mit seiner Mutter zu sprechen. Man ließ sie kommen. Er näherte sich ihr, wie um ihr etwas ins Ohr zu sagen, biss ihr aber dabei mit den Zähnen ein Stück davon ab. ‚Ich behandle dich also‘, sagte er zu ihr, ‚damit du anderen Eltern als Beispiel dienst, die nicht Sorge tragen, ihre Kinder tugendhaft zu erziehen‘. Merken Sie sich dies“, fuhr er, immer zu meinem Bruder gewendet, fort; und da dieser ihm keine Antwort gab, fing er von neuem an, uns zu schmähen, bis er nicht mehr sprechen konnte. Wir erhoben uns von Tische; und da wir an ihm vorbeigehen mussten, schlug er mit seiner Krücke nach mir, aber ich wich zum Glück aus, sonst hätte er mich zu Boden geschlagen. Er verfolgte mich noch eine Zeitlang von seinem Rollstuhl aus, doch die, welche ihn schoben, ließen mir Zeit, in das Zimmer der Königin zu entfliehen, das sehr entfernt lag. Ich kam halbtot vor Schrecken und so zitternd dort an, dass ich auf einem Stuhl zusammenbrach, unfähig, mich auf den Füßen zu halten. Die Königin war mir gefolgt und tat alles, um mich zu trösten und mich zu bewegen, zum König zurückzukehren. Die Teller und Krücken hatten mich so erschreckt, dass ich mich recht schwer entschloss, ihr zu willfahren. Wir gingen jedoch in das Zimmer des Königs zurück und trafen ihn in ruhiger Unterhaltung mit seinen Offizieren. Ich blieb nicht lange, weil mir schlecht wurde; und ich verfügte mich wieder in das Gemach der Königin, wo ich zweimal in Ohnmacht fiel. Ich blieb eine Weile dort. Die Kammerfrau der Königin, die mich aufmerksam beobachtet hatte, rief: „Mein Gott! Hoheit, was fehlt Ihnen? Sie sehen furchtbar aus!“ „Ich weiß nicht“, sagte ich, „aber ich fühle mich recht elend.“ Sie brachte mir einen Spiegel, und ich war sehr erstaunt, Gesicht und Hals voll roter Flecken zu finden; ich schrieb es der gehabten Aufregung zu und achtete nicht darauf. Aber sobald ich in das Zimmer des Königs zurückkehrte, verschwand diese Röte wieder, und ich fiel abermals in Ohnmacht. Es kam daher, dass ich eine ganze Flucht von ungeheizten Zimmern passieren musste, in denen eine schreckliche Kälte herrschte. Nachts wurde ich von einem heftigen Fieber befallen und fühlte mich tags darauf so krank, dass ich mich bei der Königin entschuldigen ließ. Aber sie ließ mir sagen, dass ich tot oder lebendig zu ihr kommen müsse. Ich ließ ihr antworten, dass ich einen Ausschlag habe und unmöglich erscheinen könne. Doch ließ sie wieder denselben Befehl an mich ergehen. So schleppte man mich denn nach ihrem Zimmer, wo ich von einer Schwäche in die andere fiel; und in diesem Zustand wurde ich vor den König geführt.
Da meine Schwester mich so krank sah und mich für sterbend hielt, machte sie den König, der meiner nicht geachtet hatte, darauf aufmerksam. „Was fehlt Ihnen?“ sagte er; „Sie sehen ganz verändert aus, aber ich werde Sie bald kurieren!“ Und er ließ mir zugleich einen großen Becher voll alten sehr starken Rheinweins geben, den er mich auszutrinken zwang. Kaum hatte ich ihn geleert, als mein Fieber zunahm und ich zu phantasieren anfing. Die Königin sah wohl, dass ich weggebracht werden musste; man trug mich in mein Zimmer und legte mich mitsamt meinem Kopfputz zu Bett, da ich strengen Befehl hatte, abends wieder zu erscheinen. Aber es währte nicht lange, bis mein Zustand sich arg verschlimmerte. Dr. Stahl, den man rufen ließ, hielt meine Krankheit für ein hitziges Fieber und gab mir mehrere Medikamente, die mein Übel nur noch steigerten. Ich verbrachte diesen und den folgenden Tag in fortwährendem Delirium. Sobald ich wieder zu mir kam, machte ich mich auf den Tod gefasst. In solch kurzen Zwischenräumen ersehnte ich ihn sogar; und wenn ich Fräulein von Sonsfeld und meine gute Mermann weinend an meinem Bette sah, suchte ich sie zu trösten, indem ich ihnen sagte, dass ich von der Welt losgelöst sei und den Frieden finden würde, den mir niemand mehr rauben könnte. „Ich bin schuld“, sagte ich, „an allem Kummer, den die Königin und mein Bruder zu leiden haben. Wenn ich sterben soll, so sagen Sie dem König, ich hätte ihn stets geliebt und geachtet; ich hätte mir nichts gegen ihn vorzuwerfen, so dass ich hoffte, er würde mich vor meinem Tode segnen. Sagen Sie, dass ich ihn flehentlich bitte, mit der Königin und mit meinem Bruder besser umzugehen und alle Zwietracht und Feindseligkeit mit mir zu begraben. Dies ist mein einziger Wunsch und das einzige, was mich in meinem jetzigen Zustand noch bekümmert.“ Ich schwebte vierundzwanzig Stunden zwischen Leben und Tod, worauf sich die Blattern bei mir zeigten. Der König hatte sich, seitdem ich erkrankt war, nicht nach mir erkundigen lassen. Als er aber vernahm, dass ich die Blattern hatte, schickte er seinen Chirurgen Holtzendorff zu mir, um zu hören, wie es mit mir stand. Dieser rohe Mensch richtete mir die härtesten Dinge vonseiten des Königs aus und fügte selbst welche hinzu. Ich war so krank, dass ich nicht darauf achtete. Doch bestätigte er dem König, was diesem von meinem Zustand berichtet war. Seine Sorge, meine Schwester könnte von dem ansteckenden Übel befallen werden, ließ ihn alle erdenklichen Vorkehrungen treffen, aber auf eine Weise, die recht hart für mich war. Ich wurde alsbald wie eine Staatsgefangene behandelt; man versiegelte alle Zugänge nach meinem Zimmer und ließ nur von einer einzigen Seite den Zutritt frei. Die Königin wie ihr ganzer Hausstand erhielten strengen Befehl, nicht zu mir zu gehen, desgleichen mein Bruder. Ich blieb allein mit meiner Hofmeisterin und der armen Mermann, die in andern Umständen war und mich Tag und Nacht mit beispielloser Treue und Anhänglichkeit pflegte. Ich lag in einem Zimmer, in dem die bitterste Kälte herrschte. Die Suppe, die man mir brachte, bestand nur aus Wasser und Salz; und wenn nach einer andern verlangt wurde, hieß es, der König habe gesagt, sie sei gut genug für mich. Wenn ich gegen Morgen ein wenig einschlief, wurde ich vom Trommelgewirbel jäh aufgeweckt; allein der König hätte mich lieber umkommen lassen, als es abzustellen. Zum Unglück wurde auch die Mermann krank. Da alle Anzeichen auf eine Fehlgeburt schließen ließen, musste sie nach Berlin gebracht werden, und es trat eine zweite Kammerfrau an ihre Stelle, die sich täglich betrank und somit außerstande war, mich zu pflegen. Mein Bruder, der die Blattern schon gehabt hatte, ließ mich nicht im Stich. Sobald er erfuhr, von welcher Krankheit ich befallen war, kam er heimlich zweimal des Tages, um mich zu besuchen. Die Königin, die mich nicht sehen durfte, erkundigte sich hinterrücks fortwährend nach mir. Neun Tage hindurch schwebte ich in großer Gefahr; alle Symptome meines Übels ließen den Tod erwarten, und alle, die mich sahen, waren der Meinung, dass, wenn ich davonkäme, ich traurig entstellt sein würde. Aber meine Laufbahn war noch nicht zu Ende, und ich war all den Schicksalsschlägen vorbehalten, von denen in diesen Memoiren die Rede sein wird. Dreimal hatte ich Rückfälle; waren die Blattern abgetrocknet, so brachen sie von neuem aus. Trotzdem blieben keine Narben zurück, ja, meine Haut war viel reiner geworden als zuvor.
Inzwischen kam Herr von Bremer im Auftrag des Markgrafen von Ansbach nach Potsdam. Er überreichte meiner Schwester den Verlobungsring, was ohne jegliche Zeremonie vor sich ging. Der König war von seiner Gicht vollständig hergestellt, mit seiner Gesundheit hatte sich auch seine Laune gebessert. Nur ich war noch der Stein des Anstoßes; Holtzendorff besuchte mich von Zeit zu Zeit auf Befehl des Königs, doch richtete er mir jedes Mal unangenehme Dinge aus. Er suchte die Teilnahme, die er mir vonseiten seines Herrn aussprechen sollte, stets in möglichst verletzende Worte zu kleiden. Dieser Mensch war eine Kreatur Seckendorffs und stand beim König so sehr in Gnaden, dass alles vor ihm kroch. Er benutzte seinen Einfluss nur, um Unglückliche zu machen, und hatte nicht einmal das Verdienst, ein guter Arzt zu sein. Mit meinem Bruder ging jetzt der König etwas besser um, auf Anraten Seckendorffs und Grumbkows, die den König vollständig beeinflussten. Die plötzlichen Sinneswandlungen, die sie schon bei ihm wahrgenommen hatten, hielten stete Furcht in ihnen wach. Sie besorgten mit Recht, der König von England könnte sich zuletzt doch zur Doppelheirat entschließen, so dass ihr ganzer Plan dadurch hinfällig würde. Von den fortwährenden Intrigen, welche die Königin bei dem englischen Hofe unterhielt, waren sie wohlunterrichtet, sowie von dem Briefe, den mein Bruder dorthin geschrieben hatte. So schmiedeten sie endlich den abscheulichsten all ihrer Pläne, um jegliches Übereinkommen mit dem König von England zu verhindern. Dieser Plan ging dahin, im preußischen Herrscherhaus vollständige Uneinigkeit zu säen und meinen Bruder so weit zu bringen, dass er infolge der Misshandlungen seines Vaters sich zu irgendeinem raschen Schritte hinreißen ließ, wodurch er wie ich ihnen überantwortet würde. Der Graf Fink stand ihnen dabei im Wege. Mein Bruder achtete ihn; und seine Eigenschaft als Hofmeister verlieh ihm eine gewisse Autorität über seinen Zögling, wodurch er ihn abhalten konnte, nachteilige Handlungen zu begehen. Sie stellten also dem König vor, mein Bruder sei jetzt achtzehn Jahre alt und brauche keinen Mentor mehr, und indem man den Grafen Fink verabschiede, würde allen Intrigen der Königin, deren Agent er sei, ein Ende gemacht werden. Dem König leuchtete dies ein. Die beiden Hofmeister wurden also in allen Ehren verabschiedet; sie erhielten beide stattliche Pensionen und nahmen ihre militärischen Stellungen wieder ein. An ihrer statt erhielt jetzt mein Bruder zwei militärische Begleiter. Der eine war der Oberst von Rochow, ein sehr redlicher Mann, doch herzlich unbegabt, der andere der Major von Keyserling, der auch durchaus rechtschaffen, aber leichtsinnig und geschwätzig war, den Schöngeist spielte und weiter nichts als eine umgestürzte Bibliothek war. Mein Bruder konnte sie beide gut leiden, aber Keyserling als der ausschweifendere und jüngere war ihm infolgedessen lieber.
Dieser geliebte Bruder verbrachte alle seine Nachmittage bei mir; wir lasen, schrieben zusammen und suchten unsern Geist zu bilden. Ich kann nicht verhehlen, dass unser Geschreibe sehr oft satirisch war, wobei der Nächste nicht verschont wurde. Ich erinnere mich, dass die Lektüre von Scarrons humoristischem Roman uns zu einer komischen Anwendung auf die kaiserliche Clique veranlasste. Wir nannten Grumbkow den Ränkeschmied, Seckendorff den Plünderer und den König den Brummer. Gewiss war es strafbar von mir, die Ehrfurcht, die ich dem König schuldete, so zu verletzen; aber ich habe nicht die Absicht, mich selbst zu schonen noch mich zu entschuldigen. Wenn Kinder auch noch so viele Gründe zur Klage wider ihre Eltern haben, so dürfen sie doch nicht die schuldige Achtung vergessen. Ich machte mir seitdem die Fehler meiner Jugend in dieser Hinsicht oft zum Vorwurf, aber die Königin, statt uns zu rügen, ermunterte uns durch ihren Beifall, die schönen Satiren fortzusetzen. Ihre Hofmeisterin Frau von Kamecke blieb darin nicht verschont, obwohl wir große Achtung für die Dame hatten, konnten wir nicht umhin, ihre Lächerlichkeiten wahrzunehmen und sie zu bespötteln. Da sie äußerst dick war, nannten wir sie Madame Bouvillon, eine andere, ihr ähnliche Figur in jenem Roman. Wir trieben mehrmals in ihrer Gegenwart damit Scherz, so dass sie sehr neugierig wurde, wer denn diese Madame Bouvillon, von der so viel die Rede war, sei. Mein Bruder machte ihr weis, es sei die Camera Major der Königin von Spanien. Als eines Tages nach unserer Rückkehr nach Berlin Cercle gehalten wurde und vom spanischen Hofe die Rede war, ließ sie sich gar einfallen, zu bemerken, dass die Camera Majors alle aus der Familie der von Bouvillons seien. Alles lachte ihr ins Gesicht; und ich wusste vor Lachen gar nicht, wie ich mich halten sollte. Sie merkte wohl, dass sie eine Dummheit gesagt hatte, und informierte sich bei ihrer Tochter, die sehr belesen war, was denn damit sei. Diese enthüllte ihr das Geheimnis. Sie wurde sehr böse auf mich, da sie einsah, dass ich nur Possen mit ihr getrieben hatte; und nur mit Mühe konnte ich sie wieder versöhnen. Ein satirischer Charakter ist wenig achtenswert; man gewöhnt sich unmerklich daran und verschont dann weder Freund noch Feind. Nichts ist leichter, als die lächerlichen Seiten des Nächsten herauszufinden. Jeder hat die seinen. Es ist freilich unterhaltend, eine Person, die uns gleichgültig ist, auf geistreiche Weise zu foppen; aber zugleich ist es hart, zu denken, dass es einem selbst vielleicht einmal so ergehen wird. Wie sind wir Menschen doch blind! Wir reiten auf den Fehlern der anderen, während wir der eignen nicht achten. Ich habe mich von diesem Hange gänzlich befreit und verspotte nur noch gerne diejenigen Leute, die einen schlechten Charakter haben und durch ihre böse Zunge verdienen, dass man ihnen Gleiches mit Gleichem vergilt. Aber ich komme zu meinem Gegenstand zurück.
Da die Ankunft des Markgrafen von Ansbach nahe bevorstand und er die Blattern noch nicht gehabt hatte, hielten es der König und die Königin für ratsam, mich nach Berlin zurückzuschicken. Bevor ich abreiste, ging ich aber zum König. Er empfing mich wie gewöhnlich, das heißt sehr ungnädig, und sagte mir die härtesten Dinge. In ihrer Angst, er könne noch weitergehen, kürzte die Königin meinen Besuch ab und geleitete mich selbst in mein Zimmer zurück. Tags darauf begab ich mich nach Berlin, wo ich die Gräfin Amalie als die Braut des Staatsministers von Viereck antraf. Herr von Wallenrodt, ihr früherer Liebhaber, war gestorben. Es war einige Zeit her, dass man ihr eines Tages diese Nachricht mitteilte, als eben Cercle bel der Königin gehalten wurde. Da sie nicht einmal von seiner Krankheit etwas gehört hatte, machte ihr diese plötzliche Nachricht von seinem Tode einen solchen Eindruck, dass sie angesichts des ganzen Hofes in Ohnmacht fiel, wodurch ihr Verhältnis zu ihm ans Licht kam. Seit dieser Begebenheit hatte sie an Einfluss bei der Königin sehr verloren, und diese war recht froh, sie loszuwerden. Indes trafen der König und die Königin ein paar Tage nach mir in Berlin ein. Die Hochzeit meiner Schwester wurde mit großem Prunk gefeiert; und sie verließ uns vierzehn Tage später.
Nunmehr trat ich aus meiner Abgeschlossenheit hervor und folgte einige Zeit darauf der Königin nach Wusterhausen. Dort fingen die Streitigkeiten wegen meiner Verheiratung von neuem an. Den ganzen Tag gab es nur Zank und Ärger. Der König ließ meinen Bruder und mich beinahe Hungers sterben. Er verwaltete selbst das Amt des Tranchiermeisters; er servierte allen, nur uns beiden nicht; und wenn zufällig auf der Platte etwas übrigblieb, spie er hinein, um uns das Essen zu verleiden. Wir nährten uns beide nur von Kaffee und gedörrten Kirschen, wodurch mein Magen gänzlich verdorben wurde. Dafür wurde ich mit Schmähworten und Beschimpfungen gespeist, denn es wurden mir den Tag über alle erdenklichen Benennungen zuteil, und noch dazu vor allen Leuten. Der Zorn des Königs ging sogar so weit, dass er meinen Bruder und mich davonjagte und uns streng gebot, nur noch zu den Mahlzeiten vor ihm zu erscheinen. Die Königin schickte heimlich nach uns, während der König auf der Jagd war. Sie hielt dabei nach allen Richtungen Spione aufgestellt, die ihr meldeten, wann er wieder in Sicht war, damit ihr Zeit blieb, uns wegzuschicken. Durch die Nachlässigkeit ihrer Leute wären wir eines Tages auf ein Haar bei ihr ertappt worden. Ihr Zimmer hatte nur einen Ausgang; und er erschien so plötzlich, dass wir ihm nicht mehr ausweichen konnten. Die Angst machte uns entschlossen. Mein Bruder verbarg sich in einer Nische, die eine gewisse Bequemlichkeit bot, und ich kroch unter das Bett der Königin, welches so niedrig war, dass ich es kaum aushalten konnte und in eine sehr peinliche Lage geriet. Kaum hatten wir uns in diese schönen Zufluchtsorte zurückgezogen, als der König eintrat. Da er von der Jagd sehr ermüdet war, schlief er ein und schlummerte zwei Stunden lang. Ich erstickte fast unter dem Bette und konnte nicht umhin, von Zeit zu Zeit meinen Kopf hervorzustrecken, um Atem zu schöpfen. Wenn diese Szene einen Zuschauer gehabt hätte, wäre sie lächerlich genug gewesen. Endlich ging sie zu Ende. Der König entfernte sich, und wir kamen schnell aus unsern Höhlen hervor, indem wir die Königin beschworen, uns solchen Vorgängen nicht wieder auszusetzen. Es mag wohl seltsam erscheinen, dass wir nichts unternahmen, um uns mit dem König auszusöhnen. Ich sprach mehrmals mit der Königin darüber, aber sie wehrte es auf das bestimmteste ab und sagte, der König würde mir antworten, dass ich nur dann wieder seine Gnade erlangen könnte, wenn ich den Herzog von Weißenfels oder den Markgrafen von Schwedt heiratete, was die Lage nur verschlimmern würde und mich in größte Verlegenheit brächte. Diese Gründe waren einleuchtend, ich musste mich fügen.
Nach all diesen Kümmernissen kamen einige frohe Tage. Der König begab sich nach Lübben, um mit dem König von Polen zusammenzukommen. Dort nun gelang es Grumbkow und Seckendorff, meinen Vater zu bewegen, mich in aller Form dem Herzog von Weißenfels zur Ehe zu versprechen, dem ich feierlich verlobt wurde. Der König von Polen wollte ihm einige Vorteile bewilligen, und der König von Preußen erachtete, dass ich mit 50.000 Talern jährlich sehr standesgemäß mit ihm würde leben können. In Dahme, einem kleinen Marktflecken, der dem Herzog gehörte und sein Erbteil war, machte der König halt; er wurde dort mit herrlichem Ungarwein bewirtet, was seine Freundschaft für den Herzog nur steigerte. Dieser aber hielt alle seine Ränke so geheim, dass wir erst einige Zeit darauf etwas davon erfuhren.