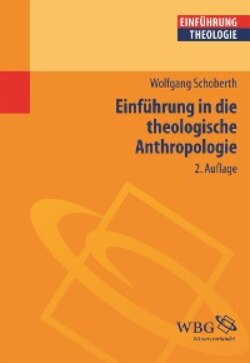Читать книгу Einführung in die theologische Anthropologie - Wolfgang Schoberth - Страница 9
1.1.1 Anthropologie und der Streit um das Menschsein: Thesen
ОглавлениеDie politische Debatte ist in mehrfacher Hinsicht bezeichnend für die Aufgabe, vor der jedes anthropologische Nachdenken steht. Was hier an einem Einzelfall deutlich werden konnte, wird in analoger Form bei jeder wesentlichen politischen und ethischen Auseinandersetzung erkennbar: Handlungen, Bewertungen und Orientierungen basieren auf spezifischen Vorstellungen vom Menschsein und wirken auf diese Vorstellungen zurück. Von dieser Wahrnehmung aus läßt sich die Aufgabe der Anthropologie in einigen Thesen formulieren, wobei die eingehende Begründung hier noch nicht gegeben werden kann. Die folgenden Leitgedanken umreißen also in aller Knappheit die Aufgabe, die in dieser Einführung in die theologische Anthropologie bearbeitet werden soll.
1. Anthropologie erschöpft sich nicht in einer wissenschaftlichen Theorie über den Menschen; sie zielt vielmehr auf die lebensweltliche Selbstreflexion des Menschseins.
Zweifellos erfordert die Beschäftigung mit Anthropologie die Kenntnis und den Nachvollzug wissenschaftlicher Theoriebildung und die Rezeption wesentlicher Erkenntnisse der verschiedenen Wissenschaften, die ‚den Menschen‘ in ihrer je spezifischen Weise zum Thema haben. Freilich wäre die Bedeutung dieser Wissenschaften, die ihnen auch in der Öffentlichkeit zugebilligt wird, nicht zu verstehen, wenn nicht berücksichtigt wird, daß hier Fragestellungen thematisch werden, die für jeden Menschen von Wichtigkeit sind, der über Ziel und Richtung seines Lebens nachdenkt. Unmittelbarer als in den meisten anderen wissenschaftlichen Feldern geht es bei der Anthropologie in spezifischer Weise ‚um mich‘: Meine Selbstwahrnehmung, die Ausrichtung meines Lebens, mein Handeln sind von den Aussagen der Biologie des Menschen ebenso berührt wie von religiösen Bestimmungen des Menschseins. Die wissenschaftliche Bemühung um die Anthropologie, die wie jede andere wissenschaftliche Fragestellung die Kenntnis von fachspezifischen Diskussionen und Traditionen voraussetzt, bezieht ihre Relevanz allererst aus ihrer Einbettung in die Frage nach der Bestimmung des Menschseins. ‚Bestimmung‘ ist dabei durchaus in der doppelten Bedeutung des Wortes zu verstehen: Es geht um die Frage nach dem Verständnis dessen, was Menschsein ausmacht und worauf es ausgerichtet ist. Anthropologische Reflexionen sind mithin keineswegs lediglich theoretisch, sondern von allerhöchster praktischer Relevanz: Es geht um unser Handeln; darum, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Welt eingerichtet haben wollen und worin wir die Bestimmung unseres Lebens erkennen.
2. Anthropologie und Ethik lassen sich nicht voneinander trennen.
Diese praktische Relevanz der Anthropologie ist nicht erst dort gegeben, wo Anthropologen selbst ausdrücklich ethische Folgerungen aus ihren Untersuchungen ziehen, was freilich bezeichnenderweise häufig geschieht. Vielmehr ergibt sich die enge Verbindung von Ethik und Anthropologie unvermeidlicherweise schon daraus, daß jedes Nachdenken über die Bestimmung des Menschseins Vorstellungen darüber enthält, wie Menschen leben und handeln sollen, wie umgekehrt jede ethische Reflexion Annahmen darüber voraussetzt, was Menschen können und worin die Bestimmung ihres Lebens besteht. Der scheinbar naheliegende Einwand, hier liege ein ‚naturalistischer Fehlschluß‘ vor, indem von einem Sein verbotenerweise auf ein Sollen geschlossen werde – dieser Einwand muß noch eigens thematisiert werden (vgl. unten 3.4) – verfängt nicht, weil er die Eigenart des Nachdenkens über den Menschen übergeht. Dabei greifen ethische und anthropologische Überlegungen so ineinander, daß gerade nicht von einer einseitigen Abhängigkeit auszugehen ist, so als ob die Anthropologie die grundlegenden Einsichten über den Menschen herausarbeite, an denen sich die Ethik orientieren müsse, will sie nicht Unmögliches von Menschen fordern. Vielmehr ist hier eine strikte Interdependenz zu sehen: Oft sind es gerade die ethischen Überzeugungen, die die anthropologischen Aussagen und Interessen leiten, ebenso wie diese ethischen Überzeugungen von Annahmen über die Bestimmung des Menschseins abhängig sind.
3. Der Anthropologie kann es gerade nicht um eine objektive‘ Bestimmung des Menschen gehen; vielmehr gehört zu ihrem Sinn die ‚subjektive‘ Dimension.
Diese These steht im Widerspruch zu der Gestalt, in der zahlreiche Arbeiten zur Anthropologie erscheinen. Gerade naturwissenschaftliche Beiträge zur biologischen Natur des Menschen erwecken den Anschein einer Betrachtung des Menschen ‚von außen‘, die als wissenschaftliche Theorie dann noch den Status (wenn vielleicht auch vorläufiger) empirischer Geltung beansprucht und darum als philosophischen und theologischen Reflexionen überlegen ausgegeben werden kann. Dieser Anspruch beruht freilich auf einer Selbsttäuschung: Festzuhalten war ja, daß Anthropologie ihren Sinn aus der Frage nach der Bestimmung ‚meines‘ Lebens bezieht. Ohne Zweifel kann auch der Mensch zum Gegenstand einer ‚objektiven‘ Erforschung werden – die wissenschaftstheoretische Problematik ‚objektiver Erkenntnis‘ soll hier nicht weiter verfolgt werden –; freilich ist damit gerade das nicht erreicht, was das Spezifikum anthropologischer Überlegungen ausmacht. Dieses Spezifikum kommt nur dann in den Blick, wenn man sich Rechenschaft darüber ablegt, daß Anthropologie allemal Selbstreflexion von Menschen ist.
Die Vermischung des Anspruchs auf wissenschaftliche Objektivität mit dem Feld menschlicher Selbstreflexion führt in der Anthropologie zu fatalen Konsequenzen: nicht nur weil hier eine Selbsttäuschung über die Leistungsfähigkeit und Stichhaltigkeit solcher Argumentationen vorliegt, sondern vor allem in Blick auf die öffentliche Relevanz. Gerade an den Debatten der Bioethik ist das zu erkennen, wenn nämlich, wie häufig zu beobachten, durch eine Überschreitung der legitimen Reichweite biologischer Aussagen die ethische Diskussion abgeschnitten werden soll. Der Verweis auf Wissenschaft dient dann aber nicht der Klärung, sondern der Mystifikation, wenn Fragen, die ihrem Wesen nach nicht wissenschaftlich entscheidbar sind, dem Feld des ‚Subjektiven‘, also des irreduzibel Kommunikativen und damit Strittigen entzogen werden sollen.
Die Debatte um die Forschung am vorgeburtlichen menschlichen Leben und an embryonalen Stammzellen liefert auch hierfür instruktives Anschauungsmaterial. Indem sich nämlich die Diskussion zunehmend auf die Frage verschob, ab welchem Zeitpunkt von einem ‚Menschen‘ zu sprechen sei, wurden die eigentlich relevanten ethischen Fragen unkenntlich. Darüber hinaus erwies sich genau diese Frage nach dem Zeitpunkt als unlösbar, weil hier sehr verschiedene Wahrnehmungen aufeinander treffen: Die Wahrnehmungen im biologischen Labor sind von denen der medizinischen Praxis unterschieden; beide wiederum lassen sich nicht ohne weiteres mit der lebensweltlichen Erfahrung vermitteln. Die Bestimmung eines Zeitpunkts wäre aber auch dann, wenn über sie Einigkeit gefunden werden könnte, allenfalls von nachrangiger Bedeutung, weil ein Zeitpunkt in sich ja nicht nur kein ethisches Urteil enthält; die Fixierung auf einen Termin verfehlt auch die strittigen Zusammenhänge. Die biologische oder medizinische Bestimmung ist hier gerade nicht das, was gesucht wird. In Frage stehen vielmehr Zusammenhänge, die in der Sprache der Biologie überhaupt nicht erscheinen können: Zum Verständnis von ‚Menschenwürde‘ kann die Biologie nichts beitragen, weil ein solcher Begriff im biologischen Kontext keine sinnvolle Bedeutung haben kann. Biologische und ethische wie anthropologische Perspektiven lassen sich auch nicht einfach addieren: Sie entstammen nicht nur unterschiedlichen Kontexten, sondern bleiben auch an ihre jeweiligen Sprach- und Wahrnehmungszusammenhänge gebunden. Zur Klärung ist es gerade hier unabdingbar, genau nach den Voraussetzungen und Bedingungen unseres Redens vom Menschen zu fragen.
So sehr auch die (natur-)wissenschaftlichen Untersuchungen über den Menschen von großer anthropologischer Relevanz sind – keine tragfähige anthropologische Theorie kann z.B. die Einsichten zur Biologie des Menschen übergehen –, so sehr bleibt doch festzuhalten, daß diese Untersuchungen zwar unverzichtbares Material für die anthropologische Reflexion bieten, diese aber nie ersetzen oder unterlaufen können. Wo dies doch geschieht oder geschehen soll, wird ‚Wissenschaftlichkeit‘ zu einem bloßen Etikett, das selbst wieder notwendigerweise ‚subjektive‘ Positionen durch den Anschein des ‚Objektiven‘ der Kritik entziehen soll.
4. Anthropologie kann darum keine Angelegenheit von akademischen Spezialisten sein; vielmehr ist hier in spezifischem Sinn jeder Mensch Experte.
Die notwendige Strittigkeit der anthropologischen Fragestellung bringt es mit sich, daß keine Disziplin und nicht einmal die Wissenschaften in ihrer Summe einen privilegierten Status beanspruchen könnten. Vielmehr sind auch sie allemal nur Teilnehmer am anthropologischen Diskurs, dessen eigentliches Feld die Selbstbesinnung der Menschen ist. Ist die Grundfrage der Anthropologie vorerst als die Frage nach der Bestimmung des Menschseins zu fassen – die notwendige Präzisierung dieser Grundfrage ist Gegenstand des ersten Teils dieser Einführung –, so ist hier vielmehr jeder Mensch kompetent, weil jeder Mensch diese Fragen irgendwie für sich beantwortet bzw. immer schon beantwortet hat. Vielleicht ist es sogar gerade ein wesentliches Kennzeichen der conditio humana, daß es zum menschlichen Leben gehört, eine Vorstellung davon zu haben, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Freilich sind die lebensweltlichen Antworten auf die anthropologische Grundfrage, wie sie jeder Mensch in seinem Handeln voraussetzt, in aller Regel unbewußt und in der Übernahme kultureller Prägungen und Plausibilitäten gegeben. Was Menschsein heißt und worin es seine Bestimmung findet, beantwortet ein Mensch nicht jeweils für sich allein, sondern in Aufnahme, Fortschreibung und Modifikation dessen, was er gelernt und erfahren hat und mit anderen teilt. Zugespitzt läßt sich sagen, daß hierbei seine eigene Identität gefragt und formuliert ist: Sie hängt daran, was einer für ein Mensch sein will. Weil aber die Bestimmung des Menschseins und meine eigene Identität so unmittelbar miteinander verbunden sind, kann es im strengen Sinn hier auch keine Experten geben.
Auch diese Lehre ist aus der bioethischen Debatte zu ziehen: Sie wird gerade dann unlösbar und unfruchtbar, wenn sie zu einer Angelegenheit der Experten reduziert wird. Nicht nur sind in grundsätzlichen Fragen Experten allemal auf jeder der kontroversen Positionen zu finden – es ist nicht einmal eine Diskursebene im Blick, auf der sachgemäß die anstehenden Fragen zu bearbeiten wären. Dies ist darin begründet, daß es hier letztlich eben um lebensweltliche Fragen geht, die auf der Ebene der Expertendiskussion nur unzureichend wahrgenommen werden können.
5. Anthropologische Theorie hat ihre wesentliche Aufgabe im Bewußtmachen und in der kritischen Reflexion der lebensweltlich vorausgesetzten Antworten auf die Frage nach der Bestimmung des Menschseins: Was ist der Mensch und was macht sein Leben zu einem humanen und guten Leben?
Der Ausdruck ‚human‘ hat nicht umsonst eine doppelte Bedeutung, in der Deskriptives und Normatives ineinander übergehen. Wenn aber letztlich jeder Mensch hier Experte ist und die anthropologische Grundfrage in jedem einzelnen Leben beantwortet werden muß, so wird doch die anthropologische Theorie nicht überflüssig. Zwar muß jeder Mensch diese Frage für sich selbst beantworten und hat sie immer schon beantwortet; das bedeutet aber gerade nicht, daß diese ‚existenziellen‘ Antworten der Reflexion entzogen oder unumstößlich wären. Gerade weil sie bedingt sind durch gesellschaftliche und kulturelle Vorgaben und Kontexte – das gilt, wie sich zeigen wird, gerade für anthropologische Aussagen, die sich als wissenschaftliche verstehen –, ist es von größter Bedeutung, daß diese Selbstverständlichkeiten, die gar nicht so selbstverständlich sind, wie sie scheinen, bewußt werden und diskutiert werden. Es handelt sich dabei nämlich weder um ‚wissenschaftliche‘ Sachverhalte, die mit den Mitteln der Wissenschaft hinreichend bearbeitet und entschieden werden könnten, noch um subjektive, unhintergehbare Setzungen, sondern um fundamentale Prägungen, die kaum anders als ‚weltanschaulich‘ genannt werden können in dem unmittelbaren Sinn des Wortes: Sie sind auf das Engste verbunden damit, wie wir unsere Welt sehen und wie wir also uns selbst sehen. Umgekehrt ist auch die Welt, wie wir sie sehen, abhängig davon, was wir für ein gutes und gelingendes Menschsein ansehen. Darum liegen hier die grundlegenden Rahmenvorstellungen für unser Handeln und Leben. Diese Leitvorstellungen bewußt zu machen, ist die Aufgabe der anthropologischen Theorie; an der Erfüllung oder Nichterfüllung dieser Aufgabe bemißt sich wiederum die Qualität einer jeden anthropologischen Theorie.
6. Anthropologische Theorie ist notwendig vielgestaltig und unentscheidbar.
Die Einbindung der anthropologischen Fragestellung in die lebensweltliche Selbstverständigung über das Menschsein bringt es mit sich, daß ihre Themenfelder und Gegenstandsbereiche grundsätzlich nicht abgeschlossen werden können. Menschsein wird sich selbst in mannigfaltiger Hinsicht fraglich; und jeder Versuch, eine Fragerichtung und eine Zugangsweise zur maßgeblichen zu machen, führt in unzulässige Reduktionen, die die anthropologische Theorie entweder letztlich irrelevant oder ideologisch machen. Die faktische Vielzahl anthropologischer Ansätze und Themenstellungen ist also nicht lediglich ein kontingentes Ergebnis der Wissenschafts- und Geistesgeschichte, sondern folgt aus der Vielzahl der Perspektiven, in denen Menschen sich selbst thematisch werden.
Mit dieser irreduziblen Vielgestaltigkeit ist freilich auch verbunden, daß niemand in der Lage ist, die mannigfaltigen Perspektiven und Theorien wiederum in einer einheitlichen Theorie zu integrieren, so wichtig es ist, offen und wahrnehmungsfähig zu sein für solche Beiträge, die auch außerhalb der eigenen Disziplin und Fragestellung liegen. Daß solche Wahrnehmung immer nur fragmentarisch geschehen kann, liegt auf der Hand. So muß an jeden Beitrag zur anthropologischen Reflexion die Forderung erhoben werden, die eigenen Grenzen und die eigene Partikularität bewußt zu machen und sich gleichzeitig nicht mit den Grenzen der eigenen Disziplin und der eigenen Vorannahmen zufrieden zu geben.
Aber auch innerhalb einer Disziplin ist die Vielgestaltigkeit der Anthropologien irreduzibel: Gehört es gerade zu ihrer Eigenart, daß sie es mit der Strittigkeit der Bestimmung des Menschseins zu tun hat, dann sind verschiedene und kontroverse Antworten nicht nur legitim, sondern geradezu unverzichtbar. Gerade darin kommen die Selbstreflexion und die Würde des Menschen überein, daß sie die Anerkennung des anderen in seinem Anderssein und in seinen abweichenden Vorstellungen vom Menschsein implizieren.
7. Der anthropologische Diskurs ist gesellschaftlich unabdingbar.
Daß die großen gesellschaftlichen Streitfragen zu keiner öffentlichen Debatte geführt haben, die Aussicht auf Klärung und wechselseitige Respektierung hatten und haben, ist nicht nur ein Merkmal defizitärer Öffentlichkeit und eines Politikverständnisses, das nur auf die Durchsetzung von Interessen, Optionen und Überzeugungen, nicht aber auf den Diskurs und die Anerkennung von Differenzen zielt. Was als ‚Politikverdrossenheit‘ und erst recht als Politikerschelte erscheint, ist demgegenüber nur ein unspezifisches Unbehagen, das den Kern der Problematik verfehlt: die Reduktion der politischen Aufmerksamkeit auf die jeweilige Einzelfrage, die doch ihren Sinn erst aus ihren Kontexten und Hintergründen hat.
Weil aber politische Kriterien und gesetzliche Regelungen immer zurückgebunden sind an grundlegende Überzeugungen von der Bestimmung des Menschseins, wird mit dem Abblenden der anthropologischen Perspektive auch die notwendige Klärung über die Zielsetzung des Handelns und die Basis der rechtlichen Ordnung unterlassen. Diese Klärung ist nun in einem einzelnen Gesetzgebungsverfahren nicht zu leisten; wenn aber die öffentliche Diskussion dieser Fragen auf Dauer unterbleibt, löst sich der Rahmen einer gesellschaftlich in Grundzügen geteilten Ethik auf in das Neben- und Gegeneinander verschiedener Interessen und Haltungen, die letztlich weder fähig sind zur gemeinsamen Urteilsbildung noch zur produktiven Respektierung divergierender Anschauungen. Damit aber verlöre die Demokratie wesentliche Momente ihrer moralischen Basis.