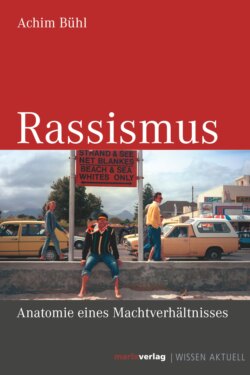Читать книгу Rassismus - Achim Bühl - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDie Geschichte aller bisherigen Klassengesellschaften ist die Geschichte des Rassismus. Der Rassismus ist ein Macht- und Herrschaftsverhältnis. Rassistische Akteure beabsichtigen ein soziales Ungleichheitsverhältnis zu etablieren oder ein bereits bestehendes zu erhalten bzw. zu festigen. Der Rassismus ist sowohl Struktur, Praxis und Strategie als auch Ideologie zugleich. Als Struktur ist er in den gesellschaftlichen Verhältnissen eingeschrieben und durchzieht die gesamte Gesellschaft. In der Praxis wird er hingegen in Gestalt von Verfahrenstechniken sowie Handlungsweisen kollektiver als auch individueller Akteure stets aufs Neue produziert bzw. reproduziert. Als Strategie wiederum stellt er ein intentionales, konzeptionelles Handeln rassifizierender Kräfte zwecks Vorteilsaneignung und -wahrung dar und zielt auf die Etablierung sowie Aufrechterhaltung ihrer ökonomischen, sozialen, kulturellen wie politischen Vorherrschaft ab. Zuletzt rechtfertigt er in Form der Ideologie die Dominanz einer herrschenden Gruppe mittels heterogener Theoreme, Stereotypisierungen, rassifizierender Diskurse sowie dem rassistischen Wissen.
Der Rassismus ist die systematische Realisierung eines »Extraprofits« auf Kosten rassistisch Dominierter, der sich häufig nicht aus der unmittelbaren Verfügungsgewalt über Produktionsmittel bzw. aus den Produktionsverhältnissen ergibt, sondern aus der politischen, sozialen und kulturellen Unterdrückung konstruierter gesellschaftlicher Gruppen. Diesen wird aufgrund ihres vermeintlichen Wesens eine gleichberechtigte Teilhabe an materiellen und immateriellen Gütern der Gesellschaft abgesprochen. Die dergestalt realisierten »Extragewinne«, Privilegien als auch sozialen Boni verteilen sich indes keineswegs zu homogenen Anteilen auf die Mitglieder der sozial konstruierten Wir-Gruppe, sondern gemäß ihrer klassen- und sozialstrukturellen Verortung. Dominante Fraktionen, die innerhalb der Wir-Gruppe als die eigentlichen Förderer von Rassifizierungsprozessen agieren, lassen indes beherrschte Schichten der Eigengruppe zumeist am rassistisch erzielten Vorteil nicht nur symbolisch sondern auch materiell partizipieren.
Den Rassismus gibt es nicht von Anbeginn der Menschheitsgeschichte an, sondern in Gestalt des Klassismus (vgl. Kap. 1.3.6) erst seit der Versklavung des Menschen durch den Menschen. Der antike Rassismus besaß in der Spielart des Klassismus die Funktion, die Sklavenarbeit mittels diverser Mechanismen abzusichern, die Versklavung fremder Völker ideologisch zu rechtfertigen sowie in Gestalt des Antifeminismus den Zweck, den Ausschluss der Frauen aus der Gruppe der entscheidungsbefugten Polisbürger zu realisieren und zu legitimieren. Die Gleichheit der männlichen Polisbürger korrespondierte mit der Ungleichheit der Frauen und der Sklaven. Gleichheit wie Ungleichheit wurden durch soziale Praxen, Normen und vielfältige Reglementierungen abgesichert und seitens der antiken Philosophen legitimiert.
Rassismus liegt unseres Erachtens dann vor, wenn zum Zweck der Macht- und Herrschaftserrichtung oder -sicherung eine »Wir-Gruppe« sowie eine »Fremdgruppe« konstruiert werden, die einander antagonistisch gegenübergestellt und ihrem Wesen nach als unvereinbar definiert werden. Dabei wird unter »Herrschaft« ein dauerhaftes, umfassendes als auch institutionell verfestigtes autoritäres Gewaltverhältnis verstanden, unter »Macht« hingegen eine diskontinuierliche, partielle wie informelle gewaltförmige Sozialbeziehung. Der Konstruktionsprozess der beiden antipodischen Gruppen geschieht auf der Basis eines Differenzkriteriums, das biologischer, ethnischer, kultureller, religiöser oder sonstiger Natur sein kann. Die der Spaltung dienende Eigenschaft kann eine reale oder eine imaginäre Größe sein. Unabhängig davon folgt die Bedeutungszuschreibung des trennenden Charakteristikums der Logik des Rassifizierungsprozesses, der Intention, den »Anderen« als »anders« zu kennzeichnen, das Merkmal als Stigma zu etablieren bzw. zu instrumentalisieren und so den »Fremden« markierend zu konstruieren. Zwar ist die konkrete Natur des Differenzkriteriums belanglos, jedoch spielt es für den Prozess der Produktion der als fundamental gedachten Ungleichartigkeit der beiden Gruppen eine unverzichtbare Rolle. Zu betonen ist also, dass der Rassismus nicht an die Konstruktion von körperlichen und damit biologischen Unterschieden gebunden ist; ein derart verengter Rassismusbegriff liefe auf den Ausschluss relevanter Spielarten des Rassismus (vgl. Kap. 1.3) hinaus.
Die Intention des Rassisten besteht darin, die konstruierte Fremdgruppe zu beherrschen, die »Anderen« von relevanten ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Prozessen auszuschließen, sie im Extremfall gar zu vertreiben oder zu töten. Während in den frühen Formen des Rassismus ein wechselseitiger Über-gang von der »Wir-Gruppe« zur »Fremdgruppe« in Einzelfällen noch möglich war, wird im weiteren historischen Verlauf der Antagonismus als unveränderbar, als statisch, als quasi-erblich konstruiert und in einem Maße essentialisiert, dass ein Wechsel de facto ausgeschlossen ist. Der Gruppenantagonismus wird nunmehr generationenübergreifend konstruiert, als fundamentaler Gegensatz gedacht, der alle gesellschaftlichen Sphären durchdringt und alle Konflikte verursacht bzw. dominiert.
Auch im 21. Jh. ist der Rassismus weltweit alles andere als von der Landkarte verschwunden. Gerade Deutschland erweist sich als ein zutiefst rassistisches Land. Rassistische Bücher wie das eines Berliner Ex-Finanzsenators rangieren nicht nur auf Bestsellerlisten, sondern verkaufen sich, begleitet von einem medialen Hype, millionenfach. Der Autor wurde weder aus der SPD ausgeschlossen noch erfolgte eine Anklage wegen Volksverhetzung. In einem anderen Fall formierte sich die Bewegung »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« (Pegida) zum Jahreswechsel 2014/2015, der es gelang, tausende Bürger wochenlang rassistisch zu mobilisieren. In Deutschland reichen die offensichtlichen Sachverhalte bzw. Tatbestände von antinegrid-rassistischen Karikaturen in Polizeikalendern, über antisemitische Äußerungen im Kontext der Beschneidungsdebatte (»Haut ab!«), bis hin zu Schändungen jüdischer wie muslimischer Friedhöfe. Hinzu kommen gewalttätige Übergriffe auf zu Fremden konstruierte Personen, Brandanschläge auf Moscheen und Synagogen, ganz zu Schweigen von einer rassistisch-motivierten Mordserie an neun Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund durch eine neonazistische Terrorgruppe. In der zweiten Jahreshälfte 2015 sowie zu Beginn des Jahres 2016 zeigt sich in ganz Europa der Rassismus im Verhalten gegenüber den vor Bürgerkrieg, Unterdrückung und Not fliehenden Menschen. So wurden in Deutschland Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Ost und West verübt, im sächsischen Freital skandierte ein rassistischer Mob »Weg mit dem Dreck« und im bayerischen Bamberg erschollen Parolen wie »Wir wollen keine Asylantenschweine« oder »Kriminelle Ausländer raus – und der Rest auch«. Im März 2016 gelang es der rechtspopulistisch-rassistischen Partei »Alternative für Deutschland« (AfD) bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zweistellige Ergebnisse zu erzielen und in Sachsen-Anhalt nahezu jeden vierten Wähler zu überzeugen.
All dies wirft Fragen auf nach den Ursachen und Funktionen des Rassismus, den Beweggründen der Akteure, nach adäquaten anti-rassistischen Gegenstrategien sowie einer die Vielfalt der Phänomene erfassenden geeigneten Rassismus-Theorie. Nicht nur an Schulen und Universitäten, sondern auch in der Gesamtgesellschaft stellt die Beschäftigung mit dem Thema eine dringende Notwendigkeit dar. Versteht man Rassismus als gesellschaftliches Macht- und Herrschaftsverhältnis, so ist die Funktion des Phänomens zu erfassen, sind die jeweiligen Methoden der Rassifizierung präzise zu beschreiben und müssen die in den Strukturen wie Institutionen der Gesellschaft eingeschriebenen rassistischen Normen und Verfahrenstechniken analysiert und bekämpft werden.
Der irische Schriftsteller Jonathan Swift (1667–1745) hat die Willkürlichkeit des differenzierenden Charakteristikums in seinem im Jahr 1726 veröffentlichten Buch Travels into Several Remote Nations of the World in Four Parts By Lemuel Gulliver mit beißender Ironie zum Ausdruck gebracht. Der Ich-Erzähler entdeckt in der in Form einer zweiteiligen Kinderbuchausgabe der als »Gullivers Reisen« bekannten Erzählung u. a. ein »Land der Zwerge« namens Liliput. Nach anfänglichen Turbulenzen stattet der Regierungssekretär Liliputs namens Reldresal dem Fremden einen Besuch ab und erläutert ihm, das Eiland sei sowohl von einem internen Konflikt als auch von einem äußeren Feind bedroht. Die innere Zwietracht stamme daher, dass sich in Liliput zwei Gruppen gebildet hätten. Während die einen – Tramecksan genannt – hohe Absätze trügen, seien es bei den Slamecksan niedere Absätze. Der König habe beschlossen nur Personen aus der Gruppe der Slamecksan bei Hofe zu beschäftigen. Die Erbitterung der beiden Gruppen sei bereits so groß, dass sie weder miteinander speisten noch miteinander kommunizierten und sich die Feindseligkeiten von Tag zu Tag zuspitzten. Der äußere Feind, so Reldresal, seien die Bewohner der Insel Blefuscu. Es handele sich bei ihnen um einstige unterdrückte Liliputaner, die auf die Nachbarinsel geflohen seien. Die Situation sei dadurch entstanden, dass der Großvater seiner jetzigen Majestät sich als Knabe, als er einst ein Ei essen wollte, verletzt habe. Der Vater habe daraufhin einen Erlass verkündet, dass alle Untertanen künftig ihre Frühstückseier am spitzen Ende zu öffnen hätten, die Öffnung des Eis am breiten Ende sei bei schwerer Strafe verboten worden. Der Befehl seiner Majestät habe zu Aufständen geführt, die unterlegenen Liliputaner seien schließlich nach Blefuscu geflohen.
Analysiert man die utopisch-fiktive Reiseerzählung Swifts rassismustheoretisch, so ist für einen Roman aus dem frühen 18. Jh. die satirische Darstellung des zwar unverzichtbaren, aber von seiner Wesensart her belanglosen Differenzkriteriums brilliant in Szene gesetzt. Handelt es sich – so ließe sich fragen – bei der inneren Aufspaltung Liliputs sowie bezüglich des »außenpolitischen Konflikts« zwischen Liliput und Blefuscu um Rassismen? Legt man die bisherigen Ausführungen zugrunde, so ist diese Frage zu bejahen. In beiden Fällen liegt ein Macht- und Herrschaftsverhältnis vor, bei dem eine Wir- und eine Fremdgruppe auf der Basis eines Differenzkriteriums antagonistisch positioniert werden. Während die Charakteristika der Wir-Gruppe (niedere Absätze bzw. Köpfen des Eis am spitzen Ende) positiv bewertet werden, erfahren die Charakteristika der »Fremdgruppen« (hohe Absätze bzw. Köpfen des Eis am runden Ende) eine Abwertung. Die Fremdgruppen werden darüber hinaus mit weiteren pejorativen Zuschreibungen versehen. Gegenüber den nach Blefuscu geflohenen unterdrückten Liliputanern ist dies die Behauptung, gegen Gebote des »großen Propheten Lustrog« verstoßen zu haben. Die »Ex-Liliputaner« werden auf diese Weise mit den negativ bewerteten Eigenschaften »Blasphemiker«, »Gotteslästerer« sowie »Gesetzesbrecher« etikettiert. Auch das definitorische Element der Exklusion trifft hier zu. Während die Fremdgruppe im ersten Fall von Ämtern am Hof bzw. der Regierung ausgeschlossen wird und damit zugleich eine deutliche Benachteiligung erfährt, handelt es sich im zweiten Fall um eine räumliche Exklusion, eine Ausgrenzung durch Vertreibung bzw. erzwungene Flucht. In beiden Fällen wird das Differenzkriterium essentialisiert, eine Essensgewohnheit bzw. eine Schuhmode zum Wesen der jeweiligen Gruppe verklärt sowie das Merkmal zum bestimmenden Faktor erhoben. Das Wesen des Rassismus, Macht- und Herrschaftsverhältnis zu sein, bringt Swift in unterhaltsamer Form zum Ausdruck. Insofern es sich bei den beteiligten Gruppen um Bewohner bzw. ehemalige Bewohner des Eilandes handelt, verdeutlicht Swift ebenso, dass sogenannte Fremdgruppen nicht eo ipso existieren, sondern dass sie vielmehr ein Produkt des rassistischen Spaltungsprozesses darstellen. Obwohl es sich bei der Präferenz für die Höhe eines Schuhabsatzes bzw. hinsichtlich gewisser Vorlieben bei der Öffnung eines Frühstückseis keineswegs um biologische Größen handelt, werden diese in der fiktiven Reiseerzählung als quasi-erblich konstruiert. Der Antagonismus zwischen den Tramecksan und den Slamecksan erscheint so als unlösbar, unüberbrückbar wie generationenübergreifend. Die Vorteile der einen gegenüber der anderen Gruppe im Kontext von Macht und Herrschaft liegen auf der Hand. Es geht um Vorteilswahrung bzw. um den exklusiven Erhalt eines Postens bei Hofe bzw. eines Regierungsamtes und damit um die Zugehörigkeit zur politischen Klasse bzw. um die Verfügungsgewalt über die politische Macht. In der Ich-Erzählung des Reisenden gibt es einen einschränkenden Sachverhalt, der den Übergang prärassistischer Strukturen zum Rassismus im engeren Sinne verdeutlicht. So erzählt der erste Sekretär für Privatangelegenheiten des Kaisers dem Fremdling Gulliver:
»Wir glauben, dass die Tramecksan oder die hohen Absätze uns an Zahl übertreffen, allein die Staatsgewalt liegt dennoch in unserer Hand. Wir sehen jedoch mit Sorge, dass Seine Kaiserliche Hoheit, der Thronerbe, eine gewisse Neigung für die hohen Absätze zeigt. Wenigstens können wir deutlich sehen, dass der eine seiner Absätze höher ist als der andere, wodurch er beim Gehen hinkt.«
Einen tänzelnden bzw. hinkenden Übertritt von der einen zur anderen Gruppe oder gar eine multiple Identität ermöglicht bzw. gestattet der Rassismus in der Regel nicht. Zu seinen Wesensmerkmalen zählt die Tatsache, dass er das konstruierte Differenzkriterium als quasi-erblich deklariert, zu seinen Herrschaftsmechanismen gehört die verewiglichte Bipolarität. Einmal Slamecksan immer Slamecksan, Slamecksan oder Tramecksan. Einen Thronfolger, der von einer Majestät abstammt, die zur Gruppe der Slamecksan gehört, und der humpelt, gewissermaßen also ein Slamtramecksan ist, lässt der Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis in der Regel nicht zu. Zum Wesen des Rassismus zählen bipolare hierarchische Grenzlinien, deren Undurchlässigkeit in der Regel dreifach temporär angelegt ist. Der Vater unserer Majestät hat sein Ei nur von der spitzen Seite geöffnet, genau wie es unserer kaiserlichen Hoheit und dem Thronerben beliebt; auch Enkel und Urenkel werden folglich zu den »Spitzköpfen« und nicht zu den »Rundköpfen« zählen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen beim Rassismus zu einer Historie des vermeintlich ewig Fremden sowie einer angeblich homogenen ewigen »Ur-Wir-Gruppe«.
Gewiss mag es bei diversen Rassismen Grenzgänger wie den Thronfolger von Liliput geben, doch gerade ihnen begegnet der Rassismus mit äußerstem Misstrauen, stellen sie doch letztendlich physische Manifestationen einer bedrohlichen Infragestellung der bipolaren Gewaltordnung sowie alltägliche Verdeutlichungen ihres konstruktivistischen Charakters dar. Ein weiteres Beispiel für Inklusionsbzw. Exklusionsprozesse als zentrale rassistische Strategien stellt im fiktiven Universum des Raumschiffs Enterprise in der ersten Staffel die Folge 8 »Balance of Terror«, auf Deutsch: »Spock unter Verdacht« dar. Mister Spock, gespielt von dem jüngst verstorbenen US-amerikanischen Schauspieler Leonard Nimoy, ist Wissenschaftsoffizier an Bord des Raumschiffs USS Enterprise. Zugleich Offizier ist er nicht nur ein integraler Teil der Besatzung, sondern eine der zentralen Führungspersonen auf der Brücke, dem Respekt gebührt. Spock ist einer der Grenzgänger, der sich dem bipolaren Herrschaftszugriff entzieht, insofern seine Mutter von der Erde und sein Vater vom Planeten Vulkan stammt. Obwohl es hin und wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Planeten Erde und dem Planeten Romulus kommt, wissen die Erdenbewohner noch nicht, wie Romulaner aussehen. Das Raumschiff USS Enterprise verfolgt ein romulanisches Schiff, das Außenposten der Erde angegriffen und vernichtet hat. Spock gelingt es, ein Bild vom Inneren des Raumschiffes zu übermitteln. Zu sehen ist erstmals in voller Größe ein Romulaner, der wie Mr. Spock spitz zulaufende Ohren besitzt. Aufgrund der äußeren Ähnlichkeiten blicken alle Brückenmitglieder verstohlen zu Mr. Spock, der darüber hinaus sogleich das Misstrauen von Lt. Stiles zu spüren bekommt, der ihn der Kollaboration bezichtigt. Insbesondere für sogenannte Grenzgänger erweisen sich Inklusionsprozesse als fragile soziale Tatbestände. Innerhalb von nur wenigen Sekunden wird ein Erster Offizier, ein scheinbar unangefochtenes Mitglied des Wir-Kollektivs zu einem Kollaborateur der Fremdgruppe, wenn auch die Szene optimistisch mit einem Beispiel für antirassistisches Verhalten endet. Captain Kirk weist das Verhalten von Lt. Stiles mit den Worten zurück: »Über eines dürfen sie sicher sein, Mr. Stiles. Auf der Brücke ist kein Platz für ihre Engstirnigkeit. Lassen sie die in ihrem Quartier zurück. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Die Brüchigkeit der Zugehörigkeit, ja die Schnelligkeit mit der ein Ausschluss aus der Wir-Gruppe erfolgen kann, erfuhren im Kontext der aktuellen Staatskrise »die Griechen« mit aller Härte. Galten griechische Migranten einst als »Musterknaben« für erfolgreiche Integration, so wurden sie nunmehr immer öfter als »Betrüger« diskriminiert, respektlos behandelt, beleidigt und diffamiert. Die soziale Funktion derartiger Übergriffe verdeutlichen die Überschriften und Titelbilder der Boulevardmagazine. Gesucht wird nach Sündenböcken für die globale Finanzkrise, wobei Neid, Missgunst und Egoismus geschürt werden. Das überwunden geglaubte Stereotyp vom »faulen Griechen«, der lustvoll das Leben in vollen Zügen genießt und sich als unfähig erweist auch nur einfache Abläufe rational und erfolgreich zu strukturieren (Motiv im Film »Zorba the Greek« aus dem Jahr 1964), erfährt unter dem Vorzeichen globaler Finanzkrisen eine Revitalisierung. So sagte im Jahr 2012 z. B. der FDP-Abgeordnete Hans-Ulrich Rülke im Baden-Württembergischen Landtag: »Was Sie vorgelegt haben, ist ein Tsatsiki-Haushalt, der eher nach Griechenland passt, als nach Baden-Württemberg.«
»Besser: Unser Geld für unsere Leut«, so lautete das Motto eines Wahlplakates der österreichischen FPÖ. Zu sehen ist der Kopf eines lachenden, schnauzbärtigen Mannes mit Sonnenbrille, der in einer die griechische Nationalflagge darstellenden Hängematte liegt. Sein nahezu übergroßer Arm empfängt begierig ein dickes Bündel Euro-Scheine, wobei der obere Fünhundert-Euro-Schein verdeutlicht, dass es sich nicht um Kleingeld handelt. Auffallend ist die Überzeichnung der Sonnenbräune des »faulen Griechen«. Erkennbar werden an dieser Stelle die Willkürlichkeit des Konstruktionsprozesses von Inklusion und Exklusion sowie die noch immer existente Relevanz des Hautfarbenrassismus. Während der inkludierte Grieche zu einem »weißen Ur-Europäer« stilisiert wird, dem Schönheitsideal antiker Skulpturen entsprechend, generiert der exkludierte Grieche zu einem »Schwarzen« mit »zigeunerhaften Zügen«, zu einem faulen playboyhaften Bettler mit aggressiv-listigem Blick. Sichtbar wird an dieser Stelle die Verflechtung heterogener Rassismen. Der Mix aus Griechen-Bashing, antinegridem wie antiziganischem Rassismus soll dem Werbeplakat der FPÖ Sprengkraft verleihen. Der Mythos vom faulen »negrid-ziganen Südeuropäer« kann sich dabei auf die bereits seit der Antike kursierenden Klimatheorien (vgl. Kap. 1.4.1) stützen, wenn auch mit umgekehrt wertendem Vorzeichen. Im »Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk« heißt es noch im Jahr 1839: »Ein gemäßigtes Klima wirkt auf Ausbildung und Veredlung des Menschen am vortheilhaftesten, denn die Hitze der heißen Zone erschlafft seine Thätigkeit«.
Außer dem Schriftsteller Jonathan Swift sowie dem Star-Trek-Universum gelingt es auch Eric Cartman das Wesen des Rassismus auf den Punkt zu bringen, so etwa in der South-Park-Folge »Gingers dont have souls«, in der er einen seiner berüchtigten Schulvorträge hält und Bezug nehmend auf Menschen mit roten Haaren folgendes ausführt:
»Wir alle sind ihnen schon begegnet, auf dem Spielplatz, im Laden, auf der Straße. Sie jagen uns Schauer über den Rücken und verursachen Übelkeit. Ich rede von rothaarigen Kindern. Rothaarige Kinder werden mit einer Krankheit geboren, die sehr helle Haut, rote Haare und Sommersprossen hervorruft. Diese Krankheit ist meist bekannt als Rotsucht. Kinder mit Rotsucht können nicht geheilt werden. Weil ihre Haut so hell ist, müssen Rothaarige das Sonnenlicht meiden. Fast so wie Vampire. Manche Menschen haben rote Haare aber keine helle Haut mit Sommersprossen. Diese Menschen nennt man Daywalker. Wie bei Vampiren ist das Rotschopf-Gen ein Fluch. Und wenn wir uns nicht von diesen Geschöpfen befreien, könnten sie unser Leben für alle Zeiten in Finsternis tauchen.«
Wie bereits bei Jonathan Swift und in den unendlichen Weiten des Weltraums, so verdeutlicht auch der Schulvortrag von Eric Cartman, dass »Wir-Gruppe« und »Fremdgruppe« keineswegs als gegeben zu betrachten sind. Beim Rassismus handelt es sich schon deshalb nicht um »Vorurteile gegenüber Fremdgruppen«, weil letztere nicht per se existieren. Der erste Schritt des Rassismus besteht folglich nicht in der antagonistischen Gegenüberstellung von »Wir-Gruppe« und »Fremdgruppe«, sondern in der Spaltung der menschlichen Gemeinschaft in ein »Wir« und ein »Ihr«, um die dergestalt produzierten sozialen Gruppen sodann konträr zu positionieren und ihr Verhältnis als dauerhaft unversöhnlich zu deklarieren. Bei Cartman heißt es somit gleich zu Beginn: »Wir alle sind ihnen schon begegnet […].« Der Vortrag setzt bewusst mit der Spaltung der Kinder von »South Park« ein, mit dem dualistischen Gerede eines »Wir« und eines »Ihr«, ohne dass der Zuhörer zu diesem Zeitpunkt überhaupt nur Kenntnis von der vermeintlichen Existenz einer Fremdgruppe hätte. Wie bei Jonathan Swift bedarf es auch bei Cartman für die Spaltung eines Differenzkriteriums, welches die »roten Haare« sind. Zwar unterscheiden sich die South-Park-Kinder bereits vor Erics Referat bezüglich vielfältiger Eigenschaften voneinander, doch erst sein rassistischer Vortrag produziert Differenz als soziales Konstrukt und erzeugt die Spaltung der Kinder auf der Basis des binären Gegensatzes von Nichtrothaarigen und Rothaarigen. Die dergestalt konstruierte Dichotomie zwischen den Kindern auf Grundlage des biologischen, phänotypischen Merkmals wird sodann genutzt, um die konstruierte Fremdgruppe mittels diverser Rassifizierungstechniken als eine fundamentale Bedrohung der Wir-Gruppe erscheinen zu lassen. Von einer »Krankheit« (Maladisierung, vgl. Kap. 2.2.3) ist die Rede, von blutsaugenden »Vampiren« (Vampirisierung, vgl. Kap. 2.6.5) sowie davon, dass die Erde in Dunkelheit getaucht werde (Diabolisierung und Dämonisierung, vgl. Kap. 2.6.3). Der Vortrag Cartmans illustriert das Wesen der diskursiven Rassifizierung, welche die narrative Konstruktion der Gruppen bewirkt, ihre Majorisierung bzw. Minorisierung sowie »rassistisches Wissen« über die »Fremdgruppe« produziert. Der erzeugte Antagonismus wird als unüberbrückbar charakterisiert, insofern die Krankheit als nicht heilbar deklariert und mittels der rassifizierenden Technik der Genetifizierung (»Rotschopf-Gen«) einer Verewiglichung (vgl. Kap. 2.1.4) unterzogen wird. Der Vortrag folgt der Logik eines Steigerungsimperativs, insofern die Formulierung »uns von diesen Geschöpfen befreien« die Konsequenz des eliminatorischen Rassismus in sich birgt, der seine Legitimation über das entworfene Bedrohungsszenario erhält wie auch über die dehumanisierende Behauptung, dass »Rothaarige« keine Seele besäßen, was die Senkung des Tötungshemmnis bewirken soll. Während es vor Cartmans Vortrag Kinder mit roten Haaren gibt, existiert nach seinem Schulreferat die »Rasse« der »Rothaarigen«. Die Funktion des Vortrags wird deutlich als Cartman ein Foto von Kyle zeigt. Es geht um die Demütigung Kyles, um seine Herabsetzung, wofür Cartman die Eigenschaft der Rothaarigkeit Kyles instrumentalisiert. Es geht um Macht über einen Jungen, den Cartman immer und immer wieder als »Jude« markiert. Der Rassismus ist die intentional produzierte und strategisch aufrechterhaltene Spaltung der menschlichen Gesellschaft zwecks Vorteilsaneignung und -wahrung; er ist das System der Vorherrschaft rassistisch Dominanter über rassistisch Dominierte. Die Wirkmächtigkeit des medialen Rassismus (vgl. Kap. 4.5) zeigte sich paradoxerweise daran, dass US-amerikanische Kinder die antirassistische Message der Episode »Gingers dont have souls« nicht verstanden und rothaarige Klassenkameraden verprügelten.
In ganz Europa sowie in den USA sind heutzutage noch immer Vorstellungen weit verbreitet, welche die Existenz von »Rassen« postulieren und dabei die Hautfarbe als Differenzkriterium bemühen. Genannt werden in der Regel die »weiße Rasse«, die »rote Rasse«, die »gelbe Rasse« und die »schwarze Rasse«. Den konstruierten Menschengruppen werden zumeist die Kontinente Europa, Amerika, Asien und Afrika zugeordnet. Die Einteilung des Globus in Kontinente findet sich bereits beim antiken Schriftsteller Herodot, der Europa, Asien und Afrika nannte. Die Klassifizierung der Menschheit auf Basis der Vorstellungen des Hautfarbenrassismus fand in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s Eingang in schulische Curricula wie etwa in dem weit verbreiteten französischen Schulbuch Le Tour de la France par deux enfants aus dem Jahr 1877 der Autorin Augustine Fouillée, die das Pseudonym G. Bruno benutzte. Fouillée konstruierte vier Rassen mit der Bezeichnung »race blanche«, »race rouge«, »race jaune« und »race noire« und bezeichnete die »weiße Rasse« als die perfekteste (»La race blanche, la plus parfaite de races humaines«). Auch in meinen universitären Rassismus-Kursen sind viele Studierende über die Feststellung zutiefst irritiert, dass »Rassen« eine bloße Erfindung des Rassisten seien. Rassismus beginnt jedoch nicht erst mit der Wertung der »Rassen« bzw. mit der Unterstellung, dass »Rasse« ein Schlüsselfaktor bezüglich der Fähigkeiten, der Intelligenz sowie der Charaktereigenschaften eines Individuums sei. Vielmehr beginnt Rassismus mit der Behauptung des Bestehens »menschlicher Rassen«. Rassismus liegt bereits dann vor, wenn man von »Rasse« nicht als sozialem Konstrukt des Rassifizierungsprozesses, sondern als einer biologischen bzw. natürlichen Größe spricht, wenn man die Existenz »menschlicher Rassen« postuliert. Diese Unterstellung »menschlicher Rassen« begegnet uns auf Schritt und Tritt, sodass die Akzeptanz des wissenschaftlichen Faktums ihrer Nichtexistenz offensichtlich sehr schwer fällt. In einem griechischen Schulbuch für die Grundschule entdecke ich eine Abbildung. Zu sehen ist ein Kind mit blonden Haaren, das seine Arme ausbreitet. Zu seiner Rechten sieht man einen Jungen in einem »Mao-Blaumann«, zu seiner Linken einen Jungen in Shorts mit schwarzer Hautfarbe. Neben dem »kleinen Chinesen« steht ein Junge in einem »Eskimo-Parka«. Die Bildunterschrift lautet: »Alle Kinder dieser Erde«. Wie bei Fouillée wird griechischen Kindern, die Lesen lernen, die Existenz von vier »Rassen« suggeriert, wobei für die »race rouge« hier das Inuit-Kind steht. Das Bild bzw. Ideologem von den vier »Rassen« begegnet uns indes keineswegs nur in Materialien aus dem 19. und 20. Jh. Beim Gang durch die Hochschule entdecke ich in einem Glaskasten ein Werbeplakat mit der Bildunterschrift: »Unternehmer werden mit Spaß am Spiel. Wirtschaft hautnah erleben beim Exist-prime-cup«. Zu sehen ist ein Bild von vier jungen Menschen, zwei Mädchen und zwei Jungen, die vor einem Computerbildschirm sitzen. Wie tief der Rassismus verankert ist, kann man daran erkennen, dass hier die Personenauswahl gar in vermeintlich antirassistischer Intention erfolgt. Der abgebildete Personenkreis soll unabhängig vom Geschlecht und der »ethnischen Herkunft« als gleichberechtigt konstruiert werden. Doch auch hier wird aufs Neue der »Rassegedanke« reproduziert: »race blanche«, »race rouge«, »race jaune« und »race noire« (»hautnah« erleben!), wobei es uns nicht sonderlich wundert, dass sich »die Blondine« im konzentrischen Mittelpunkt des Bildes befindet: die »race blanche« als die edelste »Ur-Rasse«, als die weiße Norm der Dominanzkultur.
Der Afrodeutschen Noah Sow ist beizupflichten, wenn sie die Meinung vertritt, Deutschland sei ein rückständiges Land bezüglich des Umgangs mit Rassismus. In Deutschland gibt es beispielsweise keine nennenswerte Bereitschaft, auf den Begriff »Rasse« als vermeintliche biologisch-genetische Größe zu verzichten und den Terminus »Rasse« nur als soziales Konstrukt im Kontext einer Rassismusanalyse zu benutzen. Noch immer existiert der Begriff »Rasse« in Art. 3 Abs. 3 GG. Trotz zahlreicher Stellungnahmen und Aufforderungen an die Bundesregierung ist der Terminus »Rasse« im Grundgesetz bis heute nicht ersetzt worden. Ein Grundgesetz ohne »Rasse« gibt es nicht. Dieser Tatbestand gilt indes nicht nur für das Grundgesetz; auch ein »rassefreies« Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) existiert nicht. In dem aus dem Jahr 2006 stammenden Gesetz heißt es gleich im ersten Paragrafen: »Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.« Ein im Sinne des AGG von Rassismus betroffenes Opfer, dem ein Arbeitsplatz mit der Begründung verweigert wird, dass die Kundschaft durch einen »Schwarzen« abgeschreckt werde, muss demzufolge erst einmal akzeptieren, dass es »Rassen« gibt, dass er/sie zur »Race noir« zählt, um eine Klage einreichen zu können. Dergestalt betrachtet muss das Opfer dazu bereit sein, sich rassistisch kategorisieren und damit aufs Neue diskriminieren zu lassen, um gegen eine Diskriminierung juristische Schritte einlegen zu können. Ist Deutschland (weiterhin) ein (zutiefst) rassistisches Land?
Es sei angemerkt, dass z. B. auch in der Genfer Deklaration des Weltärztebundes, die eine zeitgemäße Fassung des Hippokratischen Eides darstellen soll, bis heute das Wort »Rasse« benutzt wird, so heißt es hier:
»Ich werde mich in meinen ärztlichen Pflichten meinem Patienten gegenüber nicht beeinflussen lassen durch Alter, Krankheit oder Behinderung, Konfession, ethnische Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung oder soziale Stellung.«
Bewegung gibt es bezüglich des Terminus »Rasse« in Deutschland allerdings auf Länderebene. So ersetzte im November 2013 das Bundesland Brandenburg in der Länderverfassung die Passage »wegen seiner Rasse« durch die Wortwahl »aus rassistischen Gründen«. Eine Diskussion diesbezüglich findet auf Länderebene auch in Berlin statt, bislang indes aber ohne Resultat.
Nicht zu unterschätzen ist, dass der Rassismus sich auch im Kontext von Wörtern, Namen sowie Symbolen und Bildern manifestiert. Geht es um Benennungen von öffentlichen Institutionen und Straßen, so lässt sich bereits »vor der eigenen Haustür kehren«. Rassismus ist kein Phänomen, das sich irgendwo im (verbalen) Niemandsland abspielt. Reflektiert der Autor sein eigenes soziales Umfeld, so ist die im Jahr 2009 erfolgte Umbenennung der TFH Berlin in »Beuth Hochschule für Technik Berlin« anzuführen. Zum Zeitpunkt der Namensgebung muss es den Akteuren der Benennung bekannt gewesen sein, dass es sich bei Christian Peter Wilhelm Beuth (1781–1853) nicht nur um einen Reformer des preußischen Gewerbewesens handelte, sondern auch um ein bekennendes Mitglied der im Jahr 1811 gegründeten Deutschen Tischgesellschaft, die sich durch ihre starke antisemitische Grundhaltung auszeichnete. Zu den Texten, die im Kreis der Gleichgesinnten vorgetragen wurden, gehörte u. a. Achim von Arnims (1781–1831) antisemitischer Text »Über die Kennzeichen des Judentums«. Der Zweck des Textes bestand neben der »antisemitischen Belustigung« der Mitglieder in der Agitation für den Ausschluss der Juden aus den eigenen Reihen, was laut Arnim auch die »Absonderung« sogenannter »heimlicher Juden« einschließen sollte. Die Rede geht in ihrem mittleren Teil in einen Knittelvers über, der sich u. a. der Rassifizierungstechnik der Animalisierung (vgl. Kap. 2.6.1) bedient und den Bogen zu antisemitischen NS-Propagandafilmen spannt. Da heißt es:
»Der Ritter ruft: Was machst Du Katz [gemeint ist ein Frankfurter reicher Jude, d. Verf.]? / Der Jude sprach: Da läuft ein Ratz [eine Ratte, d. Verf.] / Und wirklich war zu dieser Zeit / Die ganze Stadt der Ratten Beut, / Die in dem Judenschmutz geheckt. / Der Jud hätt sich so gern versteckt / Wie eine Ratt im Loche klein / Er möchte gern unsichtbar sein […].«
Der Knittelvers endet mit der Zwangstaufe des Juden, wobei noch vermerkt wird: »Ein wenig Schläge obenrein, / Das soll ihm zum Gedächtnis sein.« Es ist einer der wohl schlimmsten antisemitischen Texte der deutschen Romantik, zumal er den eliminatorischen Hass des Autors erkennen lässt.
Zu den Befürchtungen des Tischgenossen Beuth zählte die Vorstellung, dass die Juden in Preußen rechtlich gleichgestellt würden und somit auch Landbesitz erwerben könnten. Ein des Beschneidens unkundiger christlicher Geistlicher, so Beuth, müsste sich dann gar der Aufforderung stellen, den Sohn eines jüdischen Gutsherrn zu beschneiden. Beuth tröstete sich mit den Worten, dass »das Verbluten und Verschneiden manches Judenjungen die wahrscheinliche und wünschenswerte Folge davon sei«. Bereits die Statuten der Deutschen Tischgesellschaft sprechen Bände über die Gesinnung ihrer Mitglieder. Einzuladen, so hieß es, seien nur »Wohlanständige«, worunter Männer »von Ehre und guten Sitten und in christlicher Religion geboren« verstanden wurden und keine »Philister«, als dessen Verwandte Clemens Brentano (1778–1842) – ebenso Mitglied der Deutschen Tischgesellschaft – die Juden bezeichnete.
Die Statuten der Tischgesellschaft zielten auf die Diskriminierung von Juden, ihren Ausschluss aus dem öffentlichen Leben; die Mitglieder teilten nicht nur ihren antifranzösisch-preußischen Patriotismus, sondern auch ihre Judenfeindschaft, die sich bei Arnim und Beuth deutlich dem Sprachduktus des eliminatorischen Antisemitismus annäherte. Mitglieder der Deutschen Tischgesellschaft forderten die Verweigerung der Staatsbürgerrechte, ja gar die Verbannung der Juden. Ein Vorbild für Studierende an einer deutschen Hochschule kann Christian Peter Beuth folglich nicht sein. Für wechselseitigen Respekt an einer Universität mit hohem Migrationsanteil, heterogener Religionszugehörigkeit sowie einer Mischung aus säkularen und nicht-säkularen Studierenden steht Beuth gerade nicht.
Die »Beuth Hochschule für Technik Berlin« befindet sich im Wedding, einem Berliner Ortsteil des Bezirks Mitte, unweit des sogenannten »Afrikanischen Viertels«, das durch seine ungewöhnlichen Straßennamen wie Togostraße, Kameruner und Swakopmunder Straße auffällt, die deutsche Kolonialgeschichte offenbaren. Bis heute werden dabei auch Schlüsselpersonen des deutschen Kolonialrassismus geehrt: Gustav Nachtigal (»Nachtigalplatz«), Franz Adolf Lüderitz (»Lüderitzstraße«) und Carl Peters (»Petersallee«). Letzterer gründete im Jahr 1884 die »Gesellschaft für Deutsche Kolonisation«; auf seine Aktivitäten ist die Kolonie »Deutsch-Ostafrika« zurückzuführen. Die offen rassistischen Einstellungen von Carl Peters (1856–1918) sind alles andere als ein Geheimnis, zumal bereits Ende des 19. Jh.s die Spitznamen »Hänge-Peters« und »blutige Hand« kursierten. Die Verflechtung von Antisemitismus und antinegridem Rassismus bzw. Kolonialrassismus bringt der sozialdemokratische Vorwärts im Februar 1899 in der Charakterisierung von Peters als grimmigem »Arier« zum Ausdruck, »der alle Juden vertilgen will und in Ermangelung von Juden drüben in Afrika Neger totschießt wie Spatzen und zum Vergnügen Negermädchen aufhängt, nachdem sie seinen Lüsten gedient«. Trotz der Kritik an Peters hatte der Vorwärts keine Probleme damit, das N-Wort zu benutzen, das nicht nur die Existenz einer »negriden Rasse« unterstellt, sondern auch allerspätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jh.s für jedermann erkennbar ein pejorativ verwendeter Terminus war. Durch Quellen belegt ist nicht nur das äußerst brutale Vorgehen von Peters, sondern auch der Tatbestand, dass dieser nach dem Offenbarwerden eines Verhältnisses seiner afrikanischen Geliebten mit seinem Diener beide hängen und ihre Heimatdörfer zerstören ließ, was zu einem Aufstand führte, der blutig niedergeschlagen wurde. Die unehrenhafte Entlassung Carl Peters folgte daraufhin im Jahr 1897. Adolf Hitler hob allerdings das Urteil des kaiserlichen Disziplinargerichts im Jahr 1937 auf. Carl Peters galt nunmehr als »vorbildlicher Deutscher«, dem durch Straßenbenennungen Ehre erwiesen wurde. Der Name der Petersallee in Berlin ist somit kein Erbe des Wilhelminismus, sondern stammt erst aus dem Jahr 1939. Im Jahr 1941 widmete der deutsche Nationalsozialismus dem antisemitischen Kolonialrassisten den anti-britisch positionierten Propagandafilm »Carl Peters«, dessen Rolle von Hans Albers gespielt wurde. In den 1980er Jahren verstärkte sich die Kritik an der Namensgebung der Straße. Infolgedessen kam es jedoch nicht zu einer Umbenennung, sondern zu einer »Umwidmung«. Als »Ersatzmann« für einen Kolonialverbrecher wählte die Stadtverwaltung den Berliner Juristen und Widerstandskämpfer Hans Peters (1896–1966), an den jedoch nur ein kleines Schildchen erinnert. Trotz eines von der Berliner »Black Community« geführten jahrelangen Protestes gab es seitens des Bezirks Mitte nahezu keine Bereitschaft, sich der kolonialrassistischen Vergangenheit zu stellen. Im Herbst 2011 warb die CDU gar auf einem Plakat mit der Aufschrift »Gegen Strassenumbenennungen im Afrikanischen Viertel – darum CDU wählen«.
Im »Afrikanischen Viertel« des Berliner Wedding plante Carl Hagenbeck (1844–1913) vor dem Ersten Weltkrieg ein Ausstellungsgelände zwecks Präsentation der damaligen »deutschen Afrikakolonien«. Vorgesehen war nicht nur die Zurschaustellung afrikanischer Tiere, sondern auch die von Afro-Afrikanern. Bei dem Weddinger Gelände handelte es sich um den heutigen Volkspark Rehberge. Bereits im Jahr 1887 hatte der Tierhändler Hagenbeck einen Zirkus mit dem Namen »Carl Hagenbecks Internationaler Circus und Singhalesen-Karawane« eröffnet. Die Präsentationen von »Fremden« umgeben von »wilden Tieren« entwickelten sich zu einem Publikumsmagneten. Es entsprach dem kolonialistischen Zeitgeist sowie biologistischen Rassetheorien »Kolonialisierte« in Zoos zu präsentieren und ihre »Halbzivilisiertheit« durch die räumliche Nähe zum Tierischen zu suggerieren. Noch im Jahr 2005 plante der Augsburger Zoo eine Veranstaltung mit dem Titel »African Village«, bei der Schwarze gemeinsam mit Tieren in »dörflicher Umgebung« zur Schau gestellt werden sollten. Die Kritik derartiger Völkerschauen als »Menschenparks« in rassistischer Traditionslinie konnte die Augsburger Zoodirektorin nicht nachvollziehen.
Den geringen Reflexionsgrad über Rassismus in Deutschland verdeutlichte im Jahr 2012 hinsichtlich des antinegriden Rassismus die Debatte über die Inszenierung des Stücks »Ich bin nicht Rappaport« seitens des Schlosspark Theaters Berlin. Für die Rolle eines schwarzen US-Amerikaners schminkte man einen weißen Schauspieler schwarz. Minimalkenntnisse bezüglich des antinegriden Rassismus hätten ausgereicht, um die Problematik eines solchen »Blackfacing« zu erkennen. Bei »Blackface« handelt es sich um eine rassistische Theatermaskerade, die im Kontext der sogenannten Minstrel Shows (Englisch für: Bänkelsänger, Spielmann) im ersten Drittel des 19. Jh.s entstand. Weiße Schauspieler färbten ihre Gesichter schwarz und karikierten vor einem weißen Publikum zu dessen Belustigung in übertriebener Weise das, was dieses für die afroamerikanische Art des Lebens, Musizierens und Tanzens hielt. Um die Jahrhundertwende traten auch immer mehr afroamerikanische Minstrelmusiker wie etwa Bert Williams (1874–1922) auf, die sich ihre Gesichter ebenfalls schwarz schminkten und so die rassistischen Auftrittsbeschränkungen für »Schwarze« unterliefen. Egal ob weiß oder schwarz, Blackface blieb eine Maske für das Pejorativ des »tumben, ängstlichen, stets fröhlichen und feigen ›Negers‹«.
In der U-Bahnstation Amrumerstrasse, die für den Anschluss der Beuth Hochschule an das Berliner Nahverkehrsnetz sorgt, wirbt ein Plakat für eine Cafébar, die sich in der Kiautschoustrasse in unmittelbarer Nähe der Hochschule befindet. Auch die Kiautschoustrasse offenbart deutsche Kolonialgeschichte. Das Gebiet Kiautschou, das sich an der chinesischen Ostküste befand, überließ das chinesische Kaiserreich im Jahr 1898 dem deutschen Kaiserreich zur Pacht. Der Pachtvertrag war das Ergebnis einer militärischen Landnahme im Jahr zuvor und alles andere als ein Gentlemen-Agreement. Als Vorwand der Besetzung diente dem Deutschen Kaiserreich die Ermordung zweier deutscher Missionare sowie eines Diplomaten. Kiautschou fungierte nicht nur als Flottenstützpunkt und als Ausgangspunkt für wirtschaftliche Aktivitäten, sondern auch als Werbeobjekt für die imperialistische Kolonialpolitik und die »Überlegenheit der deutschen Flotte«. Der Name Kiautschou schmückte u. a. eine 20 Pfennig-Briefmarke, welche die Kaiserjacht »Hohenzollern II« abbildete, sowie diverse Postkarten. Auf einer Karte mit dem Text »Schönen Gruss aus Kiao-Tschau« sieht man zwei chinesische Kinder vor einem übergroßen Hohenzollern-Adler stehen. Das eine der beiden Kinder hält ein Fähnchen mit einem chinesischen Drachen in der Hand, das andere ein Schild mit der Aufschrift »Deutschland Deutschland über alles!« Auffallend ist, dass die Gesichter der Kinder nahezu wie geklont wirken (vgl. Kap. 2.2.4), während ihre Garderobe für den exotisierenden Effekt sorgt (vgl. Kap. 2.3.5). Kiautschou bildete den Auftakt für eine aggressive Kolonialpolitik, die im Kontext des Boxeraufstandes in der antiasiatischen »Hunnenrede« des deutschen Kaisers und der Entsendung von Truppen zur Niederschlagung der Erhebung gipfelte. Von einer Cafébar in der Kiautschoustrasse im Berliner Stadtteil Wedding führt der Weg zurück zur historischen Dimension des antiasiatischen Rassismus wie des Kolonialrassismus des deutschen Kaiserreichs.
Geht es um belastete Straßennamen, aus deren Wörtern der Rassismus spricht, so ist es von der Beuth Hochschule Berlin zur Mohrenstraße nicht weit, die nach schwarzen Musikern des preußischen Heeres benannt ist. Seit dem Jahr 1681 partizipierte Brandenburg am Sklavenhandel von der Festung Großfriedrichsburg im heutigen Ghana aus. Bereits im Jahr 1721 verkaufte Friedrich Wilhelm I. die preußischen Afrika-Annexionen an die Niederländische Westindien-Kompanie. Zusätzlich zur Kaufsumme waren »12 Negerknaben, von denen sechs mit goldenen Ketten geschmückt sein sollten«, zu stellen. Da es sich in der damaligen Zeit bei den sogenannten »Hofmohren« um »Statussymbole« handelte, wurden diese stattlich ausstaffiert und verfügten über Turbane, sodass sie für Muslime gehalten und »Türken« genannt wurden. An dieser Stelle überschneidet sich der Kolonialrassismus mit dem antimuslimischen Rassismus, insofern der abwertende Terminus »Mohr« ursprünglich den muslimischen Mauren bezeichnete. Auch bezüglich der Mohrenstraße erweist sich Deutschland als rückständiges Land. Eine Bereitschaft auf die Argumente der »Black Community« in Deutschland oder von Menschenrechtsaktivisten einzugehen, dass es sich bei der Bezeichnung »Mohr« um einen rassistischen Begriff handelt und eine »Mohrenstraße« ein Ausdruck mangelnder Aufbereitung der Geschichte des deutschen Kolonialrassismus darstellt, existiert seitens der Mehrheit der Stadtvertreter des Bezirks Mitte bislang nicht. Im Unterschied zur Berliner CDU, die im »Mohren« kein rassistisches Stereotyp erkennen kann und die Diskussion gar für »abstrus« hält, hat sich die Firma Sarotti von ihrer Werbefigur, dem »Sarotti-Mohr«, getrennt. Antirassistische Argumente haben dazu geführt, dass im Jahr 2004 der »Sarotti-Mohr« durch den »Sarotti-Magier« ersetzt und die Produktpalette neu konfiguriert wurde. »Der Sarotti-Mohr« hat bei Sarotti ausgedient; präziser formuliert: fast, insofern der Name »Mohr« nicht mehr benutzt wird und die schwarze Gesichtsfarbe durch einen silbrigen Teint ausgetauscht wurde. Durch den bleibenden Wiedererkennungseffekt werden indes ältere Käufer weiterhin einen »Sarotti-Mohr« erblicken. Im Berliner Bezirk Steglitz wiederum existiert bis heute als Seitenstraße der Schloßstraße die Treitschkestraße, benannt nach dem antisemitischen Historiker Heinrich von Treitschke (1834–1896). Nach jahrelangen kontroversen Diskussionen konnten die Anwohner im Dezember 2012 über eine anvisierte Umbennennung der Straße abstimmen. 78 Prozent der Anwohner sprachen sich gegen eine Umbenennung aus (vgl. Kap. 1.3.5, 1.3.11).
Beim Umsteigen kann man sich an einem S-Bahn-Stand mit einem »Schoko-Traum« stärken. Das Werbeplakat für die »Schoko-Vanille-Schnitte mit Sahne« kommt nicht ohne den Klassiker des antinegrid-rassistischen Marketings aus: Das Foto eines kleinen schwarzen, properen Jungen mit nacktem Oberkörper wirbt für das als »Aktion« gekennzeichnete Kuchenangebot. »Schwarze« – egal ob klein oder groß – werden zumeist halbnackt abgelichtet und mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht, bevorzugt mit Schokolade, Kakao oder Kaffee. Ihr eigentliches Wesen ist und bleibt für den Werbedesigner ihre Hautfarbe, der »schwarze Körper« wird zur Ware konstruiert. Am S-Bahn-Stand werden auch »Kameruner« verkauft. Der »Kameruner« ist eine Berliner Bezeichnung für Krapfen und gleichfalls ein sprachliches Relikt des deutschen Kolonialrassismus.
Ein Paar Häuserzüge weiter befinden sich in Nachbarschaft der Beuth Hochschule für Technik die »Berliner Werkstätten für Behinderte«, was ich einem Lageplan der Berliner U-Bahn entnehme. Der Terminus »Behinderte« ist ein rassistischer Begriff, insofern Menschen mit Beeinträchtigungen auf ein Merkmal unter vielen ihrer individuellen Charakteristika reduziert werden. Der Begriff »Behinderte« ist ein Beispiel für die diskursive Rassifizierungstechnik der Essentialisierung (vgl. Kap. 2.1.3), insofern dieser einen Menschen entpersonalisiert und unter eine konstruierte Gruppe zwangssubsumiert. Essentialisierung wie Kollektivierung gehen bei diesem Begriff Hand in Hand, der zugleich die Gesellschaft entlastet, insofern scheinbar nicht sie Verantwortung dafür trägt, dass aus einer Beeinträchtigung eine soziale Behinderung wird, da man die Ursache in der Natur des Betroffenen verortet. Über den Sachverhalt ärgere ich mich und denke, dass es in Deutschland keinerlei Bewusstsein von der Verwendung rassistischer Sprache gibt und dies nicht einmal bei einer sozialen Einrichtung. Eine Überprüfung im Internet ergibt indes, dass die offizielle Bezeichnung der »BWB« mittlerweile »Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung« lautet. Bei den Verkehrsbetrieben hat es jedoch wohl niemand für derart wichtig gehalten, bei den ansonsten häufig erneuerten Lageplänen auch den Namen der »BWB« zu korrigieren. Kaum sind an der eigenen Hochschule die sanitären Umbauarbeiten beendet, entdecke ich in jeder Etage neue Schilder mit der Aufschrift »Behinderten-WC«.
Am Zeitungsstand kann man die Süddeutsche Zeitung kaufen, die nicht per se als Rassismus-verdächtig gilt. Die Wochenendausgabe vom 9./10. Januar 2016 zeigt als Schwarz-weiß-Illustration eine ausgestreckte lange schwarze Hand, die zwischen die Beine eines weißen Frauenkörpers greift und deren gespreizte Finger auf der Vagina ruhen. Zu lesen ist in großen Lettern der Text: »Viele junge Muslime können nicht entspannt dem anderen Geschlecht begegnen. Das sind jedesmal hochsexualisierte Situationen. Auch das ist der Boden für den Exzess von Köln.« Das Titelblatt bedient sowohl antinegridrassistische, antimuslimisch-rassistische wie sexistische Motive und knüpft in der Darstellung an die sogenannte »Schwarze Schmach-Kampagne« (vgl. Kap. 2.6.2) der Weimarer Republik an. Die Illustration reproduziert die Vorstellung von der Existenz von »Menschenrassen«, wobei im Sinne des Hautfarbenrassismus »Schwarze« und »Weiße« als sich antagonistisch gegenüberstehende »Großrassen« präsentiert werden. »Schwarzsein« wird kausal konnotiert mit sexualisierter Gewalt und Bedrohung, der sexuelle Gewalttäter ist »der Schwarze«. Wie bei der »Schwarzen-Schmach-Kampagne«, so steht »Schwarzsein« hier für das unzivilisierte Wilde, für Menschen, die einzig ihren Trieben folgen und nicht über Moral, Sitte und Ehre verfügen. Die Grafik wiederum reduziert die weiße Frau in sexistischer Weise auf ihren nackten Unterkörper, insofern nur ihre langen weißen Beine zu sehen sind. Während die Illustration »Schwarzsein« sexualisiert (vgl. Kap. 2.5.1) und dämonisiert, stellt der Text eine Kausalverknüpfung zwischen der sexualisierten Gewalt und der Religion des Islam her und greift das im antimuslimischen Rassismus übliche Stereotyp von der »frauenverachtenden Religion« auf. Die Gestaltung der Titelseite ist, dergestalt betrachtet, ein Beispiel für Intersektionalität, d. h. der Überschneidung verschiedener Rassismen, wobei das Verflechtungskonstrukt nicht nur zu einer additiven, sondern zu einer rekursiven Verstärkung führt. Der »Schwarze« muslimischen Glaubens sieht sich einer doppelten Sexualisierung wie Dekulturalisierung ausgesetzt, die ihn einer vervielfältigten Rassifizierung unterwirft und seine rassistische Exklusion qualitativ verstärkt.
Am Zeitungsstand der S-Bahn kann man auch den Focus kaufen, dessen Titel vom 8. Januar 2016 einen nackten weißen Frauenkörper zeigt, auf dem mehrere schwarze Handabdrücke zu sehen sind. Wie die Süddeutsche Zeitung, so reduziert der Focus die weibliche Gestalt auf ihren Körper, sodass die obere Kopfhälfte mit der Augenpartie nicht zu sehen ist. Obwohl der Frauenkörper partiell mit dem Schriftzug »Frauen klagen an« bedeckt ist, folgt das Titelbild dem Muster sexistischer Werbung, dem Prinzip des »sex sells«, indem es die erotisierende Darstellung der Frau bemüht. Das Titelbild des Focus steht ebenfalls in der Traditionslinie der antinegriden »Schwarzen-Schmach-Kampagne«, was noch dadurch verschärft wird, dass man außer dem Motiv der sogenannten »Rassenschande« sowie der »triebhaften Animalisierung« das Stereotyp des »dreckigen Schwarzen« bemüht, dessen schmutzige Hände abfärben und ihre Spuren auf dem sauberen weißen Frauenkörper hinterlassen. Auch der Focus ist ein Beispiel dafür, dass Sexismus wie Antinegrismus als Spielarten des Rassismus (vgl. Kap. 1.3) über korrelierende Tiefenstrukturen verfügen, die sich im Titelbild spiegeln. Gleichwohl gibt das Magazin vor, sexualisierte Gewalt gegen Frauen anprangern zu wollen. Während sich nach heftigen Reaktionen in sozialen Netzwerken die »SZ« zu einer Entschuldigung durchrang, verteidigte der Focus gar das Cover des Heftes.
Rassismus beginnt bei der eigenen Denk- und Handlungsweise und folglich bei uns und nicht bei den Anderen. Deshalb noch einmal zurück zur Beuth Hochschule für Technik, die derzeit keine Bereitschaft zeigt, einen Gebetsraum für muslimische Studierende einzurichten und diesen auch so zu benennen. Stattdessen soll es einen »Raum der Stille« geben, der auch von anderen Studierenden genutzt werden kann. Man zieht sich auf das Argument der religiösweltanschaulichen Neutralität des Staates sowie auf die Raumknappheit und auf die Gleichbehandlung zurück. Auffallend ist indes, dass die religiös-weltanschauliche Neutralität in Deutschland stets instrumentalisiert wird, wenn es um den Islam geht, während diese im sonstigen Alltag sowie in der Politik kaum Beachtung findet. Angesichts des antimuslimischen Rassismus, angesichts rechtspopulistischer, islamfeindlicher Strömungen wären klare Signale angesagt, deutliche Zeichen eines »Der Islam gehört zu Deutschland«, was folglich auch »Muslime gehören zur Beuth Hochschule« heißt. Rassistische Signale sind hingegen die eines ewigen »Wir und Ihr«, eines Religiöse versus Nicht-Religiöse, eines polarisierenden Spaltens, eines »Du bist anders« oder »Ihr macht immer nur Probleme«.
Die gegebenen Einblicke weisen auf eine Vielzahl von Rassismen (vgl. Kap. 1.3) hin, deren jeweilige soziale Funktion, Historie und pejorative Stereotype einerseits zwar getrennt voneinander, andererseits aber auch in vergleichender Betrachtung analysiert werden sollten, zumal vielfältige wechselseitige Anleihen, übergreifende Diskurse und Verflechtungen mit wechselseitigen Verstärkungseffekten existieren und sich erst so das Wesen des Rassismus offenbart.
Das erste Kapitel des Buchs befasst sich mit den Grundlagen des Rassismus. Erläutert werden die Termini »Rasse« und »Rassismus«, die Spielarten, Varianten und historischen Erscheinungsformen des Rassismus, dessen Dimensionen wie Funktionen und Ursachen. Die Skizzierung einer eigenen Definition im Sinne einer ganzheitlichen Fassung des sozialen Phänomens rundet das Kapitel ab. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den narrativen Techniken der Rassifizierung, d. h. der Art und Weise, wie mit Hilfe von Diskursen eine menschliche Gemeinschaft in eine »Wir-Gruppe« und eine »Fremdgruppe« gespalten wird. Dabei stehen der Konstruktionsprozess, der den »Anderen« erst zum Anderen macht sowie die narrativen Verfahren, welche die dergestalt gebildeten Gruppen einander antipodisch gegenüberstellen, im Vordergrund. Unterschieden wird dabei zwischen grundlegenden, Körper-, Kultur-, Sozialitäts- sowie Sexualitäts-bezogenen und dehumanisierenden Techniken. Das dritte Kapitel analysiert die nicht-diskursive Seite der Rassifizierung in Gestalt des strukturellen Rassismus. Der Bogen spannt sich von der ungleichen Ressourcenverteilung, der Vergabe der Staatsbürgerschaft, der Regulierung der Einbürgerung, der staatlichen Gesetzgebung und Normierung bis hin zum rassistischen Wissen. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem institutionellen Rassismus und behandelt den Rassismus im Bildungs- und Ausbildungssektor, auf dem Arbeitsund Wohnungsmarkt, im Gesundheitswesen, bei Justiz und Polizei sowie im Bereich der Medien. Das fünfte Kapitel behandelt unmittelbare Praxen rassistischer Gewalt und zwar u. a. die Segregationspolitik, Ethnozid und Genozid, die Vertreibung, Übergriffe und Pogrome sowie rassistische sexualisierte Gewalt. Das sechste Kapitel schließlich thematisiert Formen des Alltagsrassismus. Eine große Rolle spielen hier die Sprache und die alltägliche Kommunikation. Gezeigt wird, dass der Alltagsrassismus sowohl beabsichtigtes wie nicht-intendiertes rassistisches Verhalten umfassen kann.
In allen sechs Kapiteln liegt nicht nur aus Platzgründen der Schwerpunkt der Sichtweise auf Deutschland, Europa und den USA. Zwar existiert Rassismus unseres Erachtens überall auf dem Globus und sind die realen Tätergruppen vielfältig wie die potenziellen Opfergruppen beliebig, doch es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Dimension wie Relevanz des Rassismus maßgeblich ein Produkt des weißen Mannes sind. Die Europa-zentrierte Sichtweise folgt in diesem Sinne der in Sachen Rassismus historisch betrachtet am meisten relevanten Tätergruppe und ihrer Verbrechen. Eine derartige Sichtweise hat somit nichts mit einer eurozentrischen Geschichtsbetrachtung zu tun; sie versucht vielmehr verklärende Relativierungen des historischen Bezugs von Rassismus und »Weißsein« zu vermeiden, sodass im Folgenden nur am Rande von außereuropäischen Erscheinungen die Rede sein wird.