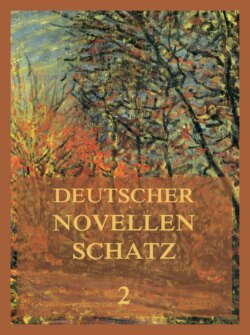Читать книгу Deutscher Novellenschatz 2 - Adalbert Stifter - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеJohann Ludwig Tieck, geb. 31. Mai 1773 in Berlin, gest. 8. April 1853 ebendaselbst, Sohn eines wackeren Seilermeisters, zeigte schon auf dem Gymnasium ein frühreifes Talent, schrieb später für den alten Nicolai Erzählungen unbedeutender Art, wie „Peter Lebrecht“ u. dgl., aber auch Bedeutendes, wie den Roman „William Lovell“, lebte 1799—1800 zu Jena im Verkehr mit den Brüdern Schlegel, Novalis, Brentano, Fichte, Schelling, daneben auch mit Goethe und Schiller, und erwuchs zum dichterischen Haupte der romantischen Schule, in welcher Eigenschaft er mit der „Genoveva“, dem „Kaiser Octavianus“, dem späteren „Fortunat“ und mit den im „Phantasus“ gesammelten Märchen, Märchennovellen und Märchendramen geraume Zeit die deutsche Geisteswelt beherrschte. Er half die ersten kindlichen Anfänge des Studiums unserer mittelalterlichen Poesie heraufführen, das er nachher mit Shakespeareschen Stücken vertauschte, die jedoch ziemlich unfruchtbar geblieben sind. In der Mitte seines Lebens, 1819, ließ er sich dauernd zu Dresden nieder, wo er als Dramaturg am Theater wirkte, besonders aber durch seine berühmten abendlichen Vorlesungen einen von nah und fern um ihn versammelten Kreis begeisterte. Dort schrieb er die Novellen, welche die dritte Periode seiner schriftstellerischen Laufbahn bezeichnen. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. wurde er von diesem Freunde der romantischen Dichtungen und Strebungen 1841 nach Berlin gezogen, wo ihm in heiterer, doch nicht ganz ungetrübter Muße sein Lebensabend verfloss. Ein Verdienst, das ihm bei keiner Gelegenheit vergessen werden darf, ist, dass er, neben den Schriften von Maler Müller, Lenz, Schröder, die Schriften Heinrichs v. Kleist herausgegeben hat, die ohne ihn vielleicht noch lange unbeachtet geblieben wären.
Treck ist nächst Goethe der Begründer derjenigen Gattung, die man die moderne oder auch die Gesellschaftsnovelle nennt. Er selbst hat sich über den Grund und Boden derselben klar ausgesprochen. „Alle Stände“, sagt er, „alle Verhältnisse der neuen Zeit, ihre Bedingungen und Eigentümlichkeiten sind dem klaren dichterischen Auge gewiss nicht minder zur Poesie und edlen Darstellung geeignet, als es dem Cervantes seine Zeit und Umgebung war, und es ist wohl nur Verwöhnung einiger vorzüglicher Kritiker, in der Zeit selbst einen unbedingten Gegensatz vom Poetischen und Unpoetischen anzunehmen. Gewinnt jene Vorzeit für uns an romantischem Interesse, so können wir dagegen die Bedingungen unseres Lebens und der Zustände desselben umso klarer erfassen.“
Die Forderung, welche Tieck an die Novelle stellt, ist die, dass sie, zum Unterschiede von Begebenheit, Erzählung, Geschichte, „einen großen oder kleineren Vorfall ins hellste Licht stelle, der, so leicht er sich ereignen kann, doch wunderbar, vielleicht einzig ist.“ „Diese Wendung der Geschichte, dieser Punkt, von welchem aus sie sich unerwartet völlig umkehrt und doch natürlich, dem Charakter und den Umständen angemessen, die Folge entwickelt, wich sich der Phantasie des Lesers umso fester einprägen, als die Sache, selbst im Wunderbaren, unter andern Umständen wieder alltäglich sein könnte. So erfahren wir es im Leben selbst, so sind die Begebenheiten, die uns, von Bekannten aus ihrer Erfahrung mitgeteilt, den tiefsten und bleibendsten Eindruck machen.“
Ein Beispiel dieses natürlich Wunderbaren, das ihm an die Stelle des romantischen Wunders getreten ist, findet er in der Novelle der Goetheschen Ausgewanderten von dem leichtsinnigen Sohne, der durch den aufspringenden Schreibtisch seines Vaters (Tieck sagt in der Zerstreuung „Ladentisch“, wodurch die Sache bedeutend unerbaulicher würde) zu schlimmen Griffen verleitet wird. Eine ähnlich wunderbare Fügung stellt auch er gleich in seiner ersten Novelle „Die Gemälde“ dar, indem dort die verloren geglaubten Kunstschätze durch einen ungemein sinnig angelegten Zufall wieder zu Tage gebracht werden und das Glück des Helden, eines jungen Mannes von freilich etwas zweifelhaftem Charakter, wieder herstellen.
Diesen Umschlag, der keineswegs immer von außen kommen muss, sondern oft nur eine plötzliche eigentümliche Wendung des Gemütes sein kann, in welcher eine ursprüngliche Anlage hervorbricht, hat Tieck in den meisten seiner Novellen, jedoch mit sehr ungleichem Glücke durchgeführt. Aber nicht nur ist der Kern derselben von ungleichem Wert, sondern sie leiden auch fast ohne Ausnahme, auch die besseren, an dem gleichen Fehler. Fast nirgends kommt es zu einer vollen runden Gestaltung, die Figuren haben fast alle etwas Schattenhaftes, sie tun gelegentlich dieses oder jenes, aber meist ziehen sie es vor, sich gegeneinander auszusprechen. Und in diesem übermäßigen Gespräche, das die eigentliche Handlung vertritt, ja oft die ganze Handlung ist, führt der Dichter beständig durch den Mund seiner Personen mit wohlbekannter Stimme selbst das Wort. Hoch und Niedrig bekunden die gleiche Kulturstufe; die mittelalterlichen Figuren singen so gut wie die modernen das Lied des neunzehnten Jahrhunderts, und immer in den gewohnten Tieckschen Koloraturen. Dabei zeigt sich in der Charakteristik etwas Schwankendes, ein Übergehen von einer Richtung zu der andern, ja eine bedenkliche Hinneigung zu zweideutigen oder gar unzweideutig verwerflichen Charakteren, welchen mit einer gewissen ironischen Salbung Absolution erteilt wird; so dass man im Grunde wenig verändert in der neuen Form doch wieder das alte Wesen der Romantik zu erkennen glaubt, jener Welt des Unbestimmten, des ironischen Zerfließens aller Gedanken und Grundsätze.
So ist denn die Tat, mit welcher die neue Epoche begann, eigentlich nicht weit über den guten Vorsatz hinaus gekommen. Aber auch diese unvollkommene Stufe brachte einen Fortschritt von großer Wirkung, indem die Nachstrebenden ein Vorbild vor sich hatten, dessen richtiger Intention sie nur zu folgen brauchten, um über die mangelhafte Gestaltung hinweg zu künstlerischer Plastik zu gelangen; ein Vorbild, durch welches umso mehr das Bewusstsein geweckt werden musste, weil es von dem alten Zauberer selbst herrührte, der seinen Stab wegwarf und aus der „mondbeglänzten Zaubernacht“ hervor an das Licht des Tages trat.
Auch war das erste Auftreten ein glänzendes, ja glänzender als die meisten der späteren Hervorbringungen, sofern „Die Gemälde“ in Gehalt und Kraft der Behandlung sich mehr gleich bleiben, mehr aus Einem Gusse gearbeitet sind, als ihre jüngeren Geschwister. Die Redner sind noch frisch bei Atem, nicht so müde und ermüdend, wie sie im Laufe der Tieckschen Novellenproduktion immer mehr werden; sie sprechen sich so lebhaft aus, dass sie etwas lebendiger scheinen, als sie vielleicht in Wirklichkeit sind. Überdies erhebt sich das Gespräch mitunter zu dramatischem Leben, wenn z. B. Kunstkenner ein angeblich altes Gemälde preisen, von welchem der Leser im Voraus weiß, dass es untergeschoben ist, und wenn die komische Wirkung sich äußert, indem Derjenige, der in einem Falle als der größere Kenner den Betrug durchschaute und triumphierend aufdeckte, in einem andern Falle sich umso ärger prellen lässt. Zwar kündigt sich schon, mehr als zu wünschen, das ungebührlich viele Reden und dessen Manieriertheit an; auch steht dicht neben dem Geistreichen schon das Gegenteil desselben, so dass man voraussieht, was der Dichter nach beiden Seiten noch wird leisten können: aber Witz und Geist sind siegreich überwiegend; die wenige Handlung ist einfach und natürlich ; das Ganze voll heiterer Anmut; und die Glückskatastrophe bricht artig überraschend herein. Persönliche Anspielungen, die hier auf sich beruhen bleiben, mögen den Reiz der Novelle bei den Zeitgenossen geschärft haben. Was jedoch diesen Reiz und die Zeitgemäßheit erhöhte, das war, dass der alte Mystiker und Anhänger des ästhetischen Katholizismus, dem man selbst nachsagte, dass er katholisch geworden sei (Frau und Tochter waren übergetreten), hier auf einmal die Kunstjünger seines Franz Sternbald, die christlichen Maler „im sogenannten altdeutschen Rocke, die weißlichen Haare auf den Schultern hängend, und mit einem blonden Bärtchen“, aufs Entschiedenste verspottete.
Noch höher stieg das frohe Erstaunen, als im nächsten Jähre, 1823, die „Verlobung“ erschien, worin er von der Höhe des modernen Denkens herab dem Modepietismus den Krieg erklärte. Es war just die Zeit der falschen Wanderjahre, die er denn auch in dieser Novelle mit Worten der Verachtung geißelt; auch Fouqué, der in der Vorrede zum „Zauberring“ das Publicum unterrichtet, dass er vor dem Romanschreiben immer zu beten und hieraus seine Eingebungen zu schöpfen pflege, erhält einen gutgezielten Hieb. Um dieser Gesinnungsäußerung willen, fand die Novelle den lebhaftesten Beifall der Gleichgesinnten. Man fühlte es wie Befreiung von einem Alp, das der erste Dichter nächst Goethe, wofür Tieck ziemlich unbestritten galt, so offen und freisinnig in die geistigen Kämpfe der Gegenwart eintrat, dass er, auch innerhalb des Protestantismus und einem Auswuchse desselben gegenüber eine protestantische Gesinnung bekannte. Das ist aber auch alles, was sich zu Gunsten dieser Novelle sagen lässt: Handlung keine, die Figuren leblos, ja selbst ihre Reden so verschwommen und abgeblasst, dass man die Partei der Frommen, wenn sie nicht gelegentlich ein paar Schlagwörter zum Besten gäbe, aus ihren eigenen Äußerungen kaum als solche erkennen würde, sondern von ihrem Gegner auf Treu und Glauben hinnehmen müsste, dass sie es sei.
An den gleichen Mängeln leiden in verschiedenen Abstufungen seine übrigen Novellen, die in den zwanziger und dreißiger Jahren erschienen und von welchen die „Ahnenprobe“, die „Gesellschaft auf dem Lande“, der “15 November“ und etwa die „Wundersüchtigen“ dem Kerne nach die bedeutendsten sein dürften. Die Romane „Aufruhr in den Cevennen“ u. a., welche Tieck ebenfalls Novellen benannt hat, gehören nicht in dieses Gebiet., nur dass eben auch hier der Kern leider von keiner festen gesunden Frucht umschlossen ist. Besonders Schade ist um die zweite der genannten, um die zu ihrer Zeit mit Jubel begrüßte sogenannte Zopfnovelle, die einer ernstlichen schönen Verherrlichung der alten-Fritzischen Periode gleichwohl humoristischerweise zum Mittelpunkt einen Schwindler gibt, der alle Welt und zugleich sich selber anlügt, er sei ein Ziethenscher Husar gewesen, und er sich in die Illusion seiner Teilnahme an jener großen Zeit so tief hineingelebt, dass er, als ein mutwilliger Mensch, ihm den Zopf abschneidet, sich darüber zu Tode grämt. Aber auch hier schwimmt der treffliche Brocken in einer dünnen Brühe.
In den späteren Novellen erscheint zum Teil an der Stelle des natürlich Wunderbaren, das der Dichter so richtig aufgestellt hat, das unnatürlich Wunderliche, wo nicht noch Schlimmeres. Vieles lässt sich wohl aus dem unbekümmerten Fluge der Feder erklären: denn man glaubt mitunter wahrzunehmen, wie die Blätter einzeln in die Druckerei gewandert sein müssen, so dass es z. B. vorkommen kann, dass eine Heldin auf einem folgenden Bogen unversehens einen ganz andern Namen führt als auf dem vorhergehenden. Nachgerade sind es nur noch in Gespräche eingekleidete Leitartikel, worin der Verfasser gegen literarische und soziale Richtungen polemisiert. Zuletzt griff er gar wieder in die alte romantische Rumpelkammer und putzte seine Gegner mit phantastischen Larven auf, die aber nur traurige Revenants sind und nicht einmal das eigentümliche Scheinleben der früheren Romantik haben.
Unerwartet jedoch trat er 1839 mit einer im Verhältnis zu dieser Umgebung allerliebsten Novelle hervor, in welcher wir zumal eine seiner spätesten Produktionen zu begrüßen haben: „Des Lebens Überfluss. “Folgt im 3. Bande. Ein schonungslos strenges Kunsturteil mag freilich auch von dieser sagen: „sie sei eben abermals mit der bekannten geschwätzigen Altklugheit behaftet; das reizende Motiv in allerlei säuerlicher Zutat verkocht; die Menschen unreal, wie er denn so selten ein lebendiges Wesen auf zwei gesunde Beine zu stellen vermocht habe“ : allein wenn man mit solchem Maße messen wollte, so müsste man das Unerhörte begehen, aus einer Novellensammlung, die zwar nicht unter literargeschichtlichen Gesichtspunkten angelegt, aber doch auf unsere Literaturgrößen möglichste Rücksicht zu nehmen verpflichtet ist, einen Tieck, und dazu den Vater der modernen Novelle, völlig auszuschließen. Lassen wir uns daher durch keine Schattenseite den unverwüstlichen liebenswürdigen Humor dieser Novelle verderben, zu dessen Empfehlung nichts weiter beizufügen nötig ist.
Das aber möchte noch hervorzuheben sein, dass er, der einst das Wesen der Novelle so scharf definiert hatte, gegen das Ende seines Lebens den merkwürdigen Ausspruch tut: „Es ist nicht leicht zu sagen, was eigentlich die Novelle sei, und wie sie sich von den verwandten Gattungen, Roman und Erzählung, unterscheide. — Es ist sehr schwer, hier einen allgemeinen Begriff zu finden, auf den sich alle Erscheinungen dieser Art zurückbringen ließen.“
K.
***