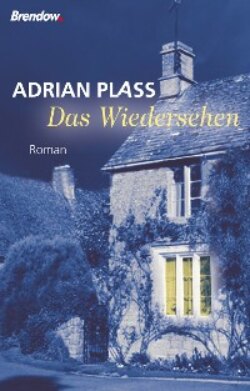Читать книгу Das Wiedersehen - Adrian Plass - Страница 5
Erster Teil Verlust
ОглавлениеIch scheine aufzuwachen.
Mein Schlafzimmer ist dunkel, das Rechteck meines vorhanglosen Fensters nur um eine winzige Graustufe weniger schwarz. Ich liege auf dem Rücken und verharre in dieser Stellung wie gelähmt, die Augen weit aufgerissen und hin und her zuckend, während ich gebannt lausche. Mein ängstliches Bestreben ist es, mich der Abwesenheit von Geräuschen zu vergewissern, die in einem sicheren, geschützten Haus bei Nacht fehl am Platze wären. Das lauteste Geräusch ist mein eigenes panisches Atmen. Außerdem bilde ich mir ein, mein Herz pochen und gegen meinen Brustkorb hämmern zu hören. Es ist, als hätte ich in jenem entscheidenden Augenblick vor dem Aufwachen einen überwältigenden, niederschmetternden Schock erlitten.
Ich weiß es noch! Natürlich weiß ich es noch.
Der Lärm, der meinen Schlaf aufstörte, war ein donnerndes Klopfen und Krachen oben und unten an meiner Schlafzimmertür, ein Hagel von Schlägen, der mich mit brutal zerrender Plötzlichkeit ins Bewusstsein katapultierte.
Aber - und das ist die entscheidende Frage - dieses wilde Klopfen, war das in meinem Schlaf? War es der letzte Moment oder der Höhepunkt eines Traums? Das ist möglich. Ich habe so etwas schon erlebt.
Oder nicht?
Konnte es sein, dass tatsächlich in diesem Moment eine oder mehrere Personen vor meiner Tür standen und warteten, dass ich aus der Geborgenheit meines Bettes aufstand, um die Ursache dieses unerklärlichen Ansturms zu ergründen?
Nein, das ist ein dummer, unlogischer Gedanke. Selbst wenn einer oder mehrere Männer irgendwie das Schloss einer Tür zu meinem Haus aufgebrochen und meine Treppe hinaufgestiegen wären, würden sie sich die Mühe machen, mit solch grotesker Heftigkeit gegen meine unverschlossene Schlafzimmertür zu trommeln?
Falls ein Raubüberfall oder Mord ihre Absicht wäre, soll ich etwa ernsthaft glauben, dass sie während der kurzen Reise von der obersten Stufe zu dieser Seite des Treppenabsatzes durch irgendeinen rätselhaften Prozess so von Höflichkeit infiziert wurden, dass sie sich nun verpflichtet fühlen, mich von ihrer Anwesenheit in Kenntnis zu setzen?
Andererseits, sollten sie unbegreiflicherweise aus ganz harmlosen Motiven hier sein, warum kommen sie dann nicht einfach in mein Zimmer und teilen mir mit, welcher Notfall es erforderlich macht, dass sie in mein Haus einbrechen und mich aus dem Schlaf reißen?
Nein, nein, das entsetzliche Klopfen war ein Traum. Es war das Ende eines Albtraums. Ich weiß es genau. Ich bin schon aus vielen Albträumen gefahrlos aufgewacht. Eigentlich aus jedem Albtraum, unter dem ich je gelitten habe. Mein ganzes Leben lang.
Nicht aus jedem.
Aus allen bis auf einen.
Aber aus diesem Albtraum mit dem sinnlosen Klopfen bin ich jedenfalls aufgewacht, und jetzt werde ich weiterschlafen. Genau, so werde ich die Situation handhaben. Ich werde wieder einschlafen. Ich werde die Augen zumachen und einfach wieder eindösen. Und plötzlich wird es Morgen sein.
Ich schließe meine Augen und warte, bis der Schlaf kommt.
Ich warte.
Ich kann nicht schlafen, bis ich diese Tür geöffnet habe. Das geistlose Trommeln und Treten an das hölzerne Türblatt, das mich eben geweckt hat, war mit Sicherheit nichts als ein Albtraum. Doch es bleibt eine Tatsache, dass ich nicht werde schlafen können, bis ich diese Tür aufgemacht habe. Natürlich wird niemand da sein. Es ist niemals jemand da. Aber um meiner inneren Ruhe willen muss ich diese Tür aufmachen und mich mit meinen eigenen Augen vergewissern, dass der Treppenabsatz menschenleer und frei von Eindringlingen ist. Danach wird der Schlaf kommen. Ja, danach werde ich problemlos einschlafen.
Ich schiebe meine Decke zurück. Ich schwinge meine Beine aus dem Bett. Ich stehe auf und taste mich vorsichtig durch die undurchdringliche Schwärze auf die Tür zu. Fast bin ich schon da, als mich ein Schauder der Erkenntnis durchläuft. Wo habe ich eigentlich meinen Kopf? In meinem Schlafzimmer ist es doch nachts nie so dunkel. Die Welt da draußen ist niemals so undurchsichtig, wie sie jetzt erscheint. Und überhaupt ist das Fenster an der falschen Stelle. Ich habe mich geirrt. Das ist gar nicht mein Schlafzimmer. Ich bin gar nicht wach. Ich bin überhaupt nicht aufgewacht. Ich habe geträumt, dass ich schlafe. Dann habe ich geträumt, dass ich aufgewacht bin. Lieber Gott! Ich dachte, ich wäre wach, aber ich bin in einem Albtraum. Und jetzt werde ich von diesem Albtraum vorwärts getrieben. Ich habe keine Wahl mehr, ob ich dieses fremde Zimmer weiter durchqueren oder in das Bett zurückkehren werde, das ich in meiner Naivität für mein eigenes hielt. Ich muss diese Tür aufmachen und mich dem, was immer dahinter sein mag, stellen. Das ist meine unausweichliche Aufgabe. Tränen steigen in mir auf, wenn ich daran denke, was für ein kreischender Abgrund des Wahnsinns wohl auf der anderen Seite warten mag, und ich bin zu Recht wie versteinert. Die Logik des Albtraums ist ebenso eng verschränkt wie die Logik der Tagwelt, aber das eine ist vom anderen so weit entfernt wie die Hoffnung von der Verzweiflung.
Ich bin an der Tür. Es wird nichts da sein. Ich lege meine Hand auf die Klinke. Es wird nichts da sein. Ich drücke die Klinke hinunter. Es wird nichts da sein. Ich ziehe die Tür auf. Oh! Ein Schrei steigt mir in der Kehle auf wie bittere Galle, aber er will nicht heraus. Ich ersticke an meinem Entsetzen. Da ist etwas. Die Umrisse zweier Gestalten zeichnen sich im Türrahmen ab und füllen ihn fast vollständig aus. Die eine ist groß und leicht gebeugt, die andre kleiner. Ich starre sie an, aber ich kann ihre Züge nicht erkennen. Sie sagen kein Wort. Sie rühren sich nicht. Warum in Gottes Namen sagen und tun sie nichts? Es ist, als wüssten sie, dass sie mich durch ihr Schweigen und ihre Reglosigkeit zum spitzesten, höchsten Gipfel dieser kreischenden Spirale der Furcht treiben können.
Mit einer Stimme, die nur von einer dünnen, pergamentartigen Haut der Selbstbeherrschung gehalten wird, sage ich: „Ja, bitte? Kann ich Ihnen helfen? Was wollen Sie?“
Ich kann ihre Münder nicht sehen, aber ich weiß, dass sie jetzt in der Dunkelheit grauenhaft grinsen. Sie amüsieren sich über das kriecherische Entsetzen, das mich dazu bringt, dumme Höflichkeiten zu Leuten zu sagen, die rücksichtslos in mein Haus eingebrochen sind und mit ihren Fäusten und Füßen meine Tür attackiert haben. Sie haben gewonnen. Wieder einmal. Wieder einmal erkenne ich, dass ich bin, was ich bin. Ich bin so angefüllt mit bebender Hysterie, dass ich fürchte, mein Geist wird sich in Nichts auflösen.
Mein einziger Vorteil ist die Gewissheit, dass dies ein Traum ist. Vielleicht habe ich die Wahrheit noch rechtzeitig erkannt. Ich bin nicht wach. Dies ist ein Traum. Ich kann entkommen. Es gibt einen Fluchtweg. Ein Albtraum kann ja schließlich nicht seine eigenen Regeln brechen.
Als die größere Gestalt plötzlich eine leichte Bewegung in meine Richtung macht, schließe ich die Augen und lasse alles, was ich bin, rückwärts in die glatte, weiche Dunkelheit hinter mir fallen. Ich lasse Körper und Geist los und gleite mit steigendem Tempo die lange, steile Neigung einer seltsam erheiternden Fahrt in die Vergessenheit hinab.
Mit einem letzten Rausch der Erregung und der Furcht pralle ich geräuschlos mit der Wirklichkeit zusammen, schwitzend und zitternd, wach in meinem eigenen Bett, mein Herz voll von einem dunklen Gefühl, das viel weniger und viel mehr ist als die Furcht vor einem Albtraum.
Es gibt einen alten Schülerwitz, der da lautet: „Woran erkennt man, wenn ein Elefant im Kühlschrank war?“ Die Antwort: „An den Fußstapfen in der Butter.“
Wenn man jemanden verliert, den man geliebt und mit dem man gelebt hat, dann hat das eine gewisse Parallele zu diesem albernen Witz. Die Person, die die Hälfte des eigenen Daseins ausgemacht hat, ist weg, doch die unendliche Bedeutung ihres Lebens und die elefantenähnliche, jurassische Kreatur namens Tod hinterlassen gemeinsam paradoxerweise winzige Spuren oder Fußstapfen überall im Haus, im Herzen und im Leben. Noch für lange Zeit sind diese Spuren überall zu finden, jeden Tag. Jede neue Entdeckung löst wahrscheinlich einen frischen Trauerschub aus.
Manche davon sind tatsächlich im Kühlschrank. Im untersten Fach steht noch ein Karton Magermilch, ein kleiner Aspekt ihres Plans, vor unserem geplanten Sommerurlaub in der Sonne noch ein paar Pfunde loszuwerden. Sie kaufte ihn am Morgen des Tages, bevor sie krank wurde. Ich hätte den Karton schon vor langer Zeit entsorgen sollen, aber der Mülleimer neben meiner Hintertür ist irgendwie nicht groß oder angemessen genug, um die Implikationen einer solchen Maßnahme fassen zu können.
Oben auf dem Tisch neben ihrer Bettseite lagert ein Haufen Bücher, die sie verschlang, in denen sie blätterte, die sie noch zu lesen hoffte. Eines davon handelt von Schwangerschaft und Geburt. Dies hätte das Jahr sein sollen …
Neben den Büchern steht ein Glas, fast ganz mit Wasser gefüllt.
Die Bücher gehören eigentlich längst wieder zurück ins Regal, aber ihre genaue Anordnung auf dem Nachttisch, das Durcheinander, das sie bilden, ist ein einzigartiges Werk ihrer Hände, ihrer Aufmerksamkeit und Unaufmerksamkeit, und dieses Werk wird für immer verloren sein, sobald sie weggeräumt werden.
Ihre Lippen waren noch warm, als sie die kalte, harte Glätte jenes Glases berührten. Die darin verbliebene Wassermenge ist genau durch das Ausmaß ihres Durstes bestimmt.
Sie hat jetzt keine Wahl, als Genauigkeit und Ungenauigkeit aufzugeben.
Diese winzigen Museen persönlicher Zufälligkeiten sind alles, was mir geblieben ist.
Wie oft und auf wie viele Arten muss man eigentlich Abschied nehmen? Ich bejahe und bejahe und bejahe und bejahe den Tod der Person, die ich liebe, und doch erwacht sie immer noch als Phantom zum Leben und verblasst wieder in den Tod, wann immer ich auf so etwas Gewöhnliches stoße wie eine angebrochene Müslipackung, eine Tube Schuhcreme mit der falschen Farbe, eine alte einarmige Lesebrille in einer Schublade, CDs, die ich ohne sie nie schätzen gelernt hätte, die Bibel, die nicht meine ist, ihre tausend Seiten bedeckt mit Markierungen, die über ein Jahrzehnt hinweg ausgesät wurden, nun aber ihre Ernte an einem anderen Ort getragen haben, ihre Nähkiste, gefüllt mit „allem möglichen Krimskrams, den ich vielleicht mal gebrauchen kann“, vertraute Kritzeleien auf dem Notizblock neben dem Telefon und, versteckt hinter den Mänteln und Jacken in der Diele, ein breiter, dunkelblauer Wollschal, der, wenn ich mein Gesicht darin vergrabe, immer noch nach ihr riecht.
Irgendwann habe ich dann solche Dinge wie den Milchkarton doch entsorgt. Klar. Es bestand nie die ernsthafte Gefahr, dass ich in eine Art Dickensschen Aufbewahrungswahn verfallen würde. Die Bücher kehrten an ihre richtige Position in den Regalen zurück. Das Wasser goss ich weg, und die unsichtbaren Abdrücke von Jessicas Lippen und Fingern spülte ich von dem Glas ab. Es dauerte ungefähr eine halbe Minute und bedeutete mir unmittelbar danach erst einmal gar nichts. Ich bemerkte, wie das Glas glänzte und funkelte, als ich es zu den anderen auf das oberste Regalbrett über dem Spülbecken stellte. Schließlich war es ja nur ein Glas. Morgen würde ich schon nicht mehr erkennen können, welches der sechs Gläser aus dem Satz dasjenige gewesen war, aus dem meine Frau ihren letzten Trunk in ihrem eigenen Haus genossen hatte.
Nach den ersten, qualvollen Tagen entwickelte ich sogar ein gewisses Geschick darin, aufzuräumen und auszusortieren und derartige Dinge zu regeln, sobald ich sie entdeckte, wenn auch manchmal unter Zähneknirschen oder mit einem kleinen Aufschluchzen, durch das sich der Überdruck der ständigen Trauer ein Ventil verschaffte.
Das Problem war, dass es nie ganz aufzuhören schien. Monate nach Jessicas Tod musste ich immer noch mit nicht mehr so häufigen, aber genauso unerwarteten Erinnerungen an ihr Leben und ihren Tod fertig werden. Manche davon wurden mir vom Briefträger ins Haus gebracht, einem jungen Mann mit glänzenden, stacheligen Haaren und ziegelrotem Gesicht, der jeden Tag pfeifend durch unseren Vorgarten kam, als ob auf eine seltsame Weise die Welt nicht aufgehört hätte, sich zu drehen. Er brachte Briefe für Jessica. Sie enthielten wichtige Mitteilungen über ihr Handy, ihre Bücher aus der Stadtbücherei oder die Blumenzwiebeln, die sie doch bitte bestellen möge, um sie im Herbst einzupflanzen, über die Kreditsumme, die ihr auf ihrer British Home Stores Card zur Verfügung stand, oder über die Tatsache, dass sie so nahe daran gewesen war, achtzigtausend Pfund in einem Zeitschriften-Preisausschreiben zu gewinnen, dass es eigentlich nur noch eine Formalität war, den beiliegenden Abschnitt einzusenden und ein Jahresabonnement für die fragliche Zeitschrift zu bestellen. Ich beantwortete diejenigen, bei denen das notwendig war, und warf den Rest weg.
Hin und wieder kamen ahnungslose, fröhliche Lebenszeichen von Freunden oder Bekannten aus der Vergangenheit, die nicht wussten, was mit Jessica passiert war. Ich beantwortete sie so kurz, wie es die Höflichkeit erlaubte, und versuchte so wenig Zeit wie möglich mit den Kondolenzbriefen zu verbringen, die ich postwendend zurückerhielt.
Eines Sommerabends, auf den Tag genau sechs Monate, nachdem ich mich herabgebeugt hatte, um zum letzten Mal die kalten Lippen meiner Frau zu küssen, landete ein Brief, der in Gloucester abgestempelt war, auf meiner Türmatte. Wie sich herausstellte, kam er von einer der ältesten Freundinnen von Jessica, aber er war nicht für sie. Er war an mich adressiert.
Lieber David,
ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich, wo doch jetzt so viele Leute in der Gemeinde wissen, wer du bist, und ich hoffe, es macht dir nichts aus, dich durch diesen Brief hindurchzukämpfen, denn er wird wahrscheinlich ziemlich lang. Mein Ehename (inzwischen lebe ich von meinem Mann getrennt) ist Angela Steadman, aber als wir uns kannten, hieß ich noch Angela Brook. So nenne ich mich jetzt auch wieder, seit ich wieder allein lebe.
Vor vielen Jahren, als wir alle in St. Mark's zur Kirche gingen, gehörte ich zur selben Jugendgruppe wie du. Somit bin ich jetzt Mitte, Ende dreißig, wie du wahrscheinlich auch. Ich war immer viel mit deiner Jessica zusammen, die während der Schulzeit meine beste Freundin war, und mit einem pummeligen Mädchen mit krausen Haaren, das Laura Pavey hieß. Ich war blond, mit hohen Wangenknochen und einem trotteligen Lächeln, hatte im Winter immer bunte Pullis an und war ein bisschen herrschsüchtig und redete zu viel. Reicht dir das, um darauf zu kommen, wer ich bin? Bei den meisten Leuten klickt es, wenn sie „herrschsüchtig“ hören.
Wir kannten uns nur für relativ kurze Zeit, bevor du und Jessica miteinander gingt, aber wir haben eine ganze Menge gemeinsam unternommen. Anständiger Kaffee bei Lauras Eltern zu Hause um die Ecke in der Clifton Road nach der Jugendgruppe, um den Geschmack von diesem dünnen, ranzigen Kirchenkaffee loszuwerden; so mancher Samstagvormittag bei Wilson's, dem Caf oberhalb der Treppe gegenüber vom Bahnhof, wo sich immer alles traf, um herauszufinden, ob irgendwo eine Party stieg. Wir teilten uns zu fünft oder zu sechst zwei Becher Kaffee - wenn wir Glück hatten! Eben fällt mir ein, dass wir irgendwann auch alle zusammen zu einer Wochenendfreizeit fuhren, zu irgendeiner Schule oder so etwas Ähnlichem unten im Süden. Fällt es dir jetzt wieder ein? Das sind für mich alles sehr schöne Erinnerungen.
Jedenfalls, wie du weißt, haben Jessica und ich im Lauf der Jahre den Kontakt zueinander verloren, aber ich mochte meine Freundin sehr und habe sie nie vergessen. Ich habe mir immer gesagt, eines Tages raffe ich mich auf und treffe mich mit ihr, und mit dir natürlich auch, und dann lassen wir uns nach Herzenslust über die alten Zeiten aus. Na ja, man sollte eben solche Dinge wirklich anpacken, anstatt nur darüber zu reden, nicht wahr? Ich weiß, es ist nichts im Vergleich zu dem, was du jetzt empfinden musst, aber mich erfüllt eine schreckliche, trostlose Traurigkeit, wenn ich daran denke, dass es jetzt zu spät ist. Allerdings gibt es eine letzte Sache, die ich noch für Jessica tun kann, und das ist der Grund, warum ich dir schreibe.
David, was ich dir jetzt mitteilen werde, wird dich vielleicht sehr überraschen. Jessica hat mir nur einen oder zwei Tage vor ihrem Tod einen ziemlich langen Brief geschrieben. Darin erzählte sie mir, was mit ihr geschehen war, wie plötzlich das alles gekommen war und wie ernst die Prognose aussah. Sie wusste offenbar sehr gut, dass sie nur noch ganz kurze Zeit zu leben hatte. Das ist bei den meisten Leuten so, zumindest meiner Erfahrung nach. Als ich das las, wollte ich natürlich sofort in den Wagen springen und losfahren, um so schnell wie möglich an ihr Krankenbett zu kommen, und das hätte ich auch getan, wenn sie mich nicht ausdrücklich darum gebeten hätte, es nicht zu tun. Sie wollte, dass ich warte, bis ein paar Monate vergangen sind, und dir dann schreibe. Jetzt tue ich, worum sie mich gebeten hat.
Jessica hat mir etwas geschickt, das ich dir geben soll, David, und als ich ganz kurz mit ihr im Krankenhaus telefonieren konnte, bestand sie darauf, dass ich verantwortlich entscheiden müsse, wie und wann das geschehen sollte. Ich war ein bisschen verdattert, wie du dir vorstellen kannst. So etwas ist mir bisher noch nicht passiert, und auch sonst niemandem, den ich kenne. Aber eines ist sicher: Ich werde mich durch niemanden davon abhalten lassen, es richtig zu machen - Jessica zuliebe.
Bevor ich dir sage, was ich beschlossen habe, finde ich es angebracht, dir kurz zu erzählen, was sich bei mir in den Jahren, seit wir uns zuletzt gesehen haben, so alles getan hat. Was bei dir los war, wissen wir natürlich alle. Ich habe es nie geschafft, zu einer deiner Veranstaltungen zu kommen, aber wie ich höre, sind sie sehr eindrucksvoll und hilfreich und so. Ich dagegen lebe glücklich und unerkannt - na ja, jedenfalls unerkannt.
Ich glaube, du weißt wahrscheinlich, oder wusstest zumindest, aber ich mache dir nicht den geringsten Vorwurf, falls du es vergessen hast, bin ich damals nach Bristol gegangen, um Kunst und Geschichte zu studieren - ich fand es herrlich. Danach habe ich ein bisschen herumgejobbt, bis ich schließlich eine sehr schöne, sehr schlecht bezahlte Stelle in einer Galerie in Cambridge fand. Dort bin ich zum ersten Mal meinem Mann Alan begegnet. Er hatte eines Tages geschäftlich in Cambridge zu tun und suchte in unserer Galerie Zuflucht vor dem Regen. Dieser verdammte Regen! Er brachte das Glück und das Unglück in einem Guss. Um diese lange Geschichte abzukürzen, da dieser Alan ein gut aussehender, unabhängig denkender, charmanter Bursche war, verstanden wir uns prächtig, tauschten unsere Telefonnummern aus, blieben nach dieser ersten Begegnung in Kontakt und fingen an, uns regelmäßig zu treffen. Und der Gipfel war, er war auch noch Christ! Unglaublich! Ich konnte mein Glück nicht fassen. Etwa sechs Monate später verlobten wir uns und im darauf folgenden Herbst wurden wir in York getraut, wo mein Vater nach dem Tod meiner Mutter hingezogen war. Alles schien perfekt zu sein. Wir beteten zusammen, wir lachten zusammen über die gleichen Dinge, wir teilten unsere Träume von der Zukunft miteinander.
Einer unserer häufigsten Träume war es, ein großes, verfallenes altes Anwesen auf dem Land zu finden, es herzurichten und irgendwie Geld damit zu verdienen. Ein paar Jahre später, nachdem wir beide unsere Eltern verloren hatten, war genug Geld vorhanden, um ernsthaft über eine Verwirklichung nachzudenken. Nun, um diese noch längere Geschichte abzukürzen, nach einer langen, genussvollen Suche kreuz und quer im ganzen Land - eine herrliche Zeit - fanden wir etwas. Es war ein uraltes Haus, und wenn ich uralt sage, dann meine ich es auch so. Im Keller gab es noch Steine, die aus der Römerzeit stammten, und seither schien so ziemlich in jedem Jahrhundert irgendjemand dem Gebäude etwas hinzugefügt zu haben. Und was dem Ganzen noch zusätzliche Würze gab, das Haus stand in dem wohl dokumentierten Ruf, eines der gruseligsten Spukhäuser Englands zu sein! Und, spukt es wirklich dort, höre ich dich fragen? Darüber erzähle ich dir mehr, wenn/falls ich dich sehe.
Wir kauften es. Es war in einem verheerenden Zustand, aber wir kauften es. Wir dachten, wenn wir es erst einmal in Ordnung gebracht und auf den Flohmärkten ein paar authentische Möbel gefunden hatten, die wir in die Zimmer stellen konnten, dann könnten wir von den Leuten Geld für den Eintritt und die Besichtigung verlangen. Es war mächtig aufregend und machte uns einen Riesenspaß. Wir hatten da so eine dynamische junge Frau namens Karen, die jeden Tag aus dem Dorf kam, um uns zu helfen, und innerhalb von zwei oder drei Monaten lief die Sache wie am Schnürchen. Es war ein unglaubliches Erlebnis, die ersten zahlenden Kunden durch die Tür treten zu sehen. Zu tun gab es am Haus immer noch reichlich, aber wir dachten uns, das könnten wir im Lauf der Zeit noch nachholen, je nachdem, wie wir mit dem Geld hinkamen. Karen war uns eine großartige Hilfe. Sie war praktisch, vielseitig, flott und alles andere, was man an Unterstützung braucht, wenn man sich an ein Unternehmen gewagt hat, das hin und wieder einfach über die eigenen Kräfte geht. Und wir verstanden uns prächtig mit ihr. Wir waren ein tolles Team, Karen und ich, wirklich. Wie Schwestern. Und diese herrliche Zeit dauerte bis zu dem Moment, wo sie und mein Mann eines kalten Morgens wie unzufriedene Dienstboten am Küchentisch standen und mir, die ich noch halb schlafend mit verquollenen Augen dasaß, erklärten, sie hätten sich ineinander verliebt und würden zusammen weggehen. Alan war noch so freundlich, mir zu erläutern, er brauche eine „weiblichere und anpassungsfähigere“ Partnerin, jemanden, der nicht das Bedürfnis habe, ihn dauernd zu beherrschen.
Ich will jetzt nichts weiter darüber sagen. Mein ganzes Dasein gerät dabei aus den Fugen. Ich kann kaum diese Worte schreiben, ohne irgendetwas zu zerschlagen.
Ich bin immer noch hier in diesem Haus und versuche, es als Geschäft zu betreiben.
Nun gut! So weit zu mir. Was ich dir vorschlagen möchte, ist Folgendes. Ich würde gern an einem Wochenende ein Wiedersehenstreffen hier im Haus organisieren, und ich möchte sehr gerne, dass du dabei bist. Wahrscheinlich wird es von Freitagabend bis Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag dauern. Ich habe noch ein paar Adressen und Telefonnummern aus alten Zeiten, aber du weißt ja, wie das ist. Immer sind die Leute so egoistisch zu heiraten und umzuziehen und auszuwandern und so, ohne jede Rücksicht auf Leute, die versuchen Wiedersehenstreffen zu organisieren. Ich habe es auf sieben oder acht von den Leuten abgesehen, an die du und ich uns vielleicht am besten erinnern, und wir werden ja sehen, wie es klappt. Ich habe gehört, solche Sachen können ziemlich übel enden, wenn sie nicht gut geplant sind, und deshalb möchte ich zumindest ein grobes Programm festlegen, damit wenigstens die Aussicht besteht, dass das Wochenende für alle, die kommen, irgendwie nützlich oder wenigstens angenehm wird. Ich hoffe, der Gedanke an die Geister schreckt die Leute nicht ab! Aber ich nehme an, die Tatsache, dass jeder einen kleinen Unkostenbeitrag leisten muss, wird sie viel mehr abschrecken!
So weit, so gut. Ich habe eine Liste der möglichen Termine beigelegt. Ich vermute, dein Terminkalender ist immer gut gefüllt - inzwischen wirst du wohl wieder zu Vorträgen unterwegs sein -, also je eher du antwortest, desto eher kann ich die Sache mit den anderen ausmachen. Falls du zu keinem der Termine kommen kannst oder willst und auch keine Alternativen vorschlägst, lasse ich die Sache ganz ausfallen. Dann allerdings wirst du das, was ich dir weitergeben soll, nicht bekommen. Das wäre nicht gut, denn wir werden beide eines Tages wieder Jessica gegenübertreten müssen. Sie war sehr lieb, aber was für ein Temperament! Im Ernst, auch wenn du nicht die geringste Lust dazu hast, bitte, mach mit. Ruf an, schreib, stell mir jede Frage, die du stellen willst, aber mach mit!
Weitere Einzelheiten, wenn du antwortest.
Liebe Grüße und viel Segen (wenn es welchen gibt) Angela (Brook)
Ich las Angelas Brief einmal in der sauberen, aufgeräumten Küche, während meine eine, lebenserhaltende Scheibe Toast kalt wurde. Dann ging ich damit in das staubige, aber noch aufgeräumtere Wohnzimmer und setzte mich, eingehüllt in das Licht der Morgensonne, an den kleinen runden Tisch am Fenster und las ihn noch einmal.
Seit Jessicas Tod hatte ich die meisten Zimmer in meinem Haus kaum benutzt. Sie und ich, wir hatten uns so viel Zeit genommen, so viel Mühe aufgewendet und so viel Freude daran gehabt, es in ein Zuhause zu verwandeln, das zu Leuten von unserer Art und zu dem Leben, das wir uns mit solcher Begeisterung aufbauten, passte. Schlafen, Essen und Waschen waren die einzigen Bereiche, in denen sich die praktischen Bedürfnisse regelmäßig gegen meine Trübsal durchsetzten. Ich brachte mein Leben größtenteils im Schlafzimmer, in der Küche und im Bad zu. Ins Wohnzimmer kam ich nur, um Jessicas geliebte Pflanzen zu gießen. Mir kam es kalt und fremd darin vor. Am Wochenende nach dem Tag, an dem ich die grauenhaft vernünftige Entscheidung getroffen hatte, all die zufälligen kleinen Indizien zu beseitigen, die bewiesen, dass meine Frau existiert hatte, hatte ich jede Minute damit verbracht, das ganze Haus mit verbissener Gründlichkeit zu schrubben und aufzuräumen. Diese wilde Entschlossenheit entstammte vermutlich einem Bedürfnis, mir jede Ablenkung von der alles verzehrenden Aufgabe, meine Trauer zu fühlen und zu durchdenken und durchzukauen, aus dem Blickfeld zu schaffen.
Das Wohnzimmer nahm ich mir besonders gründlich vor. Mir kam es so vor, dass in diesem Raum von nun an kaum noch Leben stattfinden würde. Dies war der Ort, wo wir gelebt und alles Mögliche getan hatten - wo wir uns entspannt, wo wir gegessen, geschmollt, uns geliebt, gestritten, gebetet, Briefe geschrieben, ferngesehen hatten. Eine ganze Menge dieser Dinge hatten auf dem langen, hochlehnigen, weinroten Sofa stattgefunden, das wir voller Begeisterung in Brighton zu einem drastisch reduzierten Preis hatten kaufen können, weil es ein Ausstellungsstück war. Allein dieses Möbelstück war mit Erinnerungen übersät, manche fast vergessen, aber nicht weniger kostbar, die wie verlorene Münzen in den Ritzen zwischen den Polstern steckten. Ich hatte es seit der Beerdigung noch nicht ein einziges Mal über mich gebracht, mich auf dieses Sofa zu setzen.
An jenem trostlosen Tag war das Sofa und jede andere ins Wohnzimmer gehörende oder dorthin importierte Sitzgelegenheit mit Leuten besetzt gewesen, die Teller mit Häppchen und Gläser in den Händen hatten und die ihr der Situation angemessenes Verhalten mit demselben Unbehagen trugen wie ihre der Situation angemessene Kleidung. Die meisten waren traurig, aber zweifellos auch froh, dass sie selbst und ihre Lieben noch am Leben waren. Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum es Beerdigungen gibt. Einer oder zwei waren vielleicht darunter, die selbst erst kürzlich ihre Partner verloren hatten und alle Anstrengung aufbieten mussten, um den ohrenbetäubenden Widerhall ihres eigenen Verlustes zu überleben. Für mich war es das Schlimmste, wenn ich die Blicke auffing, die diese Leute in meine Richtung warfen. Sie wussten Bescheid. Sie waren selbst da unten. Sie waren immer noch da unten an jenem kalten, finsteren Ort, wo der Wind heult und die Trostlosigkeit regiert und wohin niemand kommt.
„Wir wissen genau, wie entsetzlich und unerträglich das hier alles ist“, sagten ihre schmerzerfüllten Augen zu mir, „und wir wissen, dass der Boden unter deinen Füßen sich in eine hauchdünne Eisschicht verwandelt hat. Ein unachtsamer, zu schwerer Schritt in die falsche Richtung, und du stürzt in ein so eisiges Chaos der Verzweiflung, dass du fast vergisst, wie du deine Lungen mit dem warmen Atem des Lebens füllen kannst.“
Viel leichter fiel es mir, mit den Gästen umzugehen, die mir auf konventionellere Weise ihr Beileid aussprachen. Diese gut gemeinten Bekundungen brauchten gar nicht sehr viel zu bedeuten. Sie brauchten nur aus jenem Kleingeld der Konversation zu bestehen, das man sich bequem mit ein paar netten Dankesworten in die Tasche stecken konnte:
„Wann immer du etwas brauchst - du weißt ja. Scheu dich nicht … “
„Es muss eine große Erleichterung sein zu wissen, dass sie gläubig war. Zumindest geht es ihr jetzt gut, auch wenn man das von uns nicht sagen kann … “
„Wir beten für dich … “
Jessicas einzige noch lebende Verwandte, die kleine, pummelige Tante Vera mit ihren Puddingarmen und ihrem Hefeteiggesicht, war bei Weitem die Beste. Sie machte stapelweise Sandwiches, schnitt Torten, spülte Geschirr, kochte Tee und machte die ganze Zeit ein mürrisches Gesicht, aber sie klopfte mir jedes Mal, wenn sie an mir vorbeikam, ganz leicht auf den Arm und sprach den ganzen Tag über kaum ein Wort. Ich kam den Tränen am nächsten, als ich mich an jenem Abend bei ihr bedankte und sie verabschiedete.
Ein Ende der Fenstersitzbank, auf die ich mich mit Angelas Brief gesetzt hatte, war für das reserviert gewesen - war es immer noch -, was ich scherzhaft und liebevoll „Jessicas Müll“ genannt hatte.
Meine Frau war, solange ich sie kannte, fasziniert von alten Gegenständen gewesen. Was ihr besonderen Spaß machte, war der Gedanke, dass es ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände gab, die es irgendwie geschafft hatten, bis in eine Zeit zu überleben, in der sie längst zu nichts mehr nütze waren. Hin und wieder durchstöberte sie Wohltätigkeitsbasare und Antiquitätenmärkte in der Hoffnung, irgendwelche billigen Dinge zu entdecken, die sie ihrer Sammlung hinzufügen könnte. Zu ihren persönlichen Lieblingsstücken gehörte eine flache, rechteckige Schachtel, eingefasst mit Lederintarsien und gefüttert mit blauer Seide, die einst von einer Dame dazu benutzt worden war, ihr Gebetbuch elegant in die Kirche und wieder nach Hause zu transportieren, ein höchst stilvolles Paar viktorianischer Schlittschuhe und eine kleine Holzkiste, ausgefüllt mit einem faszinierenden Gewirr von kleinen Fächern und Zwischenwänden, deren Funktion wir nie hatten ermitteln können. Den Ehrenplatz bekam ein Picknickset aus den zwanziger Jahren, immer noch im Originalkorb und in ausgezeichnetem Zustand. Jessica liebte es, die kleine viereckige Porzellanteekanne und das dazu passende Service aus geblümten Tellern, Tassen und Untertassen herauszunehmen, die winzige Spirituslampe, die Blechdosen für Kuchen und Sandwiches oder Hähnchenschenkel, die frühen Bakelit-Becher und die Messer mit den Porzellangriffen, die immer noch in den Original-Papierhüllen steckten und deren Stahlklingen schimmerten, als wären sie gestern erst hergestellt und gekauft worden. Dazu hatte sie eine Straßenkarte von Großbritannien aus derselben Epoche aufgetrieben, eigens herausgegeben für jene neue Gattung von Leuten, die sich „Automobilisten“ nannten, und einen jener dicken Wälzer mit Schulgeschichten, auf dessen Umschlag ein höchst unwahrscheinlicher Vorfall mit drei Schuljungen und einem Elefanten abgebildet war. Diese Werke standen an den offenen Deckel des Picknickkorbes gelehnt. Vor achtzig Jahren hätten wir vermutlich den Korb hinten auf den Gepäckträger unseres Oldtimers geschnallt, uns eine Decke über die Knie gelegt und wären losgetuckert, um uns einen gemütlichen Tag auf dem Land zu machen.
Soweit mir bewusst war, stellte Jessicas Sammlung keinen großen finanziellen Wert dar, obwohl das Picknickset relativ teuer gewesen war.
Eine lebendige Erinnerung.
An einem späten Nachmittag war sie mit einem braunen, stoffbespannten Koffer und ungewöhnlich schuldbewusstem Gesicht nach Hause gekommen. Sie habe etwas gesehen, als sie an dem Second-Hand-Shop weiter oben in der Straße vorbeigekommen sei, erklärte sie mir, noch bevor sie ihre Jacke auszog, und sie habe sich spontan entschlossen, es zu kaufen, weil sie so eine Gelegenheit vermutlich nie wieder bekommen würde, ganz bestimmt nicht in einem solchen Zustand, und sie hoffe, ich würde sie nicht für komplett verrückt erklären, weil sie achtzig Pfund dafür ausgegeben habe, aber das würde ich auch bestimmt nicht, wenn ich es erst gesehen hätte, so bezaubernd sei es, und schau doch, sie würde es einfach aufmachen, da sei es, ich solle bitte nicht wütend sein, sie habe einfach nicht anders gekonnt, und wir, das hieß sie, könnten doch alle möglichen Dinge einsparen, um die Ausgabe wieder wettzumachen, und wie fände ich es?
Ungeachtet der negativeren Manifestationen eines solchen plötzlichen Wahnsinns hat es etwas unwiderstehlich Pikantes, wenn ein Ehepartner von seinen lebenslangen Gewohnheiten abweicht und dann um Verzeihung dafür bittet. Jessica war nie verschwenderisch mit Geld umgegangen, schon gar nicht für sich selbst, auch nicht auf der Jagd nach ihrem „Müll“, und ich fand es eigentümlich charmant, dass sie sich diesmal dazu hatte hinreißen lassen. Außerdem blieb mir gar nichts anderes übrig, als ihr von ganzem Herzen zuzustimmen. Das Picknickset war exquisit.
Ich musste meinen Blick von der Ecke abwenden, in der diese Dinge immer noch sorgfältig aufgebaut standen. Sie hatte sie so sehr geliebt. Komm zu mir zurück, Jessica. Komm nur zurück, hör auf mit diesem blöden Gesterbe, und du darfst das ganze Haus mit deinem Müll füllen, du darfst jeden Penny, den wir haben, für Sachen ausgeben, die dir Freude machen. Ich würde alles geben für nur noch eine Woche voller ganz gewöhnlicher Tage mit dir, mein Liebling.
Angelas Brief.
Ich las ihn noch einmal durch, diesmal sorgfältiger. Warum war ich mit diesen Blättern ausgerechnet ins Wohnzimmer gegangen? Weil sie ein unerwartetes, offenes Fragezeichen in meinem Leben aufwarfen? Etwas, das mit Jessica zu tun hatte? Ja. Etwas, das mit Jessica zu tun hatte und noch nicht verarbeitet und erledigt war. Etwas, das Jessica mir zukommen lassen wollte. Etwas, das mir noch nicht gegeben worden war. Es war, als käme ich in die Hitze, nachdem ich eingefroren war. Winzige Tentakeln der Wärme krochen fast schmerzhaft durch die kalten Adern meines Verlustes. Es gab noch etwas zu tun. Noch etwas zu leben. Dies war das Zimmer, wo etwas Derartiges passenderweise geschehen oder zumindest beginnen konnte.
Ich musste lächeln, als ich den ersten Teil des Briefes zum dritten Mal las. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass irgendjemand, der Angela so wie ich im Alter von sechzehn oder siebzehn kennen gelernt hatte, sie je wieder vergessen würde. Jenes „trottelige“ Lächeln war in der Lage gewesen, jedes männliche Wesen in Sichtweite in eine geleeartige Masse einfältiger Verehrung zu verwandeln. Die Wattzahl war unglaublich. Mit ihrem natürlich honigblonden Haar, ihren elektrisierend blauen Augen und ihrem breiten, üppigen Mund hatte Angela diesen sehr attraktiven, leicht angeschlagenen Zug um ihre hohen Wangenknochen, mit dem manche Mädchen gesegnet sind. Dazu kam, dass sie schon mit sechzehn eine Figur wie aus einem köstlichen Traum hatte - jedenfalls war sie in so manchem meiner Träume vorgekommen. Sie war schön, stark, immer freundlich und teilnahmsvoll, und sie strahlte etwas aus, was schwächlichen Jünglingen wie mir die Knie weich werden ließ. Ich hatte sie als selbstbewusst und kompetent in Erinnerung, nicht als herrschsüchtig. Alles in allem jedoch war die Mischung ihrer Eigenschaften für die meisten Jungs in ihrem Alter, auch für mich, viel zu furchteinflößend gewesen. Jedenfalls, so sehr ich Angela mit diversen bedeutenden Teilen meines jugendlichen Wesens schätzte, war ich bis über beide Ohren verliebt in ihre beste Freundin Jessica, ein schönes, dunkles Juwel von einem Mädchen, das schon bald nach unserer ersten Begegnung die ganze Aufmerksamkeit meiner Gedanken wie auch meines Körpers einnahm.
Ich blickte von der Briefseite auf und starrte hinaus über den Rasen vor meinem Haus. In der Ferne, gerade noch sichtbar über den dicht geschlossenen Reihen der Bungalows, die sich vom Fuß des sanften Hanges, der dreißig Meter von meinem Gartentor entfernt begann, in drei verschiedene Richtungen erstreckten, sah ich die Kuppen der Hügel, auf denen Jessica und ich so gerne gewandert waren. Es erschien mir unwahrscheinlich, dass ich je wieder dort unterwegs sein würde. Warum sollte ich? Wie könnte ich Freude daran haben? Ich würde doch nur die ganze Zeit nach ihr suchen, so wie ich in der Woche nach ihrem Tod nach ihr gesucht hatte.
Aber jetzt dieser Brief von Angela …
Ich musste irgendwo anders hin, um darüber nachzudenken. Aber wohin? Ich traf eine Entscheidung. Ich faltete den Brief zusammen, legte ihn zurück in den Umschlag und steckte ihn in meine Hosentasche. Dann ging ich in die Küche, schnappte mir den Schlüssel zur Gartenhütte vom Haken und ging durch die Hintertür hinaus. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich mein Fahrrad aus dem Gartengerümpel in der Hütte ausgegraben hatte. Ich hatte seit Monaten nicht mehr darauf gesessen. Eine schnelle Überprüfung: Reifen okay. Bremsen okay.
Augenblicke später radelte ich auf den Mini-Verkehrskreisel am Ende unserer Straße zu. Ich wusste genau, wo ich jetzt hinmusste.
Der Morgen nach dem Tag, als Jessica starb, war warm und trüb gewesen, der schiefergraue Himmel voller schwerer Regenwolken. Ich hatte mein Haus verlassen und war in den Wagen gestiegen, benommen vor Schock und Schlafmangel, um zielsicher, wenn auch ohne jeden bewussten Plan, in Richtung Grafton House zu fahren, eines etwa drei Meilen entfernten, großen christlichen Tagungszentrums.
Grafton House stand, uralt und von Efeu überwuchert, mitten in der Landschaft am Ende einer langen, verschlungenen, von Bäumen gesäumten Straße. Da man sich auf solche geistlichen Dienste wie das Austreiben von Dämonen und die Heilung negativer Erinnerungen spezialisierte, wurde diese Einrichtung von vielen Leuten, die in der Umgebung wohnten, mit großem Argwohn beäugt. Manche von ihnen, hauptsächlich solche, die nie selbst dort gewesen waren, sahen in dem alten Herrensitz eine Variante von Schloss Dracula oder vielleicht auch Bates' Motel. Kirchenferne Ortsansässige, die durch meine gelegentlichen Auftritte im Radio oder im Fernsehen eine ungefähre Vorstellung davon hatten, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiente, horchten mich gelegentlich bei einem Glas Bier darüber aus, was genau dort eigentlich vor sich ging. Da ich jemand war, der in der Gegend herumreiste und den Leuten etwas über das Christentum erzählte, hielten sie es für selbstverständlich, dass ich über die Philosophie dieses Zentrums einigermaßen Bescheid wusste und dass ich, da ich selbst Christ war, vermutlich eine gewisse Sympathie für die seltsamen Methoden hegen musste, die dort offenbar angewendet wurden. Mir waren solche Gespräche unangenehm. Sicherlich glaubte ich daran, dass dämonische Besessenheit eine Realität war, der man vernünftig und angemessen begegnen musste, doch ich war mir auch sicher, dass einseitiger Fanatismus in der christlichen Gemeinde ebenso schädlich war wie allgemein in jedem anderen Bereich des säkularen oder geistlichen Lebens.Ich kannte Leute, denen ihre Besuche in Grafton House eine große Hilfe gewesen waren. Ich kannte auch andere, die so weit gebracht wurden, dass sie Dämonen unter dem Bett, im Schornstein und im Briefschlitz zu sehen begannen, überall, wo sie doch eigentlich nur eine tiefere Gewissheit brauchten, dass Gott sie liebte. Meist begegnete ich diesen Befragungen damit, dass ich murmelte, ich sei sicher, die Leute dort meinten es gut, und wir müssten aufpassen, nicht etwas herunterzumachen, bevor wir genug darüber wüssten, um ein vernünftiges Urteil zu fällen. Dann wechselte ich so schnell wie möglich das Thema. Nicht sehr beeindruckend. Aber Tatsache war nun einmal, dass ich so gut wie nichts über das Innenleben dieses Hauses wusste. Wissen Sie, ich war noch nie wegen des Dienstes dort gewesen. Bisher war ich nur wegen des Sees gekommen.
Der See lag in einer Waldlichtung hinter dem Zentrum. Vor langer Zeit, als das große Anwesen noch in Privatbesitz gewesen war, musste dieses Gewässer der Stolz und die Freude seines Besitzers gewesen sein. Offensichtlich künstlich angelegt, wahrscheinlich in der viktorianischen Zeit erbaut, hatte der See die Form einer Acht, wobei einer der Kreise anderthalbmal so groß war wie der andere. Ein drei Meter breiter Kanal schwang an einer Seite in einem Halbkreis heraus und ließ so eine Insel entstehen, die man als gewöhnlicher Sterblicher nur über eine verfallene Holzbrücke erreichen konnte, die dringend reparaturbedürftig war. Diese etwa halbmondförmige Insel war ganz und gar von Rhododendren und Azaleen überwuchert; ein herrlicher Anblick, wenn ihre rosafarbenen, weißen und purpurnen Blüten in voller Pracht standen, doch nach Jahren der Vernachlässigung ungepflegt, verschossen und verfilzt. Weidenbäume säumten die Ufer des Sees und beugten sich demütig und in anmutigem Erstaunen, um ihre eigenen Spiegelbilder und gelegentlich auch einen der Schwärme von Riesenkarpfen zu grüßen, die sich träge nahe dem Ufer unter der Wasserfläche tummelten, geborgen in dem Wissen, dass das Fischen in diesem Gewässer seit Menschengedenken untersagt war.
Jessica und ich liebten diesen Ort. Wir verstanden nie, warum man diesen idyllischen kleinen Winkel des Geländes so achtlos verfallen und verwildern ließ. Der See war nicht gerade riesig; wenn man flott marschierte, konnte man ihn in zwanzig Minuten umrunden. Doch als einziges Zugeständnis, um ihn zugänglicher zu machen, hatte man einen schmalen Pfad grob durch das dichte Unterholz und das hohe Gras rings ums Ufer geschlagen, sodass man den See im Frühjahr und Sommer komplett umrunden konnte. Drei schmiedeeiserne Bänke, bei denen der Rost die Farbe abblättern ließ, boten Gelegenheit sich zu setzen und seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, eine an jedem Ende der Acht und eine (unsere Lieblingsbank) am Rande der Insel, vor dem Haus verborgen durch eine Rhododendronhecke und mit dem Blick hinaus auf den breitesten Teil des Sees. Vielleicht rentierte sich die Dämonenaustreibung nicht so besonders oder vielleicht stand die Arbeit an dem See und seiner Umgebung sehr niedrig auf der Liste kostspieliger Prioritäten der Leute, die das Zentrum betrieben, oder vielleicht mochten sie ihren See ja auch einfach so, wie er war. Was immer der Grund war, es kümmerte sich niemand darum, um es milde auszudrücken.
An dem Tag, nachdem Jessica gestorben war, war ich froh gewesen, dass die Gegend rund um den See so ungepflegt und rau war. Das passte zu dem Durcheinander in meiner Seele. Ich überquerte die gefährliche kleine Brücke, ohne mich groß darum zu scheren, ob sie einstürzte oder nicht, setzte mich auf die alte eiserne Bank und versuchte die Tatsache in den Kopf zu bekommen, dass sie nicht mehr da war.
Ich glaube, es war das Verstummen ihrer Stimme, das für mich am schwersten zu glauben war. Schwer zu glauben, verstehen Sie, nicht nur schwer zu akzeptieren. Es war noch schwerer als zu glauben, dass ihr Körper aufgehört hatte, eine warme, lebendige Person zu sein, und zu einer kalten, unbelebten Sache geworden war. Um Himmels willen, wie konnte eine solche Kraft der Absicht, besonders in Bezug auf mich, so vollkommen erlöschen? Wie konnte sie so abrupt enden? Wie konnte meine geliebte Jessica, wenn sie überhaupt noch auf irgendeiner Ebene existierte und wenn sie auch nur die entfernteste, dunkelste Möglichkeit hatte, mit mir zu kommunizieren, es versäumen, auf den Klang meiner Stimme zu reagieren, wenn ich sie brauchte? Vergiss die Theologie. Vergiss alles, was du je über den Tod gelernt oder gelehrt oder gepredigt hast. Hier zählte nur der gesunde Menschenverstand. Ich konnte nicht aufhören, der zu sein, der ich war. Sie konnte nicht aufhören, die zu sein, die sie war. Wir konnten niemals etwas anderes sein als wir. In jenem Moment fehlte mir jeder Glaube an die Endgültigkeit des Todes, aber das hatte nichts mit der Hoffnung auf den Himmel zu tun. Es hatte mit der Gewöhnung an das Leben zu tun. Ich beugte mich vor, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Hände miteinander verschränkt, und sprach flüsternd durch meine zusammengebissenen Zähne mit Jessica, als wäre ich ein Spion, der einem in den Büschen versteckten Kontaktmann Geheimnisse weitergibt.
„Jess, wo bist du? Kannst du mich hören? Hör zu, ich möchte nur, dass du für einen Moment hier bei mir bist - das ist alles. Bitte, ich kann es nicht aushalten. Komm zu mir, damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Bitte, Jess. Nur für eine oder zwei Minuten. Bitte … “
Stille. Warum antwortete sie mir nicht?
Der See und die ganze Umgebung wirkten alt und müde. Die Wasseroberfläche war still, aber es war keine heitere Stille; es hatte etwas Trostloses. Es war dumpf. Ohnmächtig. Enttäuscht. Dieser Ort war ebenso ein Hinterbliebener wie ich. Menschen wenden Zeit und Mühe auf, um Dinge zu bauen und zu entwickeln. Sie sehen frisch, gepflegt und schön aus. Die Jahre vergehen. Niemand kümmert sich mehr darum. Wege werden überwuchert, Tiefen setzen sich zu und werden seicht, Holz verfault und wird zu einer Gefahr, wenn man darübergehen oder sich darauf stützen muss. Mit den Menschen ist es genauso. Generation für Generation bauen Männer und Frauen etwas Gutes, Starkes, Lohnendes zusammen, nur damit es ihnen entrissen wird, wenn das Monster Tod kommt und den Garten der winzigen Dinge, die sie erreicht haben, zertrampelt und sich die besten Früchte herauspickt wie ein gieriges Kind. Generation für Generation. Was hatte das alles für einen Sinn? Mir kam eine Strophe aus einem Gedicht in den Sinn, das ich einmal gelesen hatte:
Ich nahm meine Tochter mit in den Park
Sie rannte ganz schnell zum Karussell
Das Karussell im Kreis sich drehte
Doch es fuhr leider nirgendwohin
Es drehte und drehte und drehte und drehte
Es drehte und drehte und drehte.
Vielleicht war es an der Zeit, Gott an einen Präzedenzfall zu erinnern. Ich setzte mich auf, legte meine Arme über die Rückenlehne und schlug meine Beine übereinander.
„Du hast doch auch C.S. Lewis kommen und mit J.B. Phillips sprechen lassen, nachdem er gestorben war, oder? Ganz plötzlich ist er aufgetaucht, sah kerngesund aus und redete vernünftig. Hast du das getan? Ich glaube, du hast es getan. Du kannst es tun. Vater, lass mich Jessica sehen. Lass mich meine Jessica sehen. Bitte tu das für mich. Ich tue ja auch alles Mögliche für dich.“
Meine Stimme brach ein wenig, als ich weitersprach.
„Bitte tu diese eine Kleinigkeit für mich. Sie braucht nicht einmal mit mir zu reden. Es würde mir schon reichen, nur einen Blick auf sie zu erhaschen, wie sie dort hinter den Bäumen auf der anderen Seite des Sees entlanggeht. Nur ein ganz kurzer Blick, mehr will ich gar nicht. Vielleicht könnte sie nach ein paar Frühblumen suchen, um sie für dich zu pflücken. Dann könnte sie aufblicken und lächeln, wenn sie mich sieht, und dann weitergehen und verschwinden. Das würde mir schon reichen. Vater, bitte lass mich sie nur noch einmal lächeln sehen. Gib mir keinen Stein, wenn ich dich um etwas Gutes zu essen bitte. Nur noch ein einziges Mal. Bitte … “
Tränen stiegen mir in die Augen, als ich diesen Unsinn aus meinem eigenen Mund kommen hörte. Ich bildete mir ein, ich könnte die Worte, die ich gesprochen hatte, wie flache Steine über die Oberfläche des Sees hüpfen sehen. Sie hatten nicht genug Schwung, um die andere Seite zu erreichen, und versanken unwiederbringlich vor meinen Augen. Trotz der Tränen hätte ich beinahe laut aufgelacht. Was ritt mich denn da, dass ich Gott nahe legte, er solle bitte schön so dankbar sein, mich für all die wunderbaren Dienste zu belohnen, die ich ihm erwies? Nun ja, diese Verwirrung durch die Trauer würde irgendwann vorübergehen, und dann …
Plötzlich setzte ich mich kerzengerade auf. Mein Blick hing wie gebannt an einer Stelle gegenüber auf der anderen Seite des Sees, wo der Pfad teilweise durch hohes Gras und wucherndes Unterholz verdeckt war. Für einen Augenblick hatte ich etwas Karmesinrotes aufblitzen sehen, genau der üppige, tiefe Rotton, den Jessica so oft getragen hatte, weil er so gut zu ihrem dunklen Teint passte. Jessica! Jessica war dort drüben auf der anderen Seite des Sees! Gott hatte mein Gebet erhört. Ich musste zu ihr!
Ich sprang auf, umrundete die Büsche und war mit zwei Sätzen über die Brücke. Dann blieb ich unentschlossen stehen. Mein ganzer Körper bebte. Welcher Weg war schneller, mit dem Uhrzeigersinn oder dagegen? Egal. Ganz egal. Beides ging.
Ich wandte mich nach links und stürmte den schmalen, rutschigen Pfad entlang, ohne auf Baumwurzeln, überhängende Äste oder irgendwelche anderen natürlichen Hinterhalte zu achten. In mir brannte ein wahnsinniges Verlangen, dem Teil meines Gehirns, der immer noch stur in seiner skeptischen Gelassenheit verharrte, zu beweisen, dass wirklich etwas Außergewöhnliches geschehen war - geschehen würde. Jessica war dort drüben auf der anderen Seite des Wassers und wartete auf mich. Oh, Jessica! Als ich das untere Ende des Sees umrundete, setzte plötzlich ein heftiger Regen ein. Es kümmerte mich nicht. Warum sollte es mich kümmern? Ich bemerkte es kaum. Weiter und immer weiter flog ich am Rande des Sees entlang, fegte mit den Ellbogen Sträucher und hohes Gras zur Seite und trieb mich mit dem Wissen, dass schon bald jenes liebe, vertraute Gesicht vor mir erscheinen würde und wir reden und einander umarmen und zusammen sein würden wie in all den Jahren bisher, zu einer halsbrecherisch galoppierenden Geschwindigkeit an. Endlich, höchstens zehn Meter vor mir, sah ich das karmesinrote Kleidungsstück wieder durch die Lücken im Vorhang der Zweige einer alten Trauerweide schimmern. Die Person, die es trug - Jessica - musste wohl unter dem Baum Zuflucht vor dem Regen gesucht haben. So nahe! Für die letzten Meter brauchte ich nicht mehr als eine Sekunde. Keuchend vor Erschöpfung und schierer Erregung schob ich die schweren, triefend herabhängenden Zweige mit einer Hand zur Seite, während ich mir mit der anderen den Schweiß und den Regen von den Augen wischte, und trat unter den Baldachin.
Es war nicht Jessica. Natürlich war es nicht Jessica.
Es war eine kleine, elfengesichtige Frau mit verängstigten Vogeläuglein und dünnen grauen Locken. Sie war etwa fünfundsechzig und trug einen karmesinroten Pulli mit zwei winzigen eingestrickten Schafen auf der Vorderseite, einen unauffälligen Tweedrock und geländegängige braune Schuhe. Ihre Haut hatte etwas kränklich Blasses, und ihre Augen lagen tief und dunkel in den Höhlen, sodass ich den Eindruck hatte, sie sei schwer krank. Mein dramatisches Erscheinen unter dem Dach des Baumes, unter dem sie Zuflucht vor dem schlimmsten Regen gesucht hatte, schien sie kaum zu stören. Den Grund dafür verstand ich, als wir uns unterhielten. Manche Leute nehmen so beständig die Rolle eines Opfers ein, dass sie sich eine Haltung lethargischer Ergebenheit angewöhnen, eine müde Resignation vor dem Gedanken, dass ihnen immer irgendetwas passiert oder angetan wird. Was immer sie auch zu tun versuchen, es wird ohnehin nie eine spürbare Wirkung auf andere Leute haben. Die arme kleine Nora gehörte zu diesen Leuten.
Ihr Leben hörte sich an wie das einer Figur aus einem Roman von Agatha Christie. Nora hatte für eine reiche, bissige alte Frau gearbeitet, die sie während der letzten dreißig Jahre ihres Lebens Tag und Nacht betreut hatte. Seit deren Tod litt sie an schweren Panikattacken und an dem Gefühl, Gott sei immerzu böse auf sie. Ihr Arzt, der Christ war, hatte sie zu einem Ehepaar geschickt, das er kannte und das als „Experten“ auf diesem Gebiet galt. Nach zwei oder drei Besuchen dort hatte Nora zu hören bekommen, sie sei den Dämonen der Furcht, der Unsicherheit und des Kleinglaubens unterworfen. Eine Woche der Art von Seelsorge, wie sie in Grafton House betrieben wurde, sei genau das Richtige für sie. Lust dazu hatte sie nicht, aber sie fuhr hin.
„Es wäre mir unhöflich vorgekommen, es abzulehnen“, sagte Nora, „wo doch alle so nett zu mir waren. Man will ja nicht - Sie wissen schon.“
Ich wusste, was ich zu ihr sagen musste.
Ich bat sie, mir von ihrem Vater zu erzählen, und während sie sprach, sah ich zu, wie der prasselnde Regen Tausende kleiner Kreise auf dem Wasser erzeugte. Sie sagte mir, wie sehr sie ihn geliebt und respektiert hatte, wie freundlich und liebevoll er immer gewesen sei und wie furchtbar traurig er jetzt wäre, wenn er sehen könnte, durch was für Nöte seine kleine Norrie jetzt ging. Sie weinte ein wenig. Ich legte meinen Arm um ihre Schultern. Sie zog ein besticktes Taschentuch aus dem Ärmel ihres roten Pullovers und trocknete sich damit die Augen.
„Nora“, sagte ich, „ich weiß nicht viel, aber eines weiß ich: Gott ist genauso, wie Ihr Vater war, nur womöglich noch netter. Wenn Sie an Gott denken, dann geben Sie ihm das Gesicht Ihres Vaters. Das wird Gott nichts ausmachen. Wenn Sie mich fragen, dann glaube ich, dass Sie all diese furchtbar negativen Gefühle deshalb hatten, weil sich Ihr Leben so stark und so schnell verändert hat. Ich glaube nicht, dass auch nur ein einziger Dämon in Ihnen steckt, und ich finde, Sie sollten ernsthaft darüber nachdenken, Ihren Arzt zu wechseln. Möchten Sie, dass ich für Sie bete?“
Ich sprach ein Gebet für Nora. Sie weinte noch ein wenig, lächelte mich an und schaute dann auf die winzige goldene Uhr an ihrem linken Handgelenk.
„Ooh!“
Es war Zeit für den Vormittagskaffee oben im Speisesaal des großen Hauses. Sie durfte nicht zu spät zum Kaffee erscheinen, wo doch die Leute in der Küche ihn so liebevoll für alle vorbereitet hatten. Sie wollte sich gerade unter den Zweigen hindurchducken und im Regen verschwinden, als sie sich noch einmal umdrehte.
„Ach - ich habe Sie noch gar nicht gefragt - wie unhöflich von mir - warum sind Sie eigentlich hier heraus an den See gekommen?“
Ich starrte sie einen Moment an. Warum war ich hier?
„Oh, äh, ich bin gekommen, um mich mit meiner Frau zu treffen.“
„Na, ich hoffe, sie kommt noch.“
„Ja.“
Während ich Nora hinterhersah, wie sie den Pfad entlang davonhuschte und dabei in dem vergeblichen Bemühen, ihre Haare vor dem Regen zu schützen, eine Hand über den Kopf hielt, war es mir, als wäre zu meinem Schmerz noch ein Teil von ihrem dazugekommen.
„Gott“, sagte ich leise, „was ist eigentlich los mit dir? Ich bitte dich, mir etwas zu geben, und was tust du? Du gibst mir stattdessen einen Job. Bei dir gibt es wohl keine freien Tage, was? Keinen Urlaub aus persönlichen Gründen. Du wusstest, dass ich es tun würde, genau wie du wusstest, dass der arme alte Jona schon aktiv werden würde, wenn er erst einmal in Ninive war. Aber, oh, Gott!“, seufzte ich aus tiefster Seele. „Warum musste ihr Pullover ausgerechnet diese Farbe haben?“
Ich blieb noch ein paar Minuten sitzen und weinte mit dem Regen, verwirrt über das Dasein und wütend auf Jessica und auf Gott, weil sie mir nicht gaben, was ich wollte.
In dieser Woche verbrachte ich jeden Tag einige Zeit oben am See. Manchmal saß ich nur da und manchmal ging ich spazieren; manchmal lehnte ich mich einfach nur unglücklich gegen einen Baum, aber immer brannte in mir die jämmerliche Hoffnung, wenn ich nur nicht in meinem Flehen nachließe, würde Jessica vielleicht doch zu mir kommen und sich von mir umarmen und noch ein letztes Mal küssen lassen. Am Ende der Woche war der Wahnsinn, falls es das war, vorüber. Ich ging nicht mehr an den See. Ich wusste - natürlich hatte ich es immer gewusst -, dass ich Jessica dort nicht begegnen würde. Doch als ich zum letzten Mal von dort aufbrach, war mir, als ließe ich sie dort an jenem melancholischen Ort zurück. Eine Woche oder länger gab es etwas in mir, das den Wahnsinn vermisste. Immerhin war so etwas wie Hoffnung darin gewesen, so töricht und irrational sie auch gewesen sein mochte. Nun war selbst diese törichte Hoffnung dahin, und übrig blieben nur die Sehnsucht und der Zorn, der heiß in meinem Herzen brannte.
Als ich sechs Monate später mit Angelas Brief in der Hand wieder auf das Gelände von Grafton House zurückkehrte, war das ein ganz anderes Erlebnis. Das Wetter zum Beispiel. Damals nach Jessicas Tod war die ganze Woche über trübes Wetter gewesen. Die Morgensonne ist so freundlich zu allem, was sie berührt, und Wasser findet Licht natürlich besonders unwiderstehlich. Das Gelände war so vernachlässigt wie eh und je, aber der See zeigte mir sein bestes Gesicht und erwiderte fröhlich das Strahlen seiner Wohltäterin.
Trotzdem stellte ich fest, dass es mir nicht gefiel, dort zu sein. Ich wünschte mir, ich wäre nicht gekommen. Es hatte mir Spaß gemacht, wieder einmal Rad zu fahren. Das war schlimm genug. Als ich dann die baufällige Brücke zur Insel überquerte, zermarterte ich mir den Kopf über den Ursprung eines vertrauten Gefühls der Nervosität und Aufregung, von dem mir fast ein bisschen übel wurde. Als ich mich auf die rostige alte Bank vor den Rhododendron setzte, fiel mir plötzlich wieder ein, was das für ein Gefühl war. Natürlich, so hatte ich mich vor vielen Jahren vor einer Verabredung mit einem Mädchen gefühlt. Mit einem oder zwei anderen Mädchen vor Jessica, und dann etliche Male mit ihr. Offenbar erinnerte sich ein Teil meines Gehirns an mein einwöchiges hoffnungsloses Flehen hier am See so, als wäre es eine echte Begegnung mit meiner toten Frau gewesen, und rechnete damit, dass ich ihr auch jetzt begegnen würde. Aber das war nur ein Trick meines Unterbewusstseins. Ich würde Jessica nicht begegnen. Sie war nicht hier, jetzt genauso wenig wie damals. Traurig spähte ich über den See hinweg hinüber zu Noras Trauerweide. Heute würde verdammt viel mehr als ein Aufblitzen von Karmesinrot notwendig sein, damit ich wieder rund um den See raste. Was wohl aus dieser verängstigten kleinen Frau geworden war? Hatte sie einen Gott gefunden, der ihr zulächelte? Ich hoffte es.
Angelas Brief.
Ich nahm die zerknitterten Blätter aus meiner Hosentasche, strich sie glatt und las das Ganze ein weiteres Mal durch. Was sollte ich tun? Was wollte ich? Wollte ich wirklich zu so einem seltsamen alten Spukhaus fahren, um Leute wiederzusehen, an die ich mich wahrscheinlich sowieso nicht erinnerte, und es auf mich nehmen, dass sie mich mit Fragen löcherten und mir erzählten, wie Leid es ihnen tue, was passiert sei? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich irgendeinen engeren Kontakt zum Leben anderer Menschen riskieren, der mich womöglich dazu zwingen würde, mich wieder zu öffnen und im Land der Lebenden aufzutauchen? Nein, das wollte ich nicht. Und würde es wahrscheinlich dazu kommen?
Als ich in diesem Moment zum blauweißen Himmel aufblickte, sah ich die unschuldigen Augen Gottes, der offenbar gerade in eine andere Richtung schaute. Ich stöhnte.
Also, ich würde nicht hinfahren. Ich würde einfach nicht hinfahren. Wütend schlug ich mit dem Umschlag auf mein Knie. Na schön, wenigstens mit dem Gedanken würde ich mich befassen.
Wollte ich Angela wiedersehen? Nun, ja, wahrscheinlich. Meine Erinnerungen an sie, der Tonfall ihres Briefes, ihre Freundschaft mit Jessica - ja, dachte ich, ich würde Angela wohl gerne wiedersehen, wenn auch am liebsten ohne einen Haufen anderer Leute dabei. Wollte ich herausfinden, was Jessica in jenen letzten Stunden vor ihrem Tod für mich ausgeheckt hatte? Nein.
Ja! Ja! Ja! Ja, ich wollte es wissen! Ja! Ich wollte diese Sache haben, die Jessica Angela für mich gegeben hatte. Es gehörte mir. Ich wollte es haben! Es stand mir zu! Also, ich würde Angela anrufen und entschlossen auftreten. Einfach verlangen, dass sie mir diese Sache übergab, was immer es war, ohne dieses alberne Getue mit dem Wiedersehenstreffen.
Ich blätterte den Brief durch, las noch einmal den letzten Abschnitt und überlegte, wie wenig ich über Angela und wie viel ich über Jessica wusste. Dann schüttelte ich den Kopf. Nein, nicht ich allein gegen diese beiden. Das würde nicht funktionieren.
Konnte ich überhaupt hinfahren, falls ich wollte? Ja, es ging schon. Was Angela offensichtlich nicht wusste, war, dass ich gleich nach Jessicas Tod alle meine Vortragstermine für den Rest des Jahres abgesagt hatte. Die Einladungen für das nächste Jahr stapelten sich zu Hause auf dem Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer, das ich nur selten betrat. Sollten sie sich stapeln, solange sie wollten. Dieses Leben hatte ich jetzt hinter mir. Irgendwann würde ich mir irgendeinen Job suchen müssen, sicher, aber im Moment hatte ich keine finanziellen Probleme. Wie die Ironie es wollte, hatte gerade Jessicas Verlust dafür gesorgt. Nein, Tatsache war, dass ich vermutlich mehr Zeit hatte als jeder andere, der zu einem solchen Wochenende kommen mochte. Keine Kinder. Würde auch nie welche haben. Keine Frau. Nie wieder. Frei.
„Scheiße!“
Trauer und Zorn schüttelten meinen Körper wie ein Krampf und höhlten meinen Magen aus. Zum Kuckuck mit allen! Ich würde nirgendwohin fahren. Sollte Angela das verdammte Ding doch behalten, was immer es war! Sollten sie doch ihr Wiedersehenstreffen machen und sich besaufen und sich alle gegenseitig vollkotzen! Viel Spaß dabei. Ich stierte über den See hinweg. Ich hatte mich geirrt. Ein kleines Aufblitzen von Rot und ich wäre wieder gerannt wie ein Berserker. Oh, Jessica!
Ich stand auf, stopfte den Brief in meine Tasche, kehrte dem See den Rücken, überquerte die Brücke und stapfte den Hang hinauf zum Haus. Mein Fahrrad hatte ich an den Drahtzaun eines mit Löwenzahn überwucherten, unebenen alten Tenniscourts gelehnt, noch so eine eigentlich vorzügliche Einrichtung, die durch Vernachlässigung zu Grunde gerichtet worden war.
„Allmählich fange ich an, diesen Ort zu hassen!“, murmelte ich vor mich hin.
Ich schwang mein Bein über den Sattel, stieß mich mit dem Fuß ab und rollte über den Parkplatz. Als ich die Auffahrt erreichte, die das Haus und das Gelände mit der Hauptstraße verband, beschleunigte ich, so schnell ich konnte. Ich stellte mich auf die Pedalen und stemmte mich mit aller Kraft hinein. Die Muskelanstrengung, die nötig war, um Tempo und Schwung zu gewinnen, war mit einem exquisiten, unvermeidlichen Genuss verbunden. Da die Strecke leicht abschüssig war, war ich schon nach einer halben Minute so schnell, dass das Fahrrad auseinander zu fliegen drohte. Mit gesenktem Kopf jagte ich den kurvenreichen Weg entlang, ohne auf irgendetwas zu achten außer der Luft, die mir um Kopf und Schultern strömte, und das Zischen der dünnen Rennreifen, die unablässig auf dem schwarzen Asphalt rotierten.
Mit meiner Geschwindigkeit hätte ich leicht in einer der engen Kurven mit etwas zusammenstoßen können. Mit einem Fußgänger vielleicht. Mit einem Auto. Oder mit einem anderen Radfahrer. „Vielleicht“, dachte ich mit einem schwindeligen Gefühl im Kopf, „rolle ich einfach weiter, wenn ich auf die Hauptstraße komme.“ Wenn ich einfach die Augen zumachte und in den fließenden Verkehr hineinradelte, dann war das vermutlich das Ende. Problem gelöst. Warum nicht? Als ich mich dem Tor der Einfahrt näherte, hatte ich immer noch volles Tempo. Direkt vor mir rollte der Verkehr mit hoher Geschwindigkeit in beiden Richtungen. So war es immer in diesem Abschnitt der Straße. Alles, was ich tun musste, war, die Augen zu schließen und weiter in die Pedalen zu treten.
Zentimeter vom Straßenrand entfernt kam ich mit längsseits über das Pflaster radierenden Reifen zum Stehen, und ich brauchte eine Weile, um meinen Atem und meinen Mut zurückzugewinnen, bevor ich mich in gemessenerem Tempo und vernünftigerem Geisteszustand auf den Heimweg machen konnte.
Nun ja, sagte ich mir, als ich den kleinen Verkehrskreisel am Ende meiner Straße erreichte, zumindest hatte ich an diesem Vormittag eine feste Entscheidung getroffen. Angela konnte behalten, was immer es war, was sie hatte. Kein Wiedersehenstreffen für mich.
Zu Hause machte ich mir eine Tasse Tee, ging damit an den Schreibtisch in meinem vernachlässigten Arbeitszimmer und schaltete die Schreibtischlampe ein. Ich nahm einen Stift aus dem Becher zu meiner Rechten, ein Blatt Papier von dem Stapel zu meiner Linken, und setzte mich hin, um Angela zu schreiben, ihr für ihren Brief zu danken und ihre Einladung zu einem Wiedersehenstreffen der Jugendgruppe von St. Mark's in Headly Manor an jedem ihr genehmen Wochenende anzunehmen.